Exoplaneten: Wie "gewöhnlich" ist das Sonnensystem?
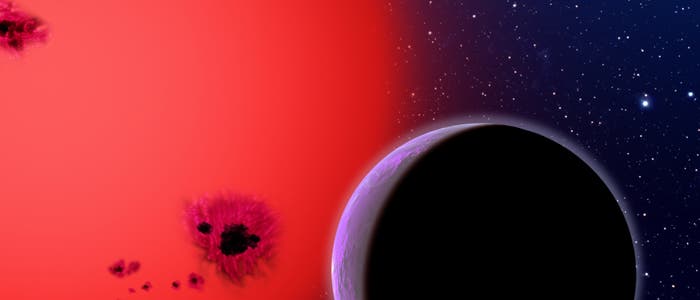
© David A. Aguilar, Harvard-CfA (Ausschnitt)
Schon 15 Jahre ist es her, dass die Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz den ersten Planeten, 51 Pegasi b, bei einem fremden, sonnenähnlichen Stern entdeckten. Inzwischen kennt man über 400 Exoplaneten, und fast täglich kommen neue hinzu. An Faszination haben sie dennoch nicht verloren, im Gegenteil: Die Suche nach fernen Welten war auch auf der Bonner DPG-Frühjahrstagung vom 15. bis 19. März ein heißes Thema.
Mit einem so seltsamen Exemplar wie 51 Pegasi b hatte vor 15 Jahren allerdings niemand gerechnet, berichtete Artie Hatzes, Direktor der Thüringer Landessternwarte, in seinem Eröffnungsvortrag zum Symposium "Extrasolare Welten". (Der Amerikaner mit griechischen Wurzeln ist selbst mehrfacher Planetenentdecker und arbeitet an vorderster Front der Exoplanetensuche, unter anderen mit dem französischen Satellitenteleskop CoRoT.) "Alle unsere ursprünglichen Annahmen bezüglich der Massen und Größen der Planeten sowie ihrer Orbits haben sich mit der Zeit als falsch herausgestellt", so sein Fazit der aufregenden letzten Jahre.
Anfangs habe man eine Neuauflage des altbekannten Sonnensystems erwartet: erdähnliche Planeten innen, Gasriesen außen, alle auf halbwegs kreisförmigen Bahnen im gleichen Drehsinn und in einer gemeinsamen Ebene um ihren Stern. Doch kaum einer der neuen Planeten wollte sich so verhalten wie seine vermeintlichen Vorbilder im Sonnensystem. Der Gasplanet 51 Pegasi b zum Beispiel erwies sich als halb so schwer wie Jupiter und doch näher an seinem Stern gelegen als Merkur, seine Oberflächentemperatur dürfte fast 1000 Grad Celsius betragen. Mit der Zeit fand man sogar so viele Exemplare mit ähnlichen Eigenschaften, dass sich für sie eine eigene Bezeichnung etablierte: "hot Jupiters" – heiße Jupiter.
Alles andere als geordnet
Immer ausgefeiltere Methoden sollen nun nach und nach Licht ins Dunkel bringen. Heute können Hatzes und seine Kollegen bei einigen Planeten sogar die räumliche Lage ihrer Umlaufbahn messen. Dazu nutzen sie den schon 1924 entdeckten Rossiter-McLaughlin-Effekt: Das Licht, das ein rotierender Stern aussendet, ist durch den Dopplereffekt dort ins Blaue verschoben, wo sich die Oberfläche des Sterns zu uns hindreht, und ins Rote, wo sie sich wegdreht.
Zieht nun ein Planet vor dem Stern vorbei, so verdunkelt er diesen ein klein wenig, sodass sich anhand der "Dimmung" zunächst seine Größe bestimmen lässt. Danach kommt der Rossiter-McLaughlin-Effekt ins Spiel: Durch genaue Spektraluntersuchungen lässt sich mit seiner Hilfe auch die Umlaufrichtung bestimmen – zeigt sie in Richtung der Rotationsbewegung des Sterns oder ist sie ihr entgegengesetzt? – und die Neigung des Planetenorbits gegen die Rotationsachse des Sterns, also die Inklination.
Auch hier gelangten die Wissenschaftler zu verblüffenden Resultaten. Die Welt der Exoplaneten scheint, im Gegensatz zu unserem Sonnensystem, alles andere als geordnet zu sein (siehe auch Die chaotische Geburt der Planeten in SdW 6/2008). Viele Planeten besitzen exzentrische Umlaufbahnen, starke Inklinationen und sogar die "falsche" Umlaufrichtung, drehen sich also entgegen der Rotationsrichtung ihres Sterns.
Diese Entdeckungen stellen die Modelle der Planetenentstehung auf eine harte Probe – und ihre Entwickler vor neue Herausforderungen, wie Wilhelm Kley von der Universität Tübingen in einem weiteren Vortrag berichtete. Schließlich sollten, so die klassische Theorie, Sterne und Planeten gemeinsam aus sich verdichtenden Gas- und Staubwolken entstanden sein. Das Ergebnis eines solchen Prozesses wäre eine Materiescheibe, deren Rotation auch die Bewegungsrichtung und -orientierung der Planeten vorgibt.
Ganz so scheint es aber nun doch nicht zu sein. Mit einiger Mühe versuchen Theoretiker, die neuen Entdeckungen zu erklären: "Die Ursache für die Exzentrizitäten und Inklinationen der Planetenbahnen sind möglicherweise Wechselwirkungen zwischen den Planeten in der frühen Entwicklungsphase", sagte Kley. "Die gegenseitigen Störungen könnten einen Planeten sogar ganz aus dem Sternsystem hinauskatapultieren." Beispiele dafür gibt es: Bereits vor rund zehn Jahren wurden im Orionnebel die ersten "free-floating planets" gefunden, Planetenwaisen also, die sich keinem Zentralgestirn zuordnen ließen (siehe auch Planeten als Einzelgänger" in SdW 2/2003).
Der Fingerabdruck des Lebens
Eins allerdings ist sicher: So attraktiv free floaters und Planeten in chaotischen Sternsystemen für die Forscher auch sind – wer nach Leben auf einer "zweiten Erde" fahndet, muss sein Glück anderswo versuchen. Aber auch das gelingt künftig besser als je zuvor. "Mit der nächsten Generation von Infrarotteleskopen sollte es möglich sein, die Existenz von Biomarkern in den Atmosphären der Exoplaneten nachzuweisen", berichtete Heike Rauer, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Beherbergt ein Planet Leben, so reichern sich infolge biologischer Prozesse wie der Photosynthese bestimmte Gase an. Zieht der Planet vor seinem Stern vorbei, prägen diese Gase dem Sternspektrum ein charakteristisches Muster auf – den Fingerabdruck des Lebens. Die Studien von Rauer und ihren Kollegen, in denen sie diesen Vorgang simulieren, zeigen, dass insbesondere Ozon deutliche Spuren in den Messwerten hinterlassen würde. Noch aber reicht die Genauigkeit der Spektrografen für den Nachweis des Moleküls nicht aus; erst mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA, das in vier Jahren gestartet werden soll, wird eine detaillierte Untersuchung einer Exoplanetenatmosphäre möglich sein.
Doch weder bei heißen Jupitern und noch viel weniger bei jenen Planeten, die um Pulsare oder Neutronensterne kreisen, wird man überhaupt nach Leben suchen – die dort herrschenden Bedingungen sind allzu extrem. Zudem ist die grundsätzliche Frage, ob unser Sonnensystem etwas Besonderes, ja vielleicht sogar Einzigartiges darstellt, weiterhin offen. Noch einmal Artie Hatzes: "Eines ist klar: Mit der bisherigen Genauigkeit unserer Methoden hätten wir unser eigenes Sonnensystem, wenn wir es von einem der bislang entdeckten Exoplaneten aus suchen müssten, noch gar nicht nachweisen können."
Selbst der jüngst entdeckte Exoplanet CoRoT-9b (siehe Meldung Durchschnitts-Exoplanet erlaubt bessere Einblicke auf astronomie-heute.de) macht es uns noch vergleichsweise leicht. Er ist der Planet mit der längsten Umlaufdauer um seinen Stern – 95 Tage –, der je mit der Transitmethode entdeckt wurde. "Jupiter hingegen", sagt Hatzes, "benötigt fast zwölf Jahre." Das ist für heutige Technik ein k.o.-Kriterium. Nach wie vor bleibt es auch schwierig, kleine Planeten wie die Erde aufzuspüren. Stoßen wir also nur deshalb so häufig auf Exoten, weil wir "gewöhnliche" Exemplare gar nicht nachweisen können? Oder ist das Sonnensystem, das wir für "durchschnittlich" halten, möglicherweise doch ein Unikum?
Die kommenden Jahre werden jedenfalls spannend, so Hatzes: "Bisher haben wir Exoplaneten 'nur' entdecken können – jetzt gelingt es mehr und mehr, ihre Eigenschaften zu entschlüsseln." Die Suche nach der zweiten Erde hat gerade erst begonnen.
Der Autor Jan Hattenbach betreibt bei den KosmoLogs auch den Blog Himmelslichter.
Mit einem so seltsamen Exemplar wie 51 Pegasi b hatte vor 15 Jahren allerdings niemand gerechnet, berichtete Artie Hatzes, Direktor der Thüringer Landessternwarte, in seinem Eröffnungsvortrag zum Symposium "Extrasolare Welten". (Der Amerikaner mit griechischen Wurzeln ist selbst mehrfacher Planetenentdecker und arbeitet an vorderster Front der Exoplanetensuche, unter anderen mit dem französischen Satellitenteleskop CoRoT.) "Alle unsere ursprünglichen Annahmen bezüglich der Massen und Größen der Planeten sowie ihrer Orbits haben sich mit der Zeit als falsch herausgestellt", so sein Fazit der aufregenden letzten Jahre.
Anfangs habe man eine Neuauflage des altbekannten Sonnensystems erwartet: erdähnliche Planeten innen, Gasriesen außen, alle auf halbwegs kreisförmigen Bahnen im gleichen Drehsinn und in einer gemeinsamen Ebene um ihren Stern. Doch kaum einer der neuen Planeten wollte sich so verhalten wie seine vermeintlichen Vorbilder im Sonnensystem. Der Gasplanet 51 Pegasi b zum Beispiel erwies sich als halb so schwer wie Jupiter und doch näher an seinem Stern gelegen als Merkur, seine Oberflächentemperatur dürfte fast 1000 Grad Celsius betragen. Mit der Zeit fand man sogar so viele Exemplare mit ähnlichen Eigenschaften, dass sich für sie eine eigene Bezeichnung etablierte: "hot Jupiters" – heiße Jupiter.
Alles andere als geordnet
Immer ausgefeiltere Methoden sollen nun nach und nach Licht ins Dunkel bringen. Heute können Hatzes und seine Kollegen bei einigen Planeten sogar die räumliche Lage ihrer Umlaufbahn messen. Dazu nutzen sie den schon 1924 entdeckten Rossiter-McLaughlin-Effekt: Das Licht, das ein rotierender Stern aussendet, ist durch den Dopplereffekt dort ins Blaue verschoben, wo sich die Oberfläche des Sterns zu uns hindreht, und ins Rote, wo sie sich wegdreht.
Zieht nun ein Planet vor dem Stern vorbei, so verdunkelt er diesen ein klein wenig, sodass sich anhand der "Dimmung" zunächst seine Größe bestimmen lässt. Danach kommt der Rossiter-McLaughlin-Effekt ins Spiel: Durch genaue Spektraluntersuchungen lässt sich mit seiner Hilfe auch die Umlaufrichtung bestimmen – zeigt sie in Richtung der Rotationsbewegung des Sterns oder ist sie ihr entgegengesetzt? – und die Neigung des Planetenorbits gegen die Rotationsachse des Sterns, also die Inklination.
Auch hier gelangten die Wissenschaftler zu verblüffenden Resultaten. Die Welt der Exoplaneten scheint, im Gegensatz zu unserem Sonnensystem, alles andere als geordnet zu sein (siehe auch Die chaotische Geburt der Planeten in SdW 6/2008). Viele Planeten besitzen exzentrische Umlaufbahnen, starke Inklinationen und sogar die "falsche" Umlaufrichtung, drehen sich also entgegen der Rotationsrichtung ihres Sterns.
Diese Entdeckungen stellen die Modelle der Planetenentstehung auf eine harte Probe – und ihre Entwickler vor neue Herausforderungen, wie Wilhelm Kley von der Universität Tübingen in einem weiteren Vortrag berichtete. Schließlich sollten, so die klassische Theorie, Sterne und Planeten gemeinsam aus sich verdichtenden Gas- und Staubwolken entstanden sein. Das Ergebnis eines solchen Prozesses wäre eine Materiescheibe, deren Rotation auch die Bewegungsrichtung und -orientierung der Planeten vorgibt.
Ganz so scheint es aber nun doch nicht zu sein. Mit einiger Mühe versuchen Theoretiker, die neuen Entdeckungen zu erklären: "Die Ursache für die Exzentrizitäten und Inklinationen der Planetenbahnen sind möglicherweise Wechselwirkungen zwischen den Planeten in der frühen Entwicklungsphase", sagte Kley. "Die gegenseitigen Störungen könnten einen Planeten sogar ganz aus dem Sternsystem hinauskatapultieren." Beispiele dafür gibt es: Bereits vor rund zehn Jahren wurden im Orionnebel die ersten "free-floating planets" gefunden, Planetenwaisen also, die sich keinem Zentralgestirn zuordnen ließen (siehe auch Planeten als Einzelgänger" in SdW 2/2003).
Der Fingerabdruck des Lebens
Eins allerdings ist sicher: So attraktiv free floaters und Planeten in chaotischen Sternsystemen für die Forscher auch sind – wer nach Leben auf einer "zweiten Erde" fahndet, muss sein Glück anderswo versuchen. Aber auch das gelingt künftig besser als je zuvor. "Mit der nächsten Generation von Infrarotteleskopen sollte es möglich sein, die Existenz von Biomarkern in den Atmosphären der Exoplaneten nachzuweisen", berichtete Heike Rauer, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Beherbergt ein Planet Leben, so reichern sich infolge biologischer Prozesse wie der Photosynthese bestimmte Gase an. Zieht der Planet vor seinem Stern vorbei, prägen diese Gase dem Sternspektrum ein charakteristisches Muster auf – den Fingerabdruck des Lebens. Die Studien von Rauer und ihren Kollegen, in denen sie diesen Vorgang simulieren, zeigen, dass insbesondere Ozon deutliche Spuren in den Messwerten hinterlassen würde. Noch aber reicht die Genauigkeit der Spektrografen für den Nachweis des Moleküls nicht aus; erst mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA, das in vier Jahren gestartet werden soll, wird eine detaillierte Untersuchung einer Exoplanetenatmosphäre möglich sein.
Doch weder bei heißen Jupitern und noch viel weniger bei jenen Planeten, die um Pulsare oder Neutronensterne kreisen, wird man überhaupt nach Leben suchen – die dort herrschenden Bedingungen sind allzu extrem. Zudem ist die grundsätzliche Frage, ob unser Sonnensystem etwas Besonderes, ja vielleicht sogar Einzigartiges darstellt, weiterhin offen. Noch einmal Artie Hatzes: "Eines ist klar: Mit der bisherigen Genauigkeit unserer Methoden hätten wir unser eigenes Sonnensystem, wenn wir es von einem der bislang entdeckten Exoplaneten aus suchen müssten, noch gar nicht nachweisen können."
Selbst der jüngst entdeckte Exoplanet CoRoT-9b (siehe Meldung Durchschnitts-Exoplanet erlaubt bessere Einblicke auf astronomie-heute.de) macht es uns noch vergleichsweise leicht. Er ist der Planet mit der längsten Umlaufdauer um seinen Stern – 95 Tage –, der je mit der Transitmethode entdeckt wurde. "Jupiter hingegen", sagt Hatzes, "benötigt fast zwölf Jahre." Das ist für heutige Technik ein k.o.-Kriterium. Nach wie vor bleibt es auch schwierig, kleine Planeten wie die Erde aufzuspüren. Stoßen wir also nur deshalb so häufig auf Exoten, weil wir "gewöhnliche" Exemplare gar nicht nachweisen können? Oder ist das Sonnensystem, das wir für "durchschnittlich" halten, möglicherweise doch ein Unikum?
Die kommenden Jahre werden jedenfalls spannend, so Hatzes: "Bisher haben wir Exoplaneten 'nur' entdecken können – jetzt gelingt es mehr und mehr, ihre Eigenschaften zu entschlüsseln." Die Suche nach der zweiten Erde hat gerade erst begonnen.
Der Autor Jan Hattenbach betreibt bei den KosmoLogs auch den Blog Himmelslichter.

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben