Memristor: Legosteine für ein künstliches Nervensystem
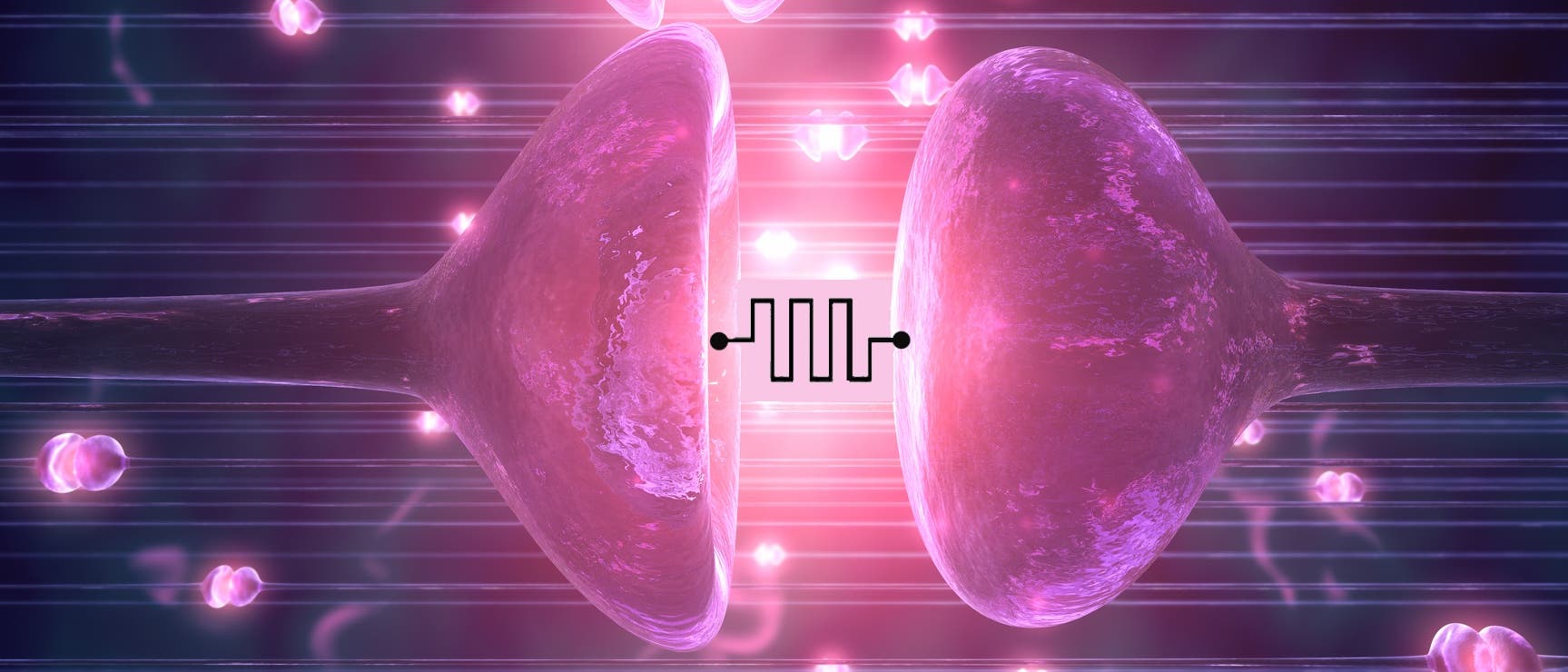
100 Milliarden Nervenzellen, von denen jede über Synapsen mit durchschnittlich 10 000 anderen verbunden ist – das menschliche Gehirn ist überaus komplex [1]. Seine Modellierung in elektronischer Hardware scheint deshalb ein hoffnungsloses Unterfangen. Doch ein Debütant in der Welt der Halbleiterbauelemente – der Memristor – könnte die Wissenschaftler diesem Fernziel ein Stückchen näher bringen, denn gegenüber Spannungsimpulsen verhält er sich ähnlich wie eine Synapse gegenüber Nervenimpulsen.
So ist er auf grundlegender Ebene lernfähig: Legt man eine Spannung an ihn an, ändert sich sein Widerstand und damit auch der Strom, der hindurch fließt. Je nach Richtung der Spannung wird der Widerstand größer oder kleiner und die Änderung bleibt erhalten, auch wenn die Spannung nicht mehr anliegt. Und nun haben Bielefelder Physiker sogar ein Bauteil entwickelt [2], das sowohl Synapse als auch Nervenzelle sein könnte. Hält es, was es verspricht, könnte die Erfindung den Bau gehirnähnlicher Computerchips von Grund auf verändern.
Doch warum möchte man überhaupt das Gehirn durch Halbleiterbauelemente nachbilden? Was Rechenleistung und Genauigkeit betrifft, kann unser Gehirn einen konventionellen Computer kaum übertrumpfen, doch in Sachen Parallelverarbeitung und Fehlertoleranz ist es weit überlegen – und verbraucht dabei gerade mal so viel Leistung wie eine Glühbirne.
Der Unterschied liegt in der Arbeitsweise: Während herkömmliche Rechner strikt zwischen Datenspeicher und Prozessor trennen und brav einen Befehl nach dem anderen abarbeiten [3], liegt unser Wissen in genau denselben Synapsen und Neuronen verborgen, die auch für die Reizverarbeitung und das Lernen zuständig sind. Fallen einzelne Neuronen aus, hat das keine gravierenden Folgen, denn die parallele Verschaltung hält Ersatz parat. Kein Wunder also, dass weltweit zahlreiche Forscherteams an Chips arbeiten, mit denen sie die Struktur und Arbeitsweise des Gehirns in Form von Computerhardware kopieren. Die "neuromorphen Chips" sind nicht nur ideale Kandidaten für die Bild- und Mustererkennung, sondern könnten auch helfen, ihr biologisches Vorbild besser zu verstehen.
Neuromorphe Chips bilden das Gehirn nach
Im BrainScaleS-Projekt etwa haben sich europäische Forscher zusammengefunden, um einen kleinen Teil des Gehirns nachzubilden, indem sie sehr viele Siliziumchips miteinander verdrahten. Federführend ist das Heidelberger Kirchhoff-Institut, wo der erste Prototyp kürzlich in Betrieb genommen wurde: ein 20 Zentimeter großer Wafer, bestückt mit 51 Millionen künstlichen Synapsen, wie der Leiter der Heidelberger Forschungsgruppe Johannes Schemmel stolz erzählt. Der Aufbau repräsentiere zwar nur etwa ein Millionstel eines menschlichen Gehirns, rechne aber um den Faktor 10 000 schneller, so Schemmel. An diesem Modell können die Forscher die Verarbeitung von Nervensignalen im Zeitraffer untersuchen. Lernprozesse, die in einer biologischen Probe mehrere Stunden in Anspruch nehmen, lassen sich so innerhalb einer Minute simulieren und vermessen.
Das erfordert einen riesigen Aufwand: Die klassische Digitaltechnik lässt sich einfach nicht besonders gut mit der analogen Arbeitsweise des Gehirns vereinbaren. Während bei Neuronen das Erregungsniveau beispielsweise kontinuierlich ansteigen kann und Synapsen die ausgeschüttete Menge von Botenstoffen fein abgestuft kontrollieren, kennt der Transistor, das grundlegende Schaltelement heutiger Prozessoren, nur "an" oder "aus". Hundert Transistoren müssten daher verschaltet werden, um eine einzige Synapse zu repräsentieren, wie Schemmel erklärt. Dabei wird eine Fläche von 10 mal 15 Mikrometern verbraucht. Ein künstliches Neuron müssen die Forscher sogar aus noch mehr Bauelementen zusammensetzen.
Memristoren als kompakte Modelle von Neuronen
Die Verwendung von Memristoren könnte diesen Aufwand deutlich verringern. Denn in diesem Bauteil kann der Widerstand kontinuierlich verändert werden – genau wie im biologischen System ist er in Abhängigkeit von der "Nervenzellaktivität" von außen steuerbar. Sein Platzbedarf ist winzig im Vergleich zu dem der Transistoren, und sein Zustand bleibt auch ohne äußere Stromversorgung erhalten. Aber Schemmel betont:"Diese Komponenten sind noch lange nicht reif für den Einsatz in solch großen Systemen wie dem BrainScaleS-Projekt." Dazu müssten sie reproduzierbar gefertigt und vor allem flexibel von außen angesteuert werden können.
Eine neuartige Variante eines Memristors, die nicht nur als Synapse, sondern zusätzlich als Neuron fungieren kann, haben kürzlich Wissenschaftler der Universität Bielefeld entdeckt. "Wir forschten eigentlich an der Verwendung von so genannten magnetischen Tunnelkontakten zum Aufbau von Computerspeichern", schildert Andy Thomas die überraschende Entdeckung seiner Arbeitsgruppe. Bei dem Tunnelkontakt handelt es sich um zwei magnetische Elektroden, die wie ein Sandwich eine nanometerdicke Isolierschicht aus Magnesiumoxid umschließen. Einem Mitarbeiter fiel auf, dass die Strom-Spannungs-Kurve des Elements einen Verlauf zeigte, der dem eines Memristors entsprach. "Wir sind eigentlich aus Zufall darauf gestoßen."
In seinem Aufbau ähnelt das Bielefelder Modell sehr dem Urtyp eines Memristors von 2007, der aus zwei Platinelektroden mit einer dünnen Doppelschicht aus Titandioxid besteht. Eine Hälfte der Schicht enthält Sauerstofffehlstellen und ist dadurch leitfähig, während die andere Hälfte als Isolator wirkt. Legt man eine Spannung an die Elektroden an, driften diese Fehlstellen zum negativen Pol, so dass sich die Dicke der isolierenden Schicht verringert und damit der Widerstand des gesamten Elements. Auch wenn keine Spannung mehr anliegt, erinnert sich das Bauteil an seinen vorherigen Zustand, deshalb der Name: "memory-resistor". Die früher angelegte Spannung kann an der Höhe des aktuellen Widerstands abgelesen werden. Während hier der Memristoreffekt durch zwei unterschiedliche Dotierungen zustande kommt, führt bei den Bielefeldern der Herstellungsprozess der Isolierschicht dazu, dass die Konzentration der Sauerstofffehlstellen quer zur Schicht variiert.
"Wir hielten uns auf dem Laufenden, was Memristoren betraf. In der Literatur wurde erwähnt, dass solche Komponenten ein synapsenähnliches Verhalten zeigen", erzählt Thomas. Typisch für Synapsen ist, dass sie umso besser die nachgeschaltete Nervenzelle erregen, je mehr Nervenimpulse über sie laufen. Dafür sorgen biochemische Prozesse an den prä- und postsynaptischen Enden der angrenzenden Neuronen und darauf beruht auch zum Teil die Lernfähigkeit von Nervensystemen.
Memristoren können "lernen"
Den Bielefelder Forschern gelang es, genau diesen Effekt bei ihrem magnetischen Tunnelkontakt nachzuweisen. Wenn sie wiederholt Spannungsimpulse durch den Memristor schickten, änderte sich dessen Widerstand. Anders gesagt: Würden sie ihn zwischen zwei Kunstneuronen schalten, hätten sie das Grundprinzip des neuronalen Lernens kopiert – je mehr und je häufiger die Neurone miteinander interagieren, desto fester würde die Verbindung zwischen ihnen.
Damit kommen die Wissenschaftler zwar dem natürlichen Vorbild schon recht nahe, doch in Wirklichkeit sind die Vorgänge dort noch um einiges komplizierter. Im Nervensystem spielt es eine große Rolle, dass nur solche Impulsfolgen die Synapse verändern, bei denen zuerst die prä- und dann die postsynaptische Erregung stattfindet und das auch noch sehr kurz hintereinander. Überraschenderweise entdeckten die Bielefelder Forscher auch dieses Verhalten an ihrer künstlichen Synapse, als sie zeitversetzt Spannungsimpulse an der unteren (präsynaptischen) und der oberen (postsynaptischen) Elektrode anlegten. Nur bis zu einem bestimmten zeitlichen Abstand änderte sich der Widerstand des Tunnelkontakts und signalisierte so einen Lerneffekt – genau wie beim biologischen Vorbild.
Allerdings fällt die Widerstandsänderung noch sehr mager aus: Um maximal fünf Prozent unterscheidet er sich vor und nach dem Lernvorgang. Das erscheint den Forschern noch als das größte Hindernis beim Einsatz des Bauteils in neuromorphen Aufbauten. "Allerdings wurde es auch nicht für diese Verwendung optimiert", so Thomas, "denn unser Ziel war sein Gebrauch als magnetischer Speicher". Insbesondere beim Herstellungsprozess biete sich noch Spielraum zur Optimierung der memristiven Funktion.
Memristoren feuern wie Neuronen
Aber mit dem Memristor der Bielefelder Forscher könnte sich sogar noch mehr anfangen lassen als nur synaptisches Lernen. Ab einer bestimmten Stromstärke nämlich beginnt er wie ein Neuron zu feuern. Verantwortlich dafür ist ein noch nicht in allen Details verstandener quantenmechanischer Effekt, der durch die magnetischen Elektroden auf den Stromfluss ausgelöst wird. Klassisch gesehen dürfte durch die Isolierschicht gar kein Strom fließen, der so genannte Tunneleffekt sorgt jedoch dafür, dass Elektronen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die Isolierschicht durchqueren können. Da die Elektronen auf Grund ihres Eigendrehimpulses (Spin) ein magnetisches Moment haben, hängt die Tunnelwahrscheinlichkeit von der Polung der magnetischen Elektroden ab. Sie ist höher, wenn die Elektroden gleichsinnig gepolt sind, der resultierende Tunnelstrom wird stärker.
Fließt allerdings ein sehr starker Strom, dann klappt der Gesamtspin der sich bewegenden Elektronen die Polung einer magnetischen Elektrode um. Damit erhöht sich der Widerstand schlagartig, so dass der Strom fast zum Erliegen kommt. Hier kommt ein bisher nicht völlig geklärter Effekt ins Spiel, das so genannte "back-hopping". Die Polung der Elektrode klappt nämlich spontan wieder um, der Widerstand fällt auf den niedrigen Wert zurück und der Prozess beginnt von Neuem. Genau wie ein feuerndes Neuron gibt die Komponente also spontan Stromimpulse ab, deren Form den natürlichen Neuronenpulsen zudem ähnelt, betonen die Forscher.
Dieses einfache und winzige Bauteil könnte demnach auf Grund seiner Vielseitigkeit universell in künstlichen Nervensystemen eingesetzt werden – das wäre womöglich der entscheidende Durchbruch bei Bau neuromorpher Chips.
"Unser nächstes Ziel ist der Aufbau eines kleinen Roboters aus acht unserer memristiven Elemente", erklärt Thomas. Seine Arbeitsgruppe arbeitet dazu fachübergreifend mit Hirnforschern und Informatikern zusammen. "Der Roboter soll lernen, Hindernisse zu vermeiden, indem sich sein Memristorennetz allmählich an die Umgebung anpasst." So könnte ein kleiner Schritt des künftigen Bielefelder Roboters ein großer Schritt in Richtung einer neuartigen Computerarchitektur werden.

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben