Krebsmedizin: Waffen gegen den gestreuten Tumor
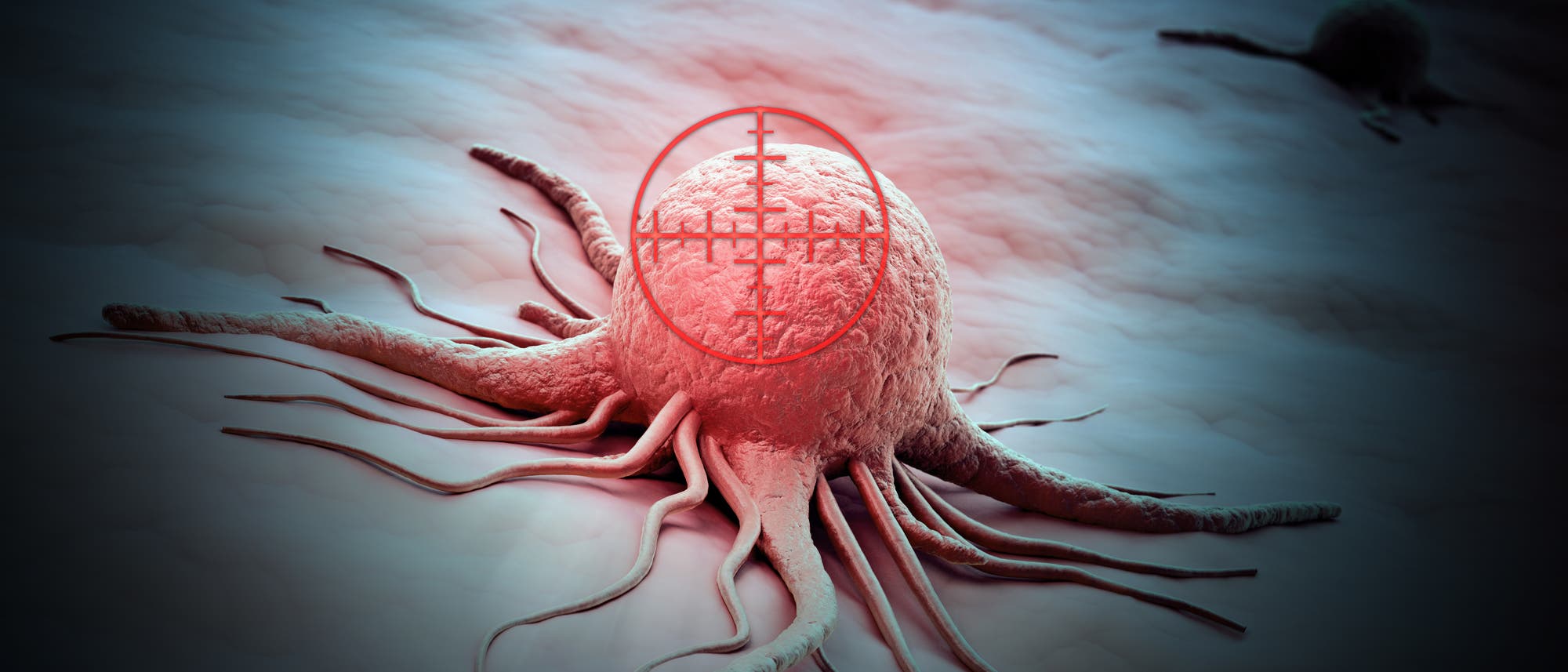
Wer an Krebs erkrankt, für den bricht die Welt zusammen. Sie tut es erneut, wenn der Tumor gestreut hat. In vielen Fällen gilt der Krebs nun als unheilbar, Mediziner streben nur mehr die so genannte Lebenszeitverlängerung des Erkrankten an. "90 Prozent aller Krebspatienten sterben nicht am Primärtumor, sondern an den Metastasen", fasst Lukas Kenner zusammen, Leiter des Instituts für Labortierpathologie der Medizinischen Universität Wien. Die Behandlung von Metastasen ist ungleich schwieriger: Sie sind oft klein und liegen weit verstreut in verschiedenen Organen. Ärzte können sie in vielen Fällen weder herausoperieren noch bestrahlen, sondern setzen Chemotherapien ein, die mal mehr, mal weniger gut wirken.
Doch seit einigen Jahren findet ein Wandel statt: weg von den eher unspezifisch wirkenden Chemotherapien hin zur gezielt eingreifenden Behandlung mit maßgeschneiderten Spezialmolekülen. Doch wie ausgereift sind diese Therapien? Und helfen sie auch gegen Metastasen?
Vom Primärtumor zur Metastase
Hat ein Tumor gestreut, ist auf zellulärer Ebene viel passiert: Eine Krebszelle löst sich vom Tumor ab, gelangt in die Blutbahn, durchbricht die Gefäßwand, dringt in ein neues Organ ein und bildet eine Metastase (griechisch für Übersiedlung) samt eigener Blutversorgung. Der hochkomplexe Vorgang widerspricht gleich mehreren biologischen Regeln: Normalerweise bleiben Zellen an ihrem Platz – eine Nervenzelle im Gehirn, eine Leberzelle in der Leber –, und normalerweise dringen Zellen auch nicht in andere Organe ein und wachsen dort unkontrolliert. "Letztlich wissen wir noch erschreckend wenig über den Vorgang der Metastasierung", sagt Hellmut Augustin vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, der die Rolle der Gefäßneubildung bei Tumoren erforscht.
"90 Prozent aller Krebspatienten sterben an Metastasen"Lukas Kenner
Doch um in die komplizierten Krebsmechanismen gezielt einzugreifen, muss man diese genau verstehen. Momentan ist das nur bei wenigen Krebsarten gelungen, etwa dem malignen Melanom. "Der schwarze Hautkrebs hat sich zum Vorzeigebeispiel der Immuntherapie entwickelt", sagt Armin Gerger, Klinischer Onkologe an der Medizinischen Universität Graz.
Ziel solcher Immuntherapien, die schon für viele Schlagzeilen gesorgt haben, ist, das körpereigene Abwehrsystem wieder in die Lage zu versetzten, Krebszellen anzugreifen – auch versprengte Metastasen. Theoretisch kann es Krebszellen auf Grund ihrer veränderten Oberfläche erkennen und ausschalten. Doch Tumorzellen sind gewiefte Gegner: Sie tarnen sich oder legen das Abwehrsystem lahm.
Beim schwarzen Hautkrebs etwa manipulieren Krebszellen die so genannten Checkpoints, Kontrollpunkte des Immunsystems, die die Immunantwort regulieren. Checkpoints kommen überall im Körper vor, um eine Abwehrreaktion gegebenenfalls zu hemmen – das Immunsystem tariert sich selbst sorgfältig aus, um zu vermeiden, dass körpereigene Zellen angegriffen werden. Beim schwarzen Hautkrebs greifen bestimmte Oberflächenmoleküle der Krebsmoleküle in diesen Signalweg ein und fahren die gegen sie gerichtete Abwehr herunter.
"Die neuen Immuntherapien blockieren diese Bremse, und das Immunsystem kann die Tumorzellen wieder attackieren", sagt Roger Stupp, Klinikdirektor und Leiter des Tumorzentrums am Universitätsspital Zürich. Ipilimumab etwa, ein Checkpoint-Inhibitor, der 2011 für die Behandlung von Hautkrebs zugelassen wurde, ist ein Antikörper, der das hemmende Signal aufhebt, wodurch es zu einer erneuten Aktivierung der Immunantwort kommt. Erst kürzlich wurden weitere Präparate zugelassen. "Erstmals kann Patienten mit vormals nicht heilbarem Hautkrebs die Perspektive eines Langzeitüberlebens geboten werden", sagt Gerger.
Und auch bei gewissen Lungenkrebsarten ist die Immuntherapie heute etabliert: "Erste positive Resultate gibt es beim Lymphdrüsen- und beim Eierstockkrebs. Für praktisch alle Krebsarten laufen zurzeit klinische Studien", sagt Stupp, der mit einer breiten Anwendung der Immuntherapien auch bei anderen Krebsarten in den nächsten Jahren rechnet.
"Eine Perspektive für Patienten mit vormals nicht heilbarem Hautkrebs"Armin Gerger
Der Nuklearmediziner Uwe Haberkorn von der Universitätsklinik Heidelberg verfolgt einen ganz anderen Ansatz: "Bei der Endoradiotherapie wird der Tumor, bildlich gesprochen, von innen bestrahlt", sagt Haberkorn. Dazu benötigen die Forscher zunächst eine bestimmte Erkennungsstruktur auf der Tumoroberfläche, dann das passende Gegenstück dazu, an das sie den radioaktiven Strahler knüpfen. Das radioaktiv markierte Molekül, ein Antikörper oder Peptid, bindet gezielt an die Tumorzelle und zerstört sie.
Zum Einsatz kommen Beta- oder Alphastrahlung. In vielen Fällen kann schon im Vorhinein geklärt werden, ob der Patient für die Therapie in Frage kommt: Die Mediziner markieren den Liganden mit einem diagnostisch nutzbaren Strahler, der sichtbar gemacht werden kann. "Reichert sich das diagnostische Radiopharmakon in den Metastasen an, ist der Patient ein Kandidat für die Therapie; reichert es sich nicht an, ist die Endoradiotherapie nicht sinnvoll. Wir sehen also vorher, was wir therapieren", erklärt Haberkorn. Außerdem können die Mediziner je nach Größe der Metastasen unterschiedliche Strahler einsetzen: Yttrium-90 strahlt über einen Bereich von bis zu elf Millimetern, Bi213 über einen Bereich von nur 50 Mikrometern.
Beispiele für zugelassene Substanzen sind Zevalin bei Lymphomen und DOTATOC bei neuroendokrinen Tumoren. Außerdem wurde in Heidelberg der Wirkstoff PSMA-617 entwickelt, der spezifisch an Prostatakrebszellen andocken kann. Die ersten klinischen Anwendungen verliefen Erfolg versprechend.
Im Prinzip kann die Endoradiotherapie bei allen Tumoren verwendet werden. Die Schwierigkeit liegt darin, Oberflächenstrukturen zu entdecken, die mehrheitlich und in großen Mengen auf den entsprechenden Tumorzellen vorkommen – und dann die dazu wie ein Schlüssel ins Schloss passenden Bindungspartner zu finden. "Zielgerichtete Therapien verlangen nach zielgerichteter Diagnostik", sagt Augustin. Gegenwärtig sind etwa 200 verschiedene Krebserkrankungen bekannt, die sich in ihrer Biologie, in den Behandlungsmöglichkeiten und auch in ihrer Neigung, Metastasen zu bilden, unterscheiden. Zwar kann man heute einen Tumor genetisch entziffern – doch beim nächsten Schritt hapert es: "Lungentumoren weisen bis zu 10 000 Erbgutveränderungen auf. Aber was bedeutet welche Mutation? Wir können die Spreu vom Weizen noch nicht wirklich trennen", sagt Augustin.
Dabei gelten tumorspezifische Mutationen als ideales Ziel für die Entwicklung von Krebsmedikamenten, denn sie kommen in gesunden Zellen nicht vor. Eine systematische Erforschung hat sich aber als schwierig herausgestellt: Jeder Tumor unterscheidet sich genetisch, das heißt, jeder Patient weist unterschiedliche tumorspezifische Mutationen auf. Ugur Sahin, der neben dem Start-up-Unternehmen BioNTech auch die Abteilung Translational Oncology (TRON) an der Universität Mainz leitet, hat mit seinem Team einen Weg gefunden, immunrelevante Mutationen zu identifizieren: Durch das Sequenzieren aller proteinkodierenden Sequenzen, das Exom, und anschließende bioinformatische Priorisierung bestimmter Varianten.
Individuelle Impfstoffe für jeden Einzelnen
Erfüllen die Mutationen bestimmte Kriterien, so verwenden die Forscher deren Sequenz als Schablone für einen Ribonukleinsäure-Impfstoff. Diese mRNA wird in ein Protein übersetzt, das eine verstärkte, tumorspezifische Immunantwort auslösen soll, die sich ausschließlich gegen den Tumor richtet. "Da jeder Krebs in jedem Patienten genetisch anders ist, müssen wir für jeden Patienten einen auf ihn zugeschnittenen Impfstoff entwickeln", sagt Ugur Sahin.
Hierbei verwenden die Forscher nicht nur die genetische Information einer einzelnen Mutation, sondern legen dem Impfstoff mehrere Mutationen zu Grunde, so dass der Tumor an mehreren Stellen gleichzeitig angegriffen wird. Im Tiermodell war die Methode erfolgreich. Eine klinische Studie an Hautkrebspatienten läuft seit 2014.
Momentan existieren solche Therapien nur für einige Krebsarten. Deswegen greifen Onkologen auf Chemotherapien zurück und kämpfen mit einem grundsätzlichen Problem: "Krebszellen passen sich kontinuierlich an, um zu überleben. Das heißt, mit jeder Therapie, die das Ziel hat, Krebszellen zu töten, züchtet man sich auch resistente Krebszellen heran", erklärt Kenner. Ein Krebspatient muss sich also alle zwei bis drei Monate radiomorphologisch untersuchen oder Gewebe entnehmen lassen, um zu prüfen, ob der Tumor geschrumpft ist, gewachsen ist oder ob er gestreut hat. Die Therapie muss dann entsprechend angepasst werden.
Auch hier könnte es zukünftig Erleichterung geben: "Bei der 'liquid biopsy' reicht eine Blutabnahme aus, um die Tumormerkmale zu untersuchen", sagt Gerger. Denn im Blut finden sich Erbgutbruchstücke des Tumors, die ihn charakterisieren. Ob die Untersuchungen genau genug sind und für den Klinikalltag taugen, wird gerade für viele verschiedene Krebsarten in Studien überprüft. Möglicherweise lösen die neuen Therapien zu Recht eine Art Goldgräberstimmung aus. Allerdings verursachen auch sie Nebenwirkungen und schlagen lange nicht bei allen Patienten an. Zudem warnen manche Experten vor einer Kostenexplosion, denn die Behandlungen sind aufwändig und teuer. Somit bleiben Operation, Chemotherapie und Bestrahlung vorerst wichtige Waffen im Kampf gegen Krebs. "Wir stehen erst am Anfang einer ganz neuen Entwicklung", sagt Stupp. "Die Kombination verschiedener Therapien – neuen und alten – ist der Weg der Zukunft. Krebs wird so immer öfter zu einer chronischen Krankheit."
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben