Mäders Moralfragen: Der Wert der Grundlagenforschung
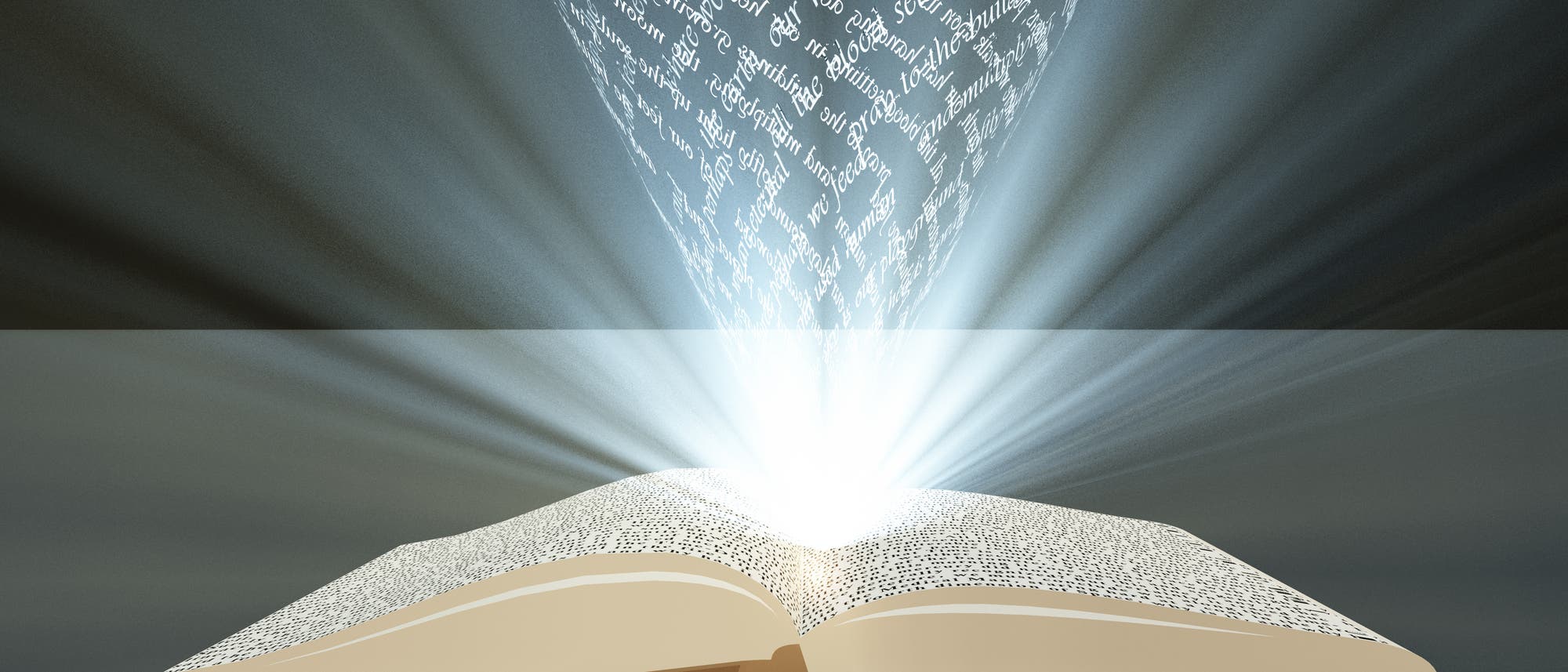
Wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Arbeit machen, dann wollen sie etwas über die Welt lernen. Im Idealfall wollen sie verstehen, wie sich Elementarteilchen und Moleküle, Tiere und Kulturen entwickeln. Eine spannende Aufgabe, da werden die »Spektrum«-Leserinnen und -Leser sicher zustimmen. Doch reicht das als Begründung, um die wissenschaftliche Arbeit mit Milliarden zu fördern? Oder andersherum gefragt: Was darf man von der Wissenschaft für das Geld erwarten? Nur theoretische Einsichten wie etwa zur Entstehung von Gravitationswellen oder auch handfeste Vorteile, die zu einem besseren Leben führen?
Die Wissenschaft ist zwar kein Händler, bei dem man Erkenntnisse oder praktische Anwendungen bestellen könnte. Sie ist laut Grundgesetz frei, und es liegt in der Natur der Sache, dass nicht jedes Projekt zum Erfolg führt. Wüsste man vorher, was herauskommt, müsste man nicht mehr forschen. Aber die öffentlichen Ausgaben rufen dennoch nach einer Rechtfertigung, und um die soll es in diesem Beitrag gehen. Ich werde dafür argumentieren, dass sich diese Fragen nicht innerhalb der Wissenschaft klären lassen: Die Investitionen sollten demokratisch begründet werden.
Für einen großen Teil des Geldes ist die Begründung klar, denn es stammt aus Unternehmen: Sie haben 2016 in Deutschland rund zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in Forschung und Entwicklung investiert, Bund und Länder zusammen etwas mehr als 0,9 Prozent. Diese Zahlen erhebt der Stifterverband jedes Jahr. Die EU möchte noch mehr: In ihrer Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 und der aktuellen Strategie »Europa 2020« fordert sie, dass jedes Land mindestens drei Prozent seines Bruttoinlandprodukts für Forschung und Entwicklung ausgibt. Warum? Wegen der Wettbewerbsfähigkeit und den Arbeitsplätzen, heißt es zur Begründung.
Das Wohl der Menschen
Doch was ist mit dem Teil der Wissenschaft, der keine wirtschaftlichen Vorteile versprechen kann: der Grundlagenforschung? Das habe ich die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gefragt, und sie hat mir mit einem kurzen Statement geantwortet. Darin hebt sie zunächst hervor, welche Bedeutung sie dieser Art von Wissenschaft beimisst: »Um unser Leben, die Welt und das Universum noch besser zu verstehen, ist weitere Grundlagenforschung notwendig.« Und sie bekennt sich dazu, die Grundlagenforschung auszubauen – »und den Forschenden die notwendige Freiheit dafür zu geben«. Doch damit ist es nicht getan.
Anja Karliczek schreibt auch, dass die Grundlagenforschung »die Basis überraschender Ideen für Innovationen und damit entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes« sei. Mit anderen Worten: Obwohl die Grundlagenforschung keine praktischen Anwendungen versprechen kann, so gibt es diese – zum Glück – eben doch. Und der Ministerin ist wichtig, »dass die Erkenntnisse der Grundlagenforschung in der Gesellschaft ankommen und zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden«. Damit setzt sie die Wissenschaft unter Druck: Sie muss mehr liefern als nur ein besseres Verständnis unseres Lebens, der Welt und des Universums – zwar nicht in jedem Projekt und auch nicht sofort, aber insgesamt irgendwann schon.
Diese Haltung dürfte manchem Freund der Wissenschaft nicht gefallen, doch sie liegt ganz im Trend der Zeit. Der Philosoph Martin Carrier, bei dem ich vor 15 Jahren promoviert habe, schreibt in seinem Buch »Wissenschaftstheorie zur Einführung«, dass die angewandte Wissenschaft heute Vorrang genieße vor der Grundlagenforschung: »Nicht die Erkenntnis der Naturzusammenhänge steht im Vordergrund, sondern deren Kontrolle.« Dieses Fazit ist nicht neu: Carriers Buch ist schon zwölf Jahre alt. Und die einflussreiche These, die Wissenschaft sei in einen neuen Modus übergegangen (der auf Englisch als »mode 2« bezeichnet wird), stammt sogar aus den 1980er Jahren. Damals beobachtete unter anderem die Soziologin Helga Nowotny, dass es in der Wissenschaft mehr nationale und internationale Kooperationen gab, auch über Fachgrenzen hinweg. Die Teams konzentrierten sich auf konkrete Fragestellungen, die gesellschaftlich relevant sind – und die Gruppen erhielten nicht zuletzt gerade deswegen Fördermittel.
Der Spielraum der Forscher
Der Trend hält also schon einige Zeit an, und es scheint gut zu laufen. Die Nobelpreise der vergangenen Jahre zeigen, dass Menschen durchaus von den Erkenntnissen der Grundlagenforschung profitieren: Peter Grünberg und sein Kollege Albert Fert ermöglichten eine neue Generation von Festplatten mit höherer Kapazität, Harald zur Hausen entwickelte die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Es gab Auszeichnungen für blaue Leuchtdioden, für besonders hochauflösende STED-Mikroskopie und für die Umwandlung von normalen Zellen zu Stammzellen. Schon bald wird sicher die Einführung der Genschere CRISPR in die Gentechnik mit dem Medizinnobelpreis bedacht werden. Kein Wunder, dass viele denken, so werde das immer weiterlaufen. Aber darf man sich darauf verlassen, darf man es sogar von der Wissenschaft erwarten?
In dieser Frage steckt eine Menge, die muss man aufdröseln. Zunächst einmal zur Hoffnung, dass es immer so weitergeht: Nein, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Wissenschaft auch einmal ein Tal durchläuft und lange Zeit nichts Verwertbares liefert. In den 1970er Jahren startete die US-Regierung, beflügelt vom Erfolg der Mondlandung, zum Beispiel mit viel Geld einen »War on Cancer«, einen Krieg dem Krebs. Doch das Ergebnis war ernüchternd, denn die Krankheit stellte sich als schwieriger Gegner heraus. Wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Arbeit machen, dann können sie nicht einfach im Buch der Natur nachlesen, wie die Dinge stehen. Trotzdem muss man festhalten, dass sie am besten wissen, welche Wege man als Nächstes ausprobieren sollte. Daher ist es sinnvoll, ihnen große Freiheiten zu lassen. Wer sie zu sehr einengt, schränkt auch die Chancen auf nützliche Erkenntnisse ein.
Doch erwarten darf man von der Wissenschaft trotzdem etwas: dass sie ihre Forschungsagenda an den Bedürfnissen der Gesellschaft ausrichtet. Es gibt so viele Dinge, die man erforschen könnte, dass sich die Wissenschaft ruhig an dem orientieren sollte, was auch die Laien interessieren könnte. Und das muss nicht unbedingt etwas von praktischem Nutzen sein. Die Gesellschaft darf die Wissenschaft auch bitten, anderen Fragen nachzugehen. Dieses Argument hat der US-amerikanische Philosoph Philip Kitcher stark gemacht, zum Beispiel in seinem Buch »Science in a Democratic Society« aus dem Jahr 2011. Dort argumentiert er, dass sich Forscherinnen und Forscher laufend fragen müssen, welchen Fragen sie sich als Nächstes widmen sollten. Die Antworten gebe ihnen die Natur nicht vor, schreibt Kitcher, es gebe keine objektive Agenda der Wissenschaft. Vielmehr dürfe die Gesellschaft mitreden und das Forschungsinteresse der Wissenschaft auf ihre drängendsten Probleme lenken – oder auch auf Themen wie die Gravitationswellen, die ihre Neugier befriedigen.
Hier schließt sich für Philip Kitcher die Diskussion an, die wir eigentlich führen sollten: Wie wägt man bei der Themenwahl für die Forschungsagenda zwischen Neugier und Fürsorge ab? Eine Milliarde für einen neuen Teilchenbeschleuniger, oder wäre das Geld zur Bekämpfung der Armut besser angelegt? Die Diskussion darüber, wie wir solche Fragen entscheiden wollen, läuft bereits, und die Stichworte lauten: »Public Understanding of Science«, »Citizen Science« und »Responsible Research and Innovation«. Auch der March for Science, über den ich in dieser Kolumne geschrieben habe, gehört dazu. Die Entscheidungen sind nicht leicht zu treffen. »Wenn wir die Idee ernst nehmen, dass die Wissenschaft zum menschlichen Wohl existiert«, schreibt Kitcher, »dann sehen wir, dass es nötig ist, die Interessen ganz unterschiedlicher Gruppen auszugleichen.«
Die Moral von der Geschichte: Wenn Menschen von der Wissenschaft profitieren sollen, muss man sicherstellen, dass alle etwas davon haben – unabhängig davon, ob es um Geld, Gesundheit oder eine Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest geht.
Schreiben Sie uns!
11 Beiträge anzeigen