Blickkontakt: Die Augen sagen mehr als tausend Worte
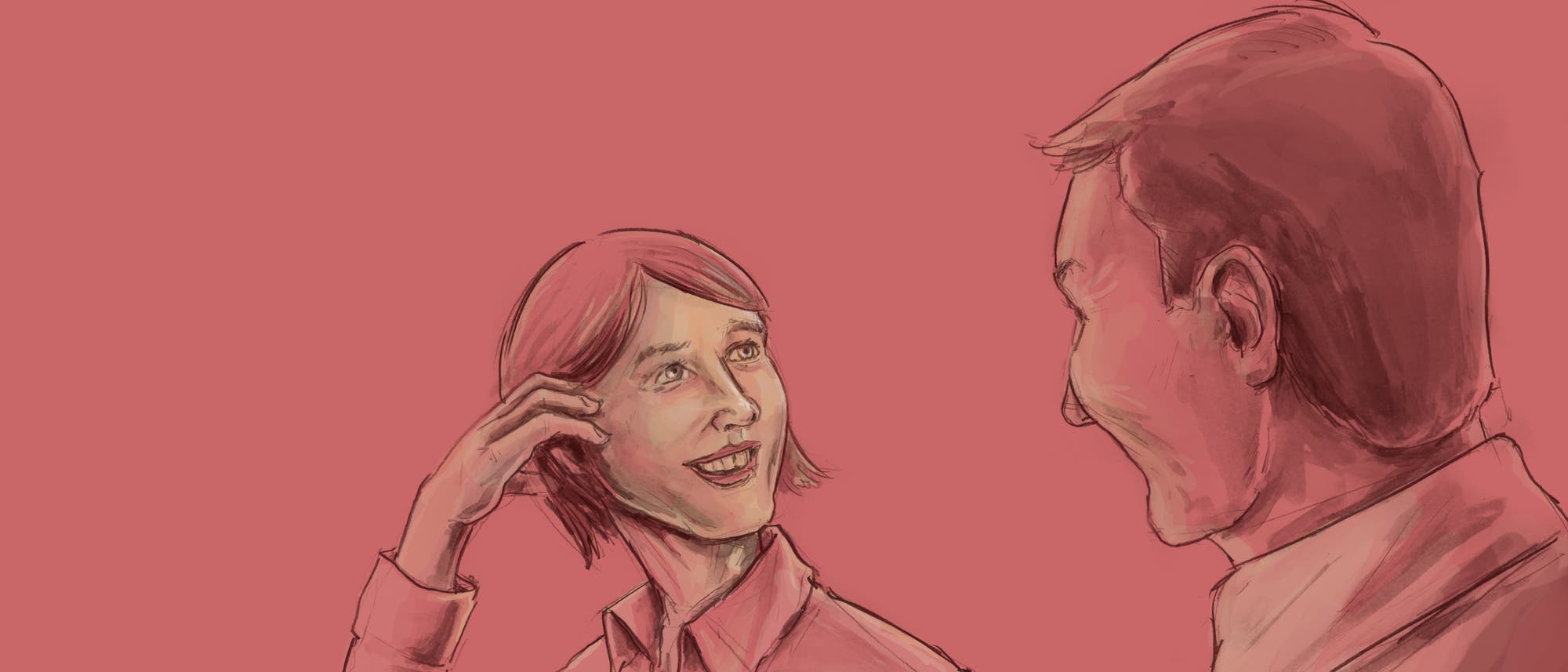
Ein Tag im Frühling 2010. Die Künstlerin Marina Abramović hat ins New Yorker Museum of Modern Art zu einer Performance-Show eingeladen. In der Mitte des Raums steht ein einfacher Tisch mit zwei Holzstühlen. Auf dem einen sitzt die schweigende Künstlerin und hält zu jedem Besucher, der ihr gegenüber Platz nimmt, eine Minute lang Blickkontakt. Unbewegt schaut sie einen nach dem anderen an. Doch als sie schließlich in die Augen eines grauhaarigen Mannes blickt, kommen ihr die Tränen. Der Mann heißt Frank Uwe Laysiepen, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ulay. Er und Abramović waren von 1975 bis 1988 privat und beruflich ein Paar. Sie hatten sich 22 Jahre lang nicht gesehen.
Der lange Blickkontakt rührte auch einige Besucher zu Tränen. Intensive Blicke wecken Gefühle, positiv oder negativ. Im Mittel schauen Menschen einander für gut drei Sekunden in die Augen. Das fanden Forscherinnen und Forscher vom University College London heraus, als sie das Blickverhalten von rund 500 Personen aus 56 Nationen beobachteten. Andere Studien kommen zu dem Schluss, dass bis zu fünf Sekunden noch als angenehm empfunden werden. Längere Blicke können bohrend und bedrohlich wirken. Umgekehrt gilt: Meiden andere unseren Blick, fühlen wir uns ausgeschlossen und abgewertet.
Schon Babys nehmen mit den Augen Kontakt auf
Das Wechselspiel der Blicke aktiviert automatisch bestimmte neuronale Netzwerke in einem Bereich, wo Scheitel- und Schläfenlappen zusammentreffen, berichtet der Psychiater Leonhard Schilbach, Leiter der Arbeitsgruppe Soziale Neurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Die Neigung, den Blickkontakt zu suchen, ist angeboren. Mit Hilfe von Blicken üben Kleinkinder, sich in andere einzufühlen. »So trainieren sie genau jene Hirnareale, die sie später brauchen, um sich in ihre Mitmenschen hineinzuversetzen«, sagt Schilbach. Mit etwa vier Jahren entwickeln sie die so genannte Theory of Mind: Sie begreifen, dass jeder Mensch eine eigene Sicht auf die Welt hat.
»Blicke sind von Anfang an der wichtigste soziale Reiz«
Leonhard Schilbach, Psychiater
Das menschliche Auge ist ungewöhnlich aufgebaut; im Vergleich zu anderen Tieren ist das Augenweiß stark ausgeprägt. So können Menschen leichter erkennen, wo ihre Artgenossen gerade hinschauen. »Das ist die Basis unserer sozialen Kooperation«, sagt Leonhard Schilbach. Er und sein Team erforschen unter anderem, wann soziale Interaktionen gelingen. »Blicke sind von Anfang an der wichtigste soziale Reiz«, berichtet er.
Sogar der Anblick eines Porträtgemäldes, das den Betrachter scheinbar direkt anschaut, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Augen, die in die Kamera blicken, aktivieren Areale in vielen verschiedenen Hirnregionen, die mit dem Sozialverhalten in Verbindung stehen, wie eine bildgebende Studie zeigte. Ein solcher Blickkontakt über einen Bildschirm verändert selbst die Zeitwahrnehmung. Der Blick währt länger, als es sich anfühlt: Die Zeit scheint für den Betrachter kurz stillzustehen.
Blickkontakt hält überdies ehrlich: Wer seinem Gegenüber in die Augen gesehen hat, sagt daraufhin häufiger die Wahrheit. Eine mögliche Erklärung: Lügen erfordern unter dieser Bedingung mehr geistige Anstrengung.
Themenwoche »Die Signale des Körpers«
Menschen kommunizieren nicht allein mit Worten: Sie senden und empfangen auch viele nonverbale Botschaften. Wie die Signale wirken und was sie tatsächlich bedeuten, schildert diese sechsteilige Serie. Klingt der Charakter eines Menschen in seiner Stimme durch? Offenbart eine Handschrift womöglich mehr, als geschrieben steht? Was passiert beim Blickkontakt? Und welche Rolle spielen verschwitzte T-Shirts in der Liebe? »Spektrum.de« entschlüsselt die Signale des Körpers.
- Körpersprache: Was Gesten verraten
- Blickkontakt: Die Augen sagen mehr als tausend Worte
- Körpergeruch: Es riecht nach Gefahr
- Interozeption: Signale aus dem Körperinneren
- Soziale Wahrnehmung: Wie Stimmen wirken
- Graphologie: Zwischen den Zeichen lesen
Darauf deutet auch ein Experiment der Psychologen Shogo Kajimura und Michio Nomura von der Universität Kyoto hin. Ihre Versuchspersonen sollten gleichzeitig ein Video anschauen und zu einem Substantiv passende Verben generieren, zum Beispiel auf »Liste« mit »schreiben« antworten. Die Probanden waren langsamer, wenn die Person im Video sie dabei zu fixieren schien. Schaute sie an der Kamera vorbei, fiel den Teilnehmern das passende Wort schneller ein. Blickkontakt verschlingt offenbar kognitive Ressourcen, folgerten die Autoren, und das selbst dann, wenn die andere Person nur auf einem Bildschirm zu sehen ist.
Blicke koordinieren den Gesprächsfluss
Das liegt vermutlich daran, dass Blicke eine Signalfunktion haben: Sie dienen im Alltag dazu, das Miteinander aufeinander abzustimmen. So zählt beim Plausch nicht nur das Gesagte; wir werten ständig subtile nonverbale Signale aus. Mit Blicken koordinieren wir beispielsweise den Gesprächsfluss. Wir vergewissern uns, dass der andere noch zuhört, suchen nach Hinweisen, ob er uns zustimmt, und klären frühzeitig ohne Worte, wer wann spricht. Wer mit seinem Gesprächsbeitrag fertig ist, schaut den Gesprächspartner an und signalisiert so: Jetzt bist du dran. Während des Sprechens selbst wandert der Blick häufig im Raum herum. In der Regel hat das weder etwas mit Unhöflichkeit noch mit Schüchternheit zu tun. Es spart mentale Kräfte.
Aus der Art, wie Menschen den Blick schweifen lassen, versuchen Forscher auf deren Charakter zu schließen. Ein Team um den Psychologen John Rauthmann, damals an der Universität Innsbruck, ließ 242 Probanden einen Persönlichkeitsfragebogen zu den fünf großen Dimensionen der Persönlichkeit (»Big Five«) ausfüllen. Anschließend sollten sie am Computer Muster betrachten, die sich bewegten. Dabei verfolgte ein so genannter Eye-Tracker ihre Augenbewegungen.
Augenbewegungen lassen tief blicken
Es zeigte sich: Extravertierte, also gesellige und aktive Menschen, schauten sich mehr im Bild um. Ihr Blick sprang von einer Stelle zur anderen. Neurotischere Zeitgenossen, die zu Ängsten und Grübeleien neigen, verweilten mit den Augen vergleichsweise lange an einer Stelle. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie gründlicher abschätzen wollen, ob ein Objekt eine potenzielle Gefahr darstellt, vermuten die Autoren. Ähnlich war es bei Menschen, die in puncto Offenheit für neue Erfahrungen weit vorne lagen. Hier interpretierten die Forscher den ruhenden Blick allerdings als Bereitschaft, sich tiefer mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Für die zwei anderen großen Persönlichkeitsdimensionen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, fanden sich in dieser Studie keine Zusammenhänge mit dem Blickverhalten.
Allerdings handelte es sich um eine Laborstudie. Wissenschaftler um Sabrina Hoppe von der Abteilung für Maschinenlernen und Robotik an der Universität Stuttgart testeten, ob das Blickverhalten im Alltag weiteren Aufschluss über den Charakter gibt. Dafür statteten sie 50 Studierende mit Eye-Tracker-Brillen aus und ließen sie auf dem Campus Erledigungen machen. Ein entsprechend trainierter Algorithmus war anschließend in der Lage, anhand von Blickbewegungen, Blinzeln und Pupillenweite die Persönlichkeit der Probanden einzuschätzen, diesmal alle Dimensionen außer der Offenheit für neue Erfahrungen.
»Das so gewonnene Wissen über nonverbales Verhalten können wir auch auf Roboter übertragen, so dass diese sich wie Menschen benehmen. Solche Systeme würden dann auf eine viel natürlichere Weise mit Menschen kommunizieren und wären dadurch effizienter und flexibler einsetzbar«, sagt Andreas Bulling vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken, der an der Studie beteiligt war. Insgesamt steht die Forschung auf diesem Gebiet aber noch ganz am Anfang. Ob Menschen solche Feinheiten bei einem Roboter überhaupt wahrnehmen, ist fraglich.
Was jedoch klar ist: Wir können am Blick erkennen, ob uns jemand mag – und welche Absichten er hat. Wer sein Gegenüber attraktiv findet, schaut es länger an als jemand, der nur freundschaftlich interessiert ist. Und: Verliebte fokussieren vermehrt auf Gesicht und Oberkörper der Person, für die sie Gefühle haben.
Blickkontakt mit attraktiven Menschen wirkt belohnend
Ein langer Blick in die Augen ist ein Liebeselixier. »Beim Wechselspiel der Blicke wird das ventrale Striatum aktiviert. Es ist Teil des neuronalen Belohnungssystems, das uns motiviert und Glücksgefühle verschafft«, sagt Leonhard Schilbach. Eine Studie im Fachblatt »Nature« bestätigte das schon vor 20 Jahren. Der Neurologe Knut Kampe vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte damals gemeinsam mit Kollegen nachweisen, dass das Belohnungssystem im Gehirn immer dann reagiert, wenn wir dem Blick eines attraktiven Menschen begegnen. Der Anblick eines schönen Gesichts allein ließ die betreffenden Hirnregionen kalt.
Ende der 1990er Jahre berichtete ein Forschungsteam, dass ein langer Blickkontakt verbunden mit einem persönlichen Gespräch selbst zwischen Fremden schnell ein Gefühl von Nähe erzeugt. Für das Experiment sollten je zwei Studierende, die einander nicht kannten, persönliche Fragen beantworten (»Wann hast du das letzte Mal geweint?«) und einander danach vier Minuten lang schweigend in die Augen sehen. Daraufhin fühlten sie sich einander näher als Paare, die über Belanglosigkeiten gesprochen hatten und keinen minutenlangen Blickkontakt hielten.
Bei Ulay und Marina Abramović führten die langen Blicke im Museum zunächst zu keiner nachhaltigen Annäherung. Die beiden lieferten sich einen erbitterten Rechtsstreit über die Urheberrechte der gemeinsamen Arbeit, bevor sie sich 2017 schließlich versöhnten. Ulay starb 2020. Seinen Blick hat der Künstler in einem Selbstporträt festgehalten.
Schreiben Sie uns!