Depression: Der lange Schatten der Gesellschaft

Jede fünfte Person erkrankt im Lauf ihres Lebens mindestens einmal an einer Depression. Die promovierte Psychotherapeutin Leonie Knebel untersucht, inwieweit gesellschaftliche Bedingungen für Depressionen verantwortlich sind. Faktoren wie Arbeitsbedingungen, sozioökonomischer Status und geschlechtsspezifische Belastungen tragen tatsächlich wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Gleichzeitig ist es nicht immer einfach, Ursache und Wirkung klar zu unterscheiden, denn die Ursachen für Depressionen sind komplex und miteinander verwoben.
Frau Knebel, in Deutschland erkranken – je nachdem, welche Studie man sich anschaut – schätzungsweise 19 Prozent der Menschen im Lauf ihres Lebens einmal an einer Depression. Sie haben in Ihrer Doktorarbeit untersucht, welche Rolle die Gesellschaft dabei spielt. Was ist das Ergebnis?
Es gibt verschiedene gesellschaftliche Faktoren, die zur Entstehung einer Depression beitragen können. Dazu zählen etwa Erfahrungen der Abwertung und Vereinzelung, vermittelt durch Erwerbslosigkeit, prekäre Beschäftigung oder einen niedrigen sozioökonomischen Status, die Zunahme gesellschaftlicher Ungleichheit und die starke Arbeitsverdichtung. Auch Menschen, die schwere Emotionsarbeit machen, also zum Beispiel als Altenpflegerin oder Mitarbeiter eines Callcenters arbeiten, haben ein höheres Risiko, zu erkranken. Das trifft auch auf Frauen im Allgemeinen zu. Sprechen wir über Depressionen, müssen wir außerdem im Blick haben, dass es sich um ein sehr heterogenes Krankheitsbild handelt, das in seiner Erscheinung stark variiert.
Wie drückt sich das aus?
Bei manchen Menschen treten Depressionen episodisch auf, bei anderen verlaufen sie chronisch, bei wieder anderen sind sie Teil einer anderen Erkrankung wie etwa einer Posttraumatischen Belastungsstörung oder einer Psychose. Zentrale Symptome sind Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit und Antriebslosigkeit; Suizidgedanken kommen ebenfalls häufig vor. Nahezu allen Depressionen gemein ist ein geringer Selbstwert: Die Betroffenen haben das Gefühl, weniger wert zu sein als andere. Was wiederum dazu führt, dass sie sich weniger zutrauen und ihre Zukunft recht pessimistisch einschätzen.
Wie kann ein schlechterer Schulabschluss oder ein niedriges Gehalt das Risiko einer Depression erhöhen?
Das ist unterschiedlich. In meiner Studie gab es etwa den Fall einer Frau aus Ostdeutschland. Als Jugendliche war sie die Klassenbeste. Dann fiel die Mauer, sie begann zu studieren und merkte, dass sie nicht mehr mitkam und ihr Schulwissen weniger wert war als das der »Wessis«. Ihre Eltern unterstützten sie finanziell nicht, sie konnte sich keinen Laptop leisten und hielt sich mit Nebenjobs über Wasser. Später blieb sie im Callcenter »hängen«, wie sie es beschrieb. Daraus entstand das Gefühl, schlechter und weniger kompetent zu sein als andere. Dass ihre Bedingungen allerdings auch viel schwieriger waren als die ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen, kam ihr nicht in den Sinn.
Im Callcenter sollen Angestellte zudem in der Regel nicht authentisch sein, sondern stets höflich und zugewandt, selbst wenn sie angeschrien werden. Das kann dazu führen, dass eine Person die eigenen Gefühle schlechter wahrnimmt und das Selbstwertgefühl leidet; eine Dynamik, die das Depressionsrisiko ebenfalls erhöht.
Warum ist Frausein ein Risikofaktor?
Weil Frauen nach wie vor weniger verdienen als Männer, auf Grund ihres Geschlechts häufiger abgewertet werden und immer noch diejenigen sind, die den größten Teil der Care-Arbeit übernehmen, sich also um den Haushalt kümmern, die Erziehung der Kinder im Blick haben und die Pflege von Angehörigen organisieren. Auf ihnen lastet dadurch ein unheimlicher Druck. Viele können diesen Ansprüchen nicht gerecht werden und denken dann, dass sie nicht genug leisten, sich nicht ausreichend anstrengen, dass sie selbst das Problem sind. Einmal in dieser Negativspirale gefangen, entwickeln manche eine Depression. Nicht umsonst haben allein erziehende Mütter ein sehr starkes Armuts- und Depressionsrisiko.
Lassen sich diese Zusammenhänge wissenschaftlich belegen?
Ja. Das Robert Koch-Institut untersucht beispielsweise seit den 1990er Jahren, wie häufig psychische Erkrankungen und Symptome in der Bevölkerung in Deutschland auftreten. Hierfür nutzen die Forschenden Querschnittstudien. Das heißt, sie ziehen aus der Bevölkerung eine zufällige, repräsentative Stichprobe und befragen diese Versuchspersonen dann zu unterschiedlichen Aspekten ihres Lebens: Sind sie erwerbstätig? Haben sie Kinder? Leben sie in einer Partnerschaft? Wie hoch ist das Einkommen? Haben sie in den vergangenen zwölf Monaten Symptome einer Depression oder einer anderen psychischen Erkrankung gezeigt?
Die Angaben werden dann auf Häufungen untersucht, wodurch zum Beispiel sichtbar wird, dass die Prävalenz von depressiven Symptomen bei Frauen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status dreimal so hoch ist wie bei Frauen mit einem hohen sozioökonomischen Status. (Die Prävalenz gibt die Zahl der Krankheitsfälle in der betrachteten Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums an. Sie wird in der Regel in Prozent ausgedrückt. Anm. d. Red.)
Könnte es nicht auch andersherum sein: Ein Mensch entwickelt eine Depression, verliert daraufhin seinen Job und der Partner oder die Partnerin trennt sich von ihm? In diesem Fall wäre die Depression nicht die Folge der schwierigen sozialen Lage, sondern die Ursache.
Ein sozialer Abstieg auf Grund einer Depression ist natürlich ebenso möglich. Insgesamt liegen für die soziale Verursachung allerdings mehr Belege vor als für den sozialen Wechsel. Das wurde in Längsschnittstudien untersucht, bei denen Studienteilnehmende über einen längeren Zeitraum hinweg befragt werden. Eine Verschlechterung der sozioökonomischen Lebensbedingungen führt im Zeitverlauf eher zu einer Depression, als dass eine Depression zum sozialen Abstieg führt. Und dennoch: Daraus zu schlussfolgern, dass unsere Gesellschaft depressiv macht, wäre zu einfach.
Wie meinen Sie das?
Die Gesellschaft liefert die Rahmenbedingungen für die Erfahrungen, die Menschen im Lauf ihres Lebens mit anderen Menschen je nach Position und Lebenslage machen – zum Beispiel abhängig von Klasse, Geschlecht, Migrationshintergrund oder Familien- und Wohnsituation. Zu diesen Lebensbedingungen können wir uns jedoch bewusst verhalten, etwas aus ihnen machen. Warum genau ein Mensch eine Depression entwickelt, ist letztlich sehr individuell. Auch Persönlichkeitseigenschaften und Lebensereignisse spielen eine wichtige Rolle. Welchen Einfluss die Biologie hat, wird ebenfalls intensiv erforscht.
Wie groß ist der Einfluss der gesellschaftlichen Strukturen im Vergleich zu diesen anderen Ursachen?
Das lässt sich schwer beantworten, da die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, sozialen, psychischen und biologischen Faktoren komplex sind. Wenn meine Mutter stirbt, ist das ein schlimmes persönliches Lebensereignis. Wie ich das Erlebte verarbeite, hängt jedoch auch davon ab, ob sie zum Beispiel auf der Flucht ertrunken ist oder ihre Krankheit wegen langer Wartezeiten zu spät erkannt wurde. Weil wir biologische und gesellschaftliche Wesen mit einer persönlichen Geschichte sind, stehen diese Aspekte auch nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander. Das gilt leider nicht für die Verteilung der Forschungsgelder.
Themenwoche »Depression«
Müde, lustlos, niedergeschlagen: Solche Phasen kennt nahezu jeder. Aber ist das schon eine Depression – und wenn ja, was dann? Welche Rolle der Körper dabei spielen kann, wie man die richtige Therapie findet und was sonst noch dabei hilft, aus dem seelischen Tief wieder herauszukommen: Diese und noch mehr Fragen rund um Depressionen beantwortet »Spektrum.de« in den folgenden Beiträgen.
- Diagnose: Bin ich depressiv?
- Ursachen: »Das Problem kann auch körperlich sein«
- Ratgeber: Welche Psychotherapie passt zu mir?
- Ursachen: Der lange Schatten der Gesellschaft
- Ratgeber: Das können Betroffene selbst tun
- Partnerschaft: Zu zweit durch die Krise
- Experimentelle Therapien: Neue Wege aus der chronischen Depression
Sie sind auch Psychotherapeutin. Wie lässt sich dieses Wissen in der Therapie nutzen?
In der Therapie geht es mir darum, eine Verständigung über die biografischen und aktuellen Gründe anzuregen und die Handlungsspielräume der Betroffenen zu erweitern. Der Frau im Callcenter half es beispielsweise, ihre Erfahrungen anders einzuordnen und die Annahmen über sich selbst in Frage zu stellen. Dadurch erkannte sie, dass es nicht nur an ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten lag, dass sie weiter in ihrem Nebenjob arbeitete, sondern auch an ihren Lebensumständen. Am Ende traute sie sich beruflich und privat mehr zu.
Die Soziologin Eva Illouz meint, Psychotherapie trage dazu bei, das Leid von Betroffenen zu individualisieren. Statt den Menschen zu helfen, die Strukturen um sich herum zu ändern, bewirke eine Therapie lediglich, dass die Betroffenen weiter funktionieren – was wiederum dazu führe, dass sich die Gesellschaft nicht ändert. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Den Gedanken habe ich auch manchmal. Ich denke jedoch, dass Therapie oft indirekt hilft. Wenn Menschen lernen, sich durch eine Therapie anzunehmen, und sich dadurch verändern, hat das Auswirkungen: Eine Person kann beispielsweise den Mut finden, sich gegen die Ungerechtigkeit auf der Arbeit zu wehren, was wiederum die Chance erhöht, dass andere diesem Beispiel folgen. Vielleicht gründen sie sogar einen Betriebsrat und setzen sich dafür ein, dass neue Mitarbeitende nicht mehr schlechter bezahlt werden. Das verbessert das Selbstvertrauen, das Betriebsklima und die Solidarität. Der Klientin aus dem Callcenter wurde zum Beispiel betriebsbedingt gekündigt. Der Betriebsrat konnte für sie nur noch eine Abfindung erreichen, aber für ihren nächsten Job handelte sie bessere Arbeitsbedingungen aus.
Die Abwertung, die Frauen und Minderheiten erleben, lässt sich durch eine Therapie dennoch nicht einfach abschalten. Oft bleiben Arbeitsbedingungen und Gehälter vermutlich, wie sie sind. Ist das für Sie als Therapeutin nicht frustrierend?
Als Psychotherapeutin schon. Doch als politisch denkender und handelnder Mensch weiß ich auch, dass eine Therapie nicht der geeignete Rahmen ist, um gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Statt mit Therapie die Welt verändern zu wollen, sollten wir uns politisch und gewerkschaftlich engagieren. Das ist anstrengend, tut uns Psychotherapeutinnen jedoch genauso gut wie unseren Klienten und Klientinnen.
Über das KielSCN
Das Kieler Netzwerk für Wissenschaftskommunikation (KielSCN) entwickelt neue Ansätze für die Kommunikation von wissenschaftlichen Inhalten. Dabei liegt der Fokus auf Visualisierungen von Informationen und deren Wahrnehmung. Was macht hochwertige Visualisierungen in der Wissenschaftskommunikation aus und wie werden diese entwickelt? Wie nehmen unterschiedliche Zielgruppen Visualisierungen wahr und wie können Gestaltungsmerkmale das Erreichen von Zielen in der Wissenschaftskommunikation unterstützen? Was benötigen Forschende, Studierende und Jugendliche, um wissenschaftliche Erkenntnisse auch mit visuellen Mitteln effektiv zu kommunizieren? Diesen Fragen widmet sich das interdisziplinäre KielSCN-Team in verschiedenen Forschungsvorhaben und Projekten.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.kielscn.de
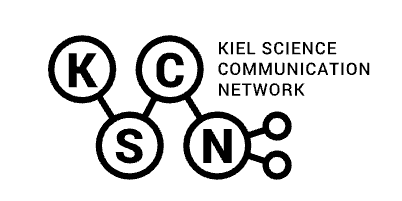
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.