Krebsmedizin: Der gläserne Tumor
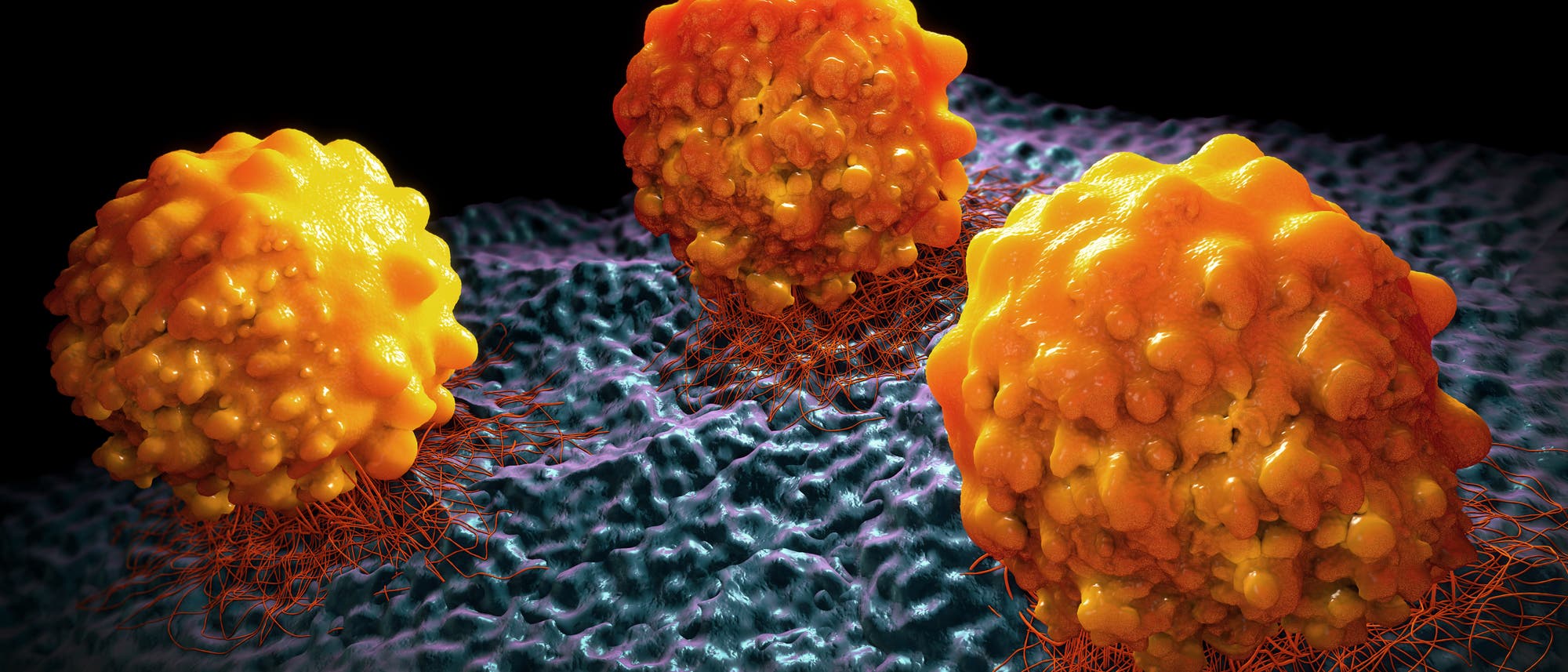
Dank einer immer besseren Technik und weiter fallenden Kosten können Wissenschaftler aus den Buchstaben der DNA so viel Information herauslesen wie noch nie. Das Erkrankungsrisiko für etwa Herzinfarkt oder Diabetes lässt sich bislang aber nur sehr grob einschätzen, so dass der konkrete Nutzen für den einzelnen Patienten schwammig bleibt. In anderen Bereichen der Medizin etabliert sich der Blick ins Erbgut jedoch als zunehmend hilfreich: etwa bei Krebs.
Denn bei den Erbgutanalysen in der Tumormedizin steht nicht das Erkrankungsrisiko im Vordergrund: »Die Sequenzierung von Tumoren dient dazu, die bestmögliche Therapieoption zu finden«, sagt Stefan Fröhling, kommissarischer geschäftsführender Direktor des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg.
Die Ursachen von Krebs liegen immer im Erbgut verborgen. Schäden in der DNA oder Fehler beim Ablesen des DNA-Textes führen dazu, dass die Kommunikation zwischen den Zellen nicht mehr korrekt funktioniert. Vor allem die Zellteilung gerät bei Krebs außer Kontrolle: Während gesunde Zellen sich nur auf Befehl teilen und an ihrem Platz bleiben, vermehren sich Krebszellen unkontrolliert und wachsen manchmal sogar in andere Organe ein. Die genetischen Fehler, die Krebs verursachen, können ererbt sein. Häufiger entstehen sie allerdings im Lauf des Lebens, entweder zufällig bei fehlerhaften Zellteilungen oder durch erbgutschädigende Faktoren wie UV-Licht oder Zigarettenrauch.
Gegenwärtig sind etwa 200 verschiedene Krebserkrankungen bekannt, die sich in ihrer Biologie und den Behandlungsmöglichkeiten unterscheiden. In den vergangenen Jahren gelang es, für viele dieser Krebsarten so genannte Treibermutationen zu identifizieren: Erbgutveränderungen, die für sie spezifisch sind. Vor allem aber wuchs die Erkenntnis, dass jeder Krebs anders ist: So unterscheidet sich nicht nur ein Lungenkrebs mit gut 10 000 Erbgutveränderungen von einem Prostatakrebs mit durchschnittlich 40 Mutationen. Der Lungenkrebs eines Patienten A weist auch andere Mutationen auf als jener des Patienten B. »Selbst innerhalb eines Patienten kann es zu Abweichungen kommen: Metastasen können sich in manchen genetischen Positionen vom Primärtumor unterscheiden«, erklärt der Krebsmediziner Ulrich Lauer von der Universitätsklinik Tübingen.
Jede Krebserkrankung ist also einmalig und durch eine ganz eigene Kombination ihrer Mutationen charakterisiert. Diese Unterschiede im Erbgut können Auswirkungen auf die Behandlung haben: Weist der Lungenkrebs des Patienten A eine Mutation im Gen für EGFR auf, das die Zellteilung beschleunigt, kommt für ihn ein EGFR-Hemmer in Frage. Fehlt die Mutation Patient B, ist die Behandlung mit dem Medikament sinnlos. »Nach einer genetischen Analyse kennt man den Tumor, kennt die Mutationen und kann abschätzen, welche Therapie am besten wirkt«, sagt Lauer. Die Fortschritte beim molekularen Tumor-Profiling gehen Hand in Hand mit der Entwicklung zielgerichteter Therapien. Wer an einer Krebsform leidet, für die eine solche Therapie existiert, wird zuvor getestet, um sicherzustellen, dass die Medikamente bei ihm auch anschlagen.
Eine Studie etwa konnte zeigen, dass Patienten mit der höchsten »Mutationslast«, also der größten Zahl erworbener Mutationen im Tumor, am meisten von einer Therapie mit so genannten Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) profitieren. Die Medikamente versetzen das Immunsystem wieder in die Lage, Krebszellen zu bekämpfen. »Es ist essenziell, Erbguttests zu entwickeln, die eine Vorhersage darüber erlauben, welche Patienten auf eine solche Therapie ansprechen werden«, sagt Fröhling. »Denn ICI wirken nur bei einem kleinen Teil der Patienten, sie sind nicht frei von Nebenwirkungen und zudem ausgesprochen teuer.«
In der Praxis entnehmen Ärzte dazu eine Probe des Tumors und extrahieren die DNA. Parallel erfolgt eine Blutentnahme, um die DNA gesunder Zellen zu gewinnen. Mit »next-generation sequencing«, einem Verfahren, das die Erbgutforschung revolutioniert hat, entschlüsselt man das Erbgut eines Menschen heute in wenigen Tagen statt in Jahren, und das zu einem Bruchteil der Kosten. Häufig wird nicht das gesamte Genom sequenziert, sondern ein so genanntes Gen-Panel, das oft mehrere Hundert der bislang 700 bekannten krebsassoziierten Gene abdeckt. Die Sequenzdaten aus dem Tumor und dem Blut des Patienten werden dann Position für Position abgeglichen, um jene Veränderungen im DNA-Text herauszufiltern, die nur im Tumor vorkommen.
Erbgutanalyse ist aber nicht gleich Erbgutanalyse: Mit Hilfe eines Gen-Panels sucht man nach bereits bekannten Markern, man wird damit keine neuen Mutationen aufspüren. Deutlich umfangreicher ist ein »whole exom sequencing« (WES), bei dem alle proteincodierenden Bereiche entschlüsselt werden - also alle 20 000 Gene des Patienten. Auch das WES deckt nur etwa zwei Prozent des vollständigen menschlichen Erbguts von drei Milliarden DNA-Buchstaben ab: Entschlüsselt man all diese im Rahmen eines »whole genome sequencing« (WGS), so lassen sich auch sehr seltene Mutationen entdecken.
Die Analysen unterscheiden sich zudem in der so genannten Sequenztiefe. So liest man die einzelnen DNA-Bruchstücke einer Probe beim WGS bis zu 90-mal, beim WES bis zu 120-mal und bei einem Gen-Panel bis zu 1000-mal aus. »Bei einem WGS bekommt man sozusagen ein Panoramabild, bei einem Panel dafür einen sehr scharfen Ausschnitt«, erklärt Stefan Wiemann, Leiter der Abteilung Molekulare Genomanalyse am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Welche Analyse wann sinnvoll ist, entscheidet eine Expertenrunde aus Ärzten und Forschern – das »Tumorboard«.
»Am NCT in Heidelberg sequenzieren wir entweder das Exom oder das gesamte Genom«, erklärt Fröhling. »In der Regel handelt es sich um Patienten, denen mit herkömmlichen Methoden und Therapien nicht geholfen werden konnte. Eine Komplettsequenzierung ermöglicht eine maximal präzise genetische Charakterisierung eines Tumors und bietet die Chance, doch noch eine Therapieoption zu finden.« Allerdings ist auch eine vollständige Erbgutanalyse kein Garant für eine wirksame Therapie: In manchen Fällen wird die Krebs verursachende Mutation nicht identifiziert, in anderen Fällen existiert keine Behandlung.
Ohnehin ist eine Erbgutanalyse nicht immer notwendig. »Es gibt Krebserkrankungen, deren genetische Ursache heute bekannt ist; dann ist eine umfangreiche Erbgutanalyse medizinisch gar nicht notwendig«, sagt Wiemann. Bei bestimmten Formen des Brustkrebses etwa oder der chronischen myeloischen Leukämie (CML). Vor 30 Jahren noch führte die Krankheit nach wenigen Jahren zum Tod, es sei denn, man fand einen geeigneten Stammzellspender. Nachdem die molekulare Ursache entdeckt worden war, konnte man eine zielgerichtete Therapie entwickeln, die der Krankheit ihren Schrecken nahm. »Das ist ein Extrembeispiel, weil alle CML-Patienten den gleichen Chromosomendefekt aufweisen, aber es macht Hoffnung«, so Fröhling. Denn je mehr über die molekularen Ursachen von Krebserkrankungen bekannt ist, desto eher können entsprechende Therapien entwickelt werden.
»Die experimentelle Medizin von heute ist die Standardmedizin von morgen«Ulrich Lauer, Universitätsklinikum Tübingen
In den USA wachsen die Datenbanken, die Erbgutveränderungen mit Krebserkrankungen koppeln, so dass immer mehr Krebsleiden genetisch charakterisiert werden. »Deutsche Institutionen beteiligen sich oft nicht, weil wir den Datenschutz extrem ernst nehmen«, sagt Fröhling. Viele Forscher empfänden das als behindernd. Doch das Problem ist real: »Eine Re-Identifikation aus umfassenden Sequenzdaten ist immer möglich«, erklärt Wiemann. Zum Vergleich führt er den gängigen Vaterschaftstest an, bei dem 16 Positionen der DNA in den Blick genommen werden müssen, um einen hochverlässlichen Aufschluss zu bekommen. In Deutschland sind die Daten deswegen doppelt pseudonymisiert. Nur der Arzt soll die Sequenzdaten einem Patienten zuordnen können; und nur er entscheidet, ob die Daten zu Forschungszwecken genutzt werden oder nicht.
»Tumorsequenzierungen sind noch eine experimentelle Methode, aber ich würde mir wünschen, dass sie vor allem für Patienten mit einem fortgeschrittenen Krebsleiden bald Eingang in die Klinik finden«, sagt Fröhling. Die noch hohen Kosten stehen dem bisher entgegen, vor allem aber »fehlt auch schlicht die Infrastruktur«. Und: Während der Zeitaufwand für die Sequenzierung rapide gesunken ist, sind die Anforderungen an die Datenanalyse stark gestiegen. »Die Datenmengen sind enorm, und nur Experten können sie interpretieren«, erläutert Wiemann. Für Patienten heißt das momentan: Eine umfangreiche Erbgutanalyse wird nur im Rahmen von Forschungsprogrammen durchgeführt oder muss privat bezahlt werden. Lauer ist davon überzeugt, dass sich das in nicht allzu ferner Zukunft ändern wird: »Die experimentelle Medizin von heute ist die Standardmedizin von morgen.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.