100 Jahre Quantenmechanik: Dichtung und Wahrheit hinter Heisenbergs Quantenrevolution
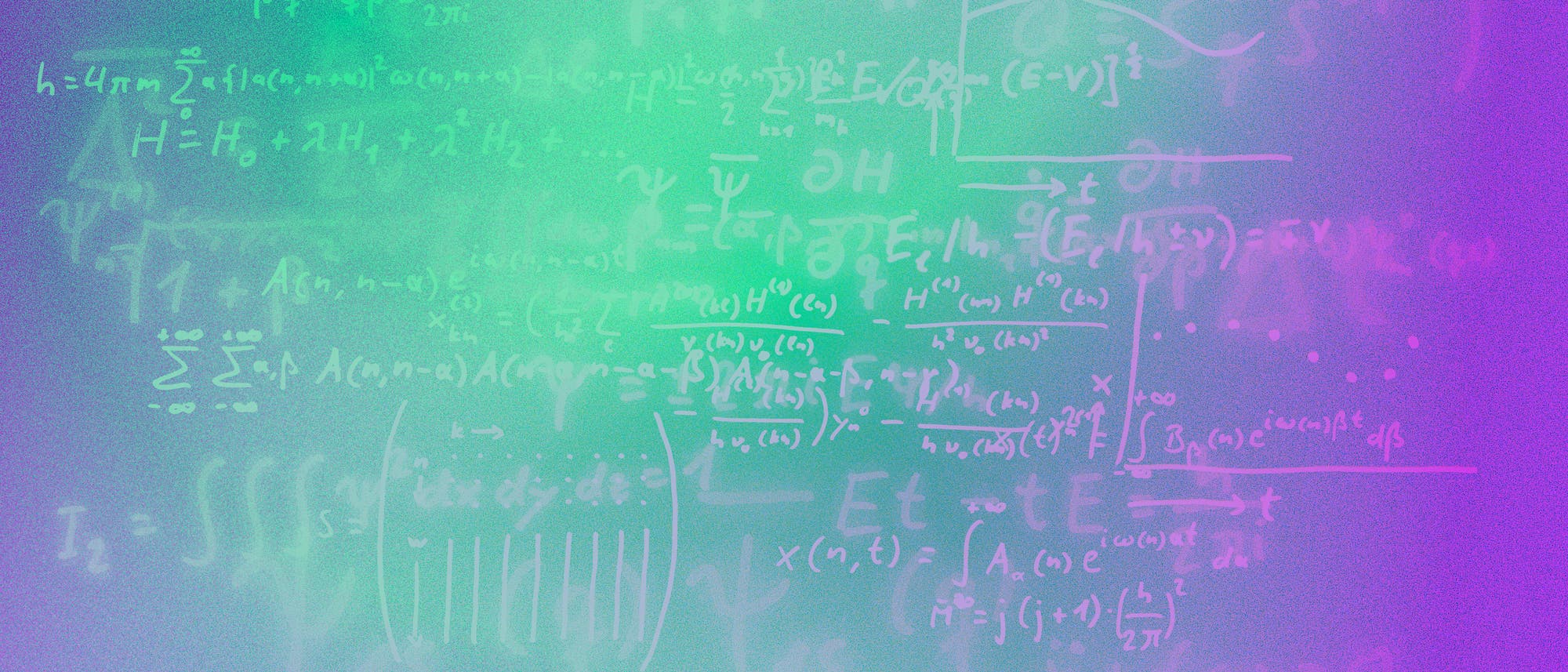
Wer die Revolution der Quantenmechanik begreifen will, begegnet zwei verschiedenen Geschichten. Die erste ist eine Heldenstory. Folgt man ihr, gelangt man zu einem ganz bestimmten Punkt in Raum und Zeit – mit einem entscheidenden Geistesblitz, der das Verständnis der subatomaren Welt umwälzen sollte. Die zweite ist komplexer und enthält mehr als nur einen einsamen Helden.
Die Heldengeschichte geht so: Die physikalische Welt erschüttern zu Beginn des 20. Jahrhunderts unerklärliche Messungen an Licht und Atomen. Bei den Deutungsversuchen verstrickt sich die Fachgemeinschaft über Jahre in Widersprüche; die Physiker, die sich bis dahin im Zenit der Erkenntnis wähnten, können die seltsamen Phänomene nicht stimmig erklären. Die bewährten Vorstellungen und klassischen Bilder versagen. Die Physik befindet sich in einer Krise.
Auftritt Werner Heisenberg. Im Frühsommer des Jahres 1925 hat der gerade einmal 23-jährige Physikstudent aus Göttingen die Nase voll. Nicht nur im übertragenen Sinn. Ihn plagt zwar einerseits die verfahrene theoretische Lage. Vor allem aber lässt ihn lähmender Heuschnupfen keinen klaren Gedanken fassen. Beides will er mit einem Urlaub auf der deutschen Hochseeinsel Helgoland ändern. Und tatsächlich: Fernab sowohl von den Pollen als auch den Ablenkungen des Festlands klart sich Heisenbergs Geist auf. Das junge Genie blickt auf völlig neue Weise auf das größte Rätsel der damaligen Physik.
Themenwoche »Quantenphysik neu gedacht«
Die Quantenmechanik war von Anfang an heftig umstritten. Auch 100 Jahre später ist sich die Fachwelt nicht einig: Was verraten die Formeln über die Realität? In dieser Themenwoche hinterfragen wir, was nötig ist, um die wahre Natur der Teilchen zu begreifen. Womöglich braucht es eine völlig andere Herangehensweise.
100 Jahre Quantenmechanik: Dichtung und Wahrheit hinter Heisenbergs Quantenrevolution
Realität: Warum selbst Physiker die Quantenmechanik nicht verstehen
Quanten-Holonomie-Theorie: Eine neue Verbindung von Raum, Zeit und Quantenphysik
Unwissenschaftliche Heilsversprechen: Schluss mit dem Quanten-Hokuspokus!
Nobelpreisträger 't Hooft: »Der Grund, warum es nichts Neues gibt, ist, dass alle gleich denken«
Springers Einwürfe: Die Zukunft der Quanten
Mehr zu den seltsamen Phänomenen aus der Welt der Teilchen und Atome finden Sie auf unserer Themenseite »Quantenphysik«.
Zurück in Göttingen bringt er seinen konzeptionellen Durchbruch zu Papier und reicht ihn Ende Juli 1925 zur Veröffentlichung ein. Bereits das Wort »Umdeutung« im Titel der Publikation macht klar, wofür Heisenberg hier plädiert: eine radikal andere Sicht auf klassische Konzepte.
Es führe in die Irre, argumentiert Heisenberg, das befremdliche Verhalten der unsichtbaren Partikel anschaulich beschreiben zu wollen. Deswegen mussten alle scheitern, die das bisher versucht hatten. Stattdessen dürfe man lediglich die nüchternen Messergebnisse heranziehen, so verwirrend die einzelnen Beobachtungen auch sein mögen. Es brauche einen neuen mathematischen Formalismus. Der liefere dann ein widerspruchsfreies Modell vom Reich der kleinsten Teilchen, unbelastet von herkömmlichen Vorstellungen.
Entsprechende Rechenvorschriften skizziert Heisenberg in seinem Artikel. Auf diesen lässt sich endlich eine funktionierende, allumfassende Quantentheorie aufbauen – und mit ihr die Atomphysik von Grund auf neu errichten.
Eine andere Wahrheit
So weit die erste Erzählung. Die zweite ist verwobener, vielschichtiger. Sie spielt nicht auf den zerklüfteten Felsen der kargen Hochseeinsel, sondern zwischen sanften, bewaldeten Hügeln in Göttingen. In der preußischen Universitätsstadt kommen seit einigen Jahren die größten mathematischen und naturwissenschaftlichen Genies zusammen. Sie ist nur eine Tagesreise entfernt von weiteren Hotspots der europäischen Physik wie Kopenhagen und München. Überall diskutieren die klügsten Köpfe des frühen 20. Jahrhunderts über die neuen Erkenntnisse und deren Deutungen, besuchen sich, tauschen Briefe aus. Ansätze aus den verschiedenen Fachgebieten und unterschiedliche Ansichten befruchten sich gegenseitig.
Letztlich entscheidet Kooperation statt Isolation. Nur dem Schmelztiegel heiß diskutierter, oft gegensätzlicher, unkonventioneller Ideen kann eine Theorie entspringen, die anders ist als alles, was man bisher kannte: eine Weltsicht, konzeptionell so anspruchsvoll und mathematisch so befremdlich, dass es die Leistungsfähigkeit selbst des größten Geistes überstiege, sie einsam in einem kreativen Rausch zu erdenken.
Innerhalb weniger Jahre entstehen verschiedene Formelwerke und philosophische Interpretationen der neu begründeten Quantenmechanik. Es entbrennt ein leidenschaftlich geführter Streit darüber, welche Perspektive die wahre Natur der Teilchen am besten erfasst. Zu keinem Zeitpunkt war auf einen Schlag alles klar. Im Gegenteil dauert zu manchen Fragen die Debatte bis heute an.
Beide Erzählungen scheinen nicht zusammenzupassen. Aber wer sich mit Quantenmechanik beschäftigt, muss sich an Irritationen gewöhnen.
Wer sich mit Quantenmechanik beschäftigt, muss sich an Irritationen gewöhnen
Zum widersprüchlichen Wesen der Quanten gehört es, dass mitunter grundverschiedene Dinge nebeneinander existieren. Etwas kann sowohl grenzenlos ausgedehnte Welle als auch kompaktes Teilchen sein. Objekte befinden sich irgendwie an einem Ort und zugleich an einem anderen. Lässt sich so etwas überhaupt verstehen, und welche entscheidenden Konzepte braucht es dafür? Der Geschichte der Quantenmechanik nachzugehen hilft dabei, ihre zentralen Ideen zu begreifen und zu etwas vorzudringen, was zum Fundament der modernen Physik wurde.
Die Welt in Feierlaune
Jeder liebt gute Heldengeschichten, auch die physikalische Community. Deshalb haben die Vereinten Nationen das Jahr 2025 – genau 100 Jahre nach dem Erscheinen von Heisenbergs Umdeutungs-Paper – zum »Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und Quantentechnologien« ausgerufen.
Um bloß keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, auf welche Geschichte sich die Organisatoren bei dem Jubiläum beziehen, veranstalteten sie eine hochrangig besetzte wissenschaftliche Konferenz auf Helgoland. Spitzenforscher, darunter mehrere Nobelpreisträger, trafen sich Anfang Juni 2025 zu einem mehrtägigen Workshop auf der Insel. Dort besprachen sie die größten Herausforderungen der modernen Quantenphysik: Quanteninformatik, mögliche Wege zu einer Quantengravitation, die Grenzen zwischen klassischer und Quantenwelt.
Auf einem Wanderweg konnten die Teilnehmenden an einem Gedenkstein vorbeigehen, der seit einem Vierteljahrhundert dem rauen Klima Helgolands trotzt. Auf der Plakette steht: »Im Juni des Jahres 1925 gelang hier auf Helgoland dem 23-jährigen Werner Heisenberg der Durchbruch in der Formulierung der Quantenmechanik, der grundlegenden Theorie der Naturgesetze im atomaren Bereich, die das menschliche Denken weit über die Physik hinaus tiefgreifend beeinflusst hat.« So erzählte man es sich im Juni 2000, als die Deutsche Physikalische Gesellschaft die Tafel gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Physik in München enthüllte, das Werner Heisenberg bis zu seiner Emeritierung Ende 1970 leitete.
Doch mit etwas Abstand zeigt sich die Lage 25 Jahre später weniger eindeutig, als der Gedenkstein glauben lässt. Feiert die Welt den 100. Geburtstag der Quantenmechanik am richtigen Ort – und ist es überhaupt das richtige Jahr?
Streit ums Allerkleinste
Den dramaturgischen Rahmen für die Heldengeschichte der Quantenmechanik setzt eine ebenso beliebte Erzählung: Im ausklingenden 19. Jahrhundert sei noch kein Hauch von Revolution zu spüren gewesen. Im Gegenteil hätten die zeitgenössischen Physiker selbstgefällig auf das eigene Fachgebiet geblickt. Mit den bis dahin gefundenen Gesetzen – der Mechanik, dem Elektromagnetismus und der Thermodynamik – schienen sich alle Vorgänge begreifen zu lassen, bis hinab zum gerade erst entdeckten Reich der Atome. So schien es dem Experimentalphysiker und späteren Nobelpreisträger Albert Michelson im Jahr 1894 »wahrscheinlich, dass die meisten der grundlegenden Prinzipien bekannt sind«. Die Zukunft der Physik läge in Präzisionsmessungen.
Doch auch dahinter steckt eine etwas kompliziertere Wahrheit. Schon zur Jahrhundertwende wurde deutlich, dass mit den bekannten Regeln der Physik etwas nicht stimmen konnte. Das offenbarten nicht etwa exotische Phänomene, sondern ganz banale, vorderhand klassische Zusammenhänge. Es ging um die scheinbar einfache Frage, welche Strahlung ein heißer Körper abgibt.
Wer ein Stück Metall erhitzt, sieht es erst rötlich schimmern. Mit höherer Temperatur kommen weitere Farben hinzu, und das Werkstück glüht orange, gelb, schließlich grellweiß. Das Ganze – in idealisierter Form – zu beschreiben, klappte mit den etablierten Formeln aber nicht. Es kam zur »Ultraviolettkatastrophe«: Bei immer kürzeren Wellenlängen, das heißt in Richtung des ultravioletten Bereichs, schien die Energie der abgegebenen Strahlung unendlich groß zu werden. Unendlichkeiten ergeben in der Physik keinen Sinn, hier stimmte etwas nicht.
Im Jahr 1900 fand der deutsche Physiker Max Planck eine Formel, mit der er die Ultraviolettkatastrophe abwenden konnte. Doch dafür musste Planck annehmen, dass Atome die Strahlung nur in Form kleinstmöglicher Energiehäppchen abgeben. Heute würden wir sagen: in Quanten. Das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht einleuchtend, sondern erstmal bloß ein mathematisches Experiment. Planck hatte zur Berechnung der Mindestenergie rein behelfsmäßig eine Konstante h eingeführt. Das funktionierte. Entgegen seiner Erwartungen gelang es Planck aber anschließend nicht, sein h wieder aus den Formeln zu beseitigen.
Die Konstante ließ Planck nicht mehr los, bis in den Tod. Seinen schlichten Grabstein auf dem Stadtfriedhof Göttingen zieren nur zwei Dinge. Ganz oben sein Name, schnörkellos. Dicht über dem Boden, inmitten floraler Verzierungen, h und ihr Wert. Auf dieser Basis erwuchs eine neue Physik.
Mit Plancks Konstante waren die Quanten gekommen, um zu bleiben. E = hν, die Energie von Strahlung entspricht Portionen von h mal ihrer Frequenz, diese einfache Gleichung war Ausdruck etwas grundlegend Neuem.
Und so feierten viele Institutionen, etwa die Deutsche Physikalische Gesellschaft, das 100. Jubiläum der Quantenphysik bereits im Jahr 2000. Weitere Anlässe folgten bald.
Ausgerechnet Albert Einstein, der vorrangig für seine kosmologischen Errungenschaften und für seine spätere kritische Haltung gegenüber der Quantenmechanik bekannt ist, brachte im Jahr 1905 die Quanten in die Atomphysik. Er erklärte den mysteriösen »photoelektrischen Effekt«, der zuvor im Labor gemessen worden war. Hierbei schlägt Strahlung Ladungsträger aus der Oberfläche eines Materials heraus – allerdings nicht, wie erwartet, abhängig von der Intensität des Lichts, sondern von dessen Frequenz. Um das zu erklären, schrieb Einstein dem Licht, das seit einem Jahrhundert gesichert als Welle galt, den Charakter eines Teilchens zu. Es überträgt seine Energie nicht kontinuierlich, sondern in Form kleiner Pakete, als Lichtquanten. Diese Erkenntnis brachte ihm später den Nobelpreis ein - und nicht seine Relativitätstheorien.
Im Jahr 1913 ging es auch dem Dänen Niels Bohr um seltsame Versuchsergebnisse. Der experimentelle Befund: Die negativen Ladungsträger kleben nicht im restlichen Atom wie in einem Rosinenbrötchen. Vielmehr konzentriert sich die positive Ladung auf einen Kern, und die Elektronen bewegen sich offenbar irgendwie drumherum. Doch den klassischen Gesetzen zufolge müssten sie während ihrer Drehung Energie abgeben und deshalb innerhalb kürzester Zeit in den Kern stürzen. Aber Atome verlieren keine Energie, sondern sind stabil. Mit einem neuen Atommodell gelang Bohr eine Erklärung. Demnach kreisen Elektronen verlustfrei auf ganz bestimmten Bahnen um den Atomkern. Der Bereich dazwischen ist ihnen verboten: Von Bahn zu Bahn kommen sie nur, indem sie Energie in exakt passenden Portionen aufnehmen oder abgeben – durch einen Quantensprung. Auch dieses Bild war wegweisend, und auch Bohr erhielt dafür einen Nobelpreis.
Bohrsches Atommodell
Als sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausstellte, dass sich die positive Ladung eines Atoms auf einen kompakten Kern konzentriert, geriet die klassische Anschauung an ihre Grenzen. Denn dann müssten sich die negativ geladenen Elektronen in der Atomhülle um den Kern bewegen wie Planeten um die Sonne. Doch nach den Regeln der Elektrodynamik strahlt eine kreisende Ladung elektromagnetische Wellen ab. Damit sollte das Elektron Energie verlieren und müsste innerhalb kürzester Zeit in den Kern stürzen.
Mit seinem im Jahr 1913 entwickelten Modell löste Niels Bohr das Problem. Bohr postulierte bestimmte Bahnen, auf denen Elektronen sich befinden können, ohne Energie zu verlieren. In den dazwischen gelegenen Bereichen halten sich die Teilchen nicht auf. Sie können allerdings von einer Bahn zur anderen wechseln, indem sie Strahlung einer genau definierten Wellenlänge aufnehmen oder abgeben.
Dieses Modell konnte einige experimentelle Resultate erklären, insbesondere die spektralen Übergänge beim Wasserstoff und die diskreten »Quantensprünge« bei den Energien. Es bot ein anschauliches Bild für die einfachsten Vorgänge im Atom, versagte aber bei komplizierteren Phänomenen.
Das sind zwei Beispiele für diverse Ideen zwischen den Jahren 1900 und 1925, die mit herkömmlichen Ansichten brachen, die Quantenphysik voranbrachten und sogar Nobelpreise wert waren. Was also macht Heisenbergs Beitrag so besonders?
Alle Konzepte krankten an einem Problem: Sie bedienten sich an Bildern aus der klassischen Erfahrungswelt
Bis zum Jahr 1925 gab es viele Modelle zu einzelnen Phänomenen, aber es fehlte eine konsistente mathematische Beschreibung. Denn alle Konzepte krankten an einem Problem: Sie bedienten sich an Bildern aus der klassischen Erfahrungswelt, um die Vorgänge irgendwie begreiflich zu machen. Für Heisenberg war das der zentrale Fehler. Schließlich hatte niemals jemand ein Elektron auf einer Bahn um einen Atomkern kreisen sehen. Heisenberg ließ nur zwei Dinge gelten: Beobachtungsgrößen, die sich unzweifelhaft messen lassen, und mathematische Operationen, um sie miteinander zu verbinden.
Die große Revolution der Quantenmechanik gelang nicht wegen neu entwickelter Vorstellungen davon, was mit Atomen und Strahlung passiert. Vielmehr war es nötig, sich von solchen Bildern zunächst komplett zu lösen.
Heisenbergs große Umdeutung
Zu dem, was auf Helgoland passiert ist, hat Heisenberg selbst Jahrzehnte später seine Version aufgeschrieben. Sie ist der Ursprung der oft erzählten Heldengeschichte. »Durch eine nach heutigen Maßstäben reichlich umständliche Rechnung«, resümierte Heisenberg im Jahr 1969 in seiner Autobiografie »Der Teil und das Ganze«, habe er in einer Tabelle die einzelnen Terme zu den Beobachtungsgrößen bestimmt. So bewies er seinen eigenen Worten zufolge die »mathematische Widerspruchsfreiheit und Geschlossenheit der damit angedeuteten Quantenmechanik«.
Rückblickend beschrieb er, wie er in einer Art Erweckungserlebnis »durch die Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch auf einen tief darunter liegenden Grund von merkwürdiger Schönheit« schaute. Heute überwiegen in der Geschichtsforschung Zweifel daran, dass Heisenberg wirklich einen solchen Heureka-Moment hatte. Die geradezu naturromantische Story von einer plötzlichen Erleuchtung entspringt Heisenbergs eigener, verklärender Dramatisierung einige Jahrzehnte später. Zeitgenössische Quellen machen klar, dass Heisenberg zunächst an der Tragweite seiner Ideen zweifelte und sich bei Kollegen rückversicherte, dass er überhaupt auf der richtigen Spur war.
Jedenfalls, so viel ist sicher, reichte Heisenberg seine Erkenntnisse am 29. Juli 1925 bei der »Zeitschrift für Physik« zur Veröffentlichung ein.
- Heisenbergs Umdeutung
Worum genau ging es in Heisenbergs bahnbrechender Arbeit aus dem Jahr 1925 mit dem Titel »Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen«? Die Rechnungen waren im Detail zwar kompliziert, aber die Kerngedanken lassen sich gut nachvollziehen.
- Von klassischer Physik zur Quantentheorie
Die Physiker des frühen 20. Jahrhunderts wollten das einfachste aller Atome möglichst umfassend beschreiben: Wasserstoff, der aus einem Proton und einem Elektron besteht. Wenn das Atom angeregt wird, strahlt es Licht in verschiedenen Wellenlängen aus – je nach Anregungsenergie. Dieses Spektrum vollständig zu erklären galt als Schlüssel dazu, die Welt der Atome zu verstehen.
Das von Bohr im Jahr 1913 entwickelte Atommodell konnte bereits viele gemessene Eigenschaften begründen, andere aber nicht. Werner Heisenberg störte vor allem, dass das Elektron in dem Modell Bahnen um den Kern beschreiben soll, die sich aber gar nicht beobachten lassen. Heisenberg wollte seine Erklärung der spektralen Übergänge – seine Quantenmechanik – nur auf Eigenschaften stützen, die sich auch messen lassen: Unterschiede bei den Frequenzen und Intensitäten der Strahlung. Er wollte einen Weg finden, solche Größen miteinander in Beziehung zu setzen und daraus Vorhersagen abzuleiten.
Allerdings war das Wasserstoffatom für Heisenberg erst einmal eine Nummer zu groß. Deswegen betrachtete er zunächst ein einfacheres Problem aus der klassischen Physik: einen eindimensionalen Oszillator, ein schwingendes Teilchen. Hier verwendete er den Ansatz der Störungstheorie, bei dem man zu einer ersten groben Näherung immer kleinere Terme hinzufügt. Summiert man oft genug auf, wird das Endergebnis immer besser – sofern alles klappt.
Seine quantenmechanischen Ausdrücke konstruierte Heisenberg analog zu dem klassischen Beispiel. Allerdings erinnerte er daran, dass es nicht möglich ist, »dem Elektron einen Punkt im Raum als Funktion der Zeit mittels beobachtbarer Größen zuzuordnen« – genau von solchen unsichtbaren Elektronenbahnen wollte er sich ja abkehren. Stattdessen entwickelte Heisenberg Gleichungen, mit denen er anhand messbarer Werte beschrieb, wie ein Elektron Strahlung abgibt. Dabei verglich er Zeile für Zeile seine quantentheoretischen Rechnungen mit dem klassischen Gegenstück. Er stellte mit Blick auf die Störungstheorie fest, man könne »offenbar immer dann, wenn diese Funktion nach Potenzreihen in x entwickelbar ist, das quantentheoretische Analogon finden«.
Das funktioniert aber nicht, wenn man nach einem konkreten Ort x(t) sucht. Klassisch summiert oder integriert man hier über verschiedene Größen. Quantenmechanisch jedoch schien Heisenberg das rechnerisch »nicht ohne Willkür möglich und deshalb nicht sinnvoll«. Es lohnt sich also nicht, danach zu fragen, wo genau sich ein Elektron auf einer hypothetischen Bahn befindet.
Was soll man also stattdessen hernehmen, um auf irgendeine Art von Ergebnis zu kommen? Eben genau die »Gesamtheit der Größen«, die sich quantenmechanisch nicht mehr aufsummieren lässt und die von den vielen beobachtbaren Übergängen stammt. Man muss sie deswegen alle gemeinsam betrachten und auflisten. In einer Tabelle – einer Matrix! Allerdings: Heisenberg kannte das mathematische Konzept der Matrizen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Deswegen wirkt seine Darstellung aus heutiger Sicht unübersichtlich.
Das erklärt auch, warum Heisenberg noch auf eine »wesentliche Schwierigkeit« stieß, nämlich »wenn wir zwei Größen x(t), y(t) betrachten und nach dem Produkt x(t)y(t) fragen«: »Während klassisch x(t)y(t) stets gleich y(t)x(t) wird, braucht dies in der Quantentheorie im Allgemeinen nicht der Fall zu sein.« Das ist genau die bei Matrizen übliche Nichtkommutativität.
Den Zusammenhang mit Matrizen erkannte erst Max Born, sein Institutsleiter in Göttingen, als er Heisenbergs Manuskript gegenlas. Kurz darauf formulierten Heisenberg, Born und Pascual Jordan die Matrizenmechanik. Der Rest ist Geschichte.
Allerdings besaß Heisenbergs Schema aus damaliger Sicht eine Schwäche. Gerade die sollte sich aber als wegweisend für die neue Quantenmechanik herausstellen: Die Berechnungen waren nichtkommutativ. Demnach würde die Reihenfolge, mit der man physikalische Größen misst, den Ausgang eines Experiments beeinflussen. Ob man erst die Geschwindigkeit eines Teilchens anschaut und dann seinen Ort, liefert andere Ergebnisse, als wenn man den Ort zuerst feststellt und dann die Geschwindigkeit. Beide Messungen lassen sich nicht folgenlos vertauschen.
Aus Sicht der klassischen Mechanik ergibt das keinen Sinn. Ob ich erst die Position und dann die Geschwindigkeit eines geworfenen Balls ermittle oder umgekehrt, ändert nichts an seiner Flugbahn. Heisenberg selbst wusste die kuriose Nichtkommutativität zunächst nicht so recht einzuordnen. Er erwähnte diese Eigenschaft in seiner Veröffentlichung nur knapp als »Schwierigkeit«.
Vor allem aber waren Heisenbergs Berechnungen nicht sonderlich elegant. Als er sie in Göttingen selbstkritisch seinem Institutsleiter Max Born vorlegte, erkannte dieser: Bestimmte mathematische Objekte könnten das Ganze erheblich vereinfachen, nämlich Matrizen, eine Art Tabelle. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Matrizen mit ihren eigenwilligen Regeln - auch Matrizenrechnung ist nicht kommutativ - in der Physik nur vereinzelt genutzt worden. Sie galten als abstrakte Objekte der reinen Mathematik. Born war selbst nicht besonders geübt auf dem Gebiet. Sein ehemaliger Student Pascual Jordan kannte sich da besser aus. Jordan hatte in Göttingen dem Mathematiker Richard Courant bei dessen Arbeit am späteren Lehrbuchklassiker »Methoden der mathematischen Physik« assistiert. Ein zentrales Thema: Matrizen.
Im September 1925 reichten Born und Jordan eine Veröffentlichung bei der »Zeitschrift für Physik« ein, in der sie Heisenbergs Ansatz mit Hilfe von Matrizen weiterentwickelten. Dabei erklärten sie erst einmal ausführlich die Grundlagen der Matrizenrechnung – die man heute bereits im Grundstudium der Physik lernt.
Schließlich schrieben die zwei Physiker gemeinsam mit Heisenberg im November 1925 eine Formulierung auf, die als »Dreimännerarbeit« bekannt wurde. Hier legten sie mit einer ausgearbeiteten »Matrizenmechanik« ein solides Fundament für die neue Quantenmechanik.
Das eigentlich Bahnbrechende an Heisenbergs Ansatz
Wenn man aus moderner Sicht die ersten Berechnungen Heisenbergs aufs Wesentliche herunterkocht, sticht ausgerechnet die »Schwierigkeit«, die Nichtkommutativität, als wichtige Besonderheit heraus. Durch sie kommt, wenn man den Impuls p (Masse mal Geschwindigkeit) eines Teilchens mit dem Ort q multipliziert, etwas anderes heraus, als wenn man umgekehrt q mal p rechnet. Und auf geradezu magisch wirkende Weise hängt die Differenz zwischen beiden Produkten mit ebenjener Konstante h zusammen, die Planck im Jahr 1900 eingeführt hatte: pq − qp = h⁄2πi.
Auch diese entscheidende Formel findet man auf dem Stadtfriedhof Göttingen, wenn man von Plancks Grab weiter zu Max Borns Ruhestätte läuft. Dort steht sie unter Borns Namen graviert, mit ihm verbunden für die Nachwelt. Dieser Zusammenhang war, nach Plancks Konstante, die zweite wegweisende Erkenntnis für die Quantenmechanik: Ort und Impuls lassen sich nicht auf klassische Weise fassen. Deswegen kann es im Quantenreich keine klar umrissenen Bahnen geben, weder um Atome noch sonstwo.
Dieses grundlegende Prinzip führte Heisenberg bald darauf näher aus. Der Physiker schuf damit das, wofür er heute am bekanntesten ist: die nach ihm benannte Unschärferelation. Er stellte fest, dass miteinander verknüpfte Größen wie p und q »simultan nur mit einer charakteristischen Ungenauigkeit bestimmt werden können«, wie er in einer 1927 publizierten Arbeit beschrieb. Auch zu dieser Einsicht gelangte Heisenberg übrigens nicht allein, sondern laut einer Fußnote durch »vielfache Anregung« seines Kollegen Wolfgang Pauli, mit dem er sich über Jahre intensiv austauschte.
Eine Veranschaulichung des Prinzips lieferte Heisenberg gleich mit. Wenn man beispielsweise den Aufenthaltsort eines Elektrons bestimmen möchte, muss man hingucken. Dazu lässt man Licht auf das Teilchen fallen, denn sonst sieht man ja nichts. Doch dadurch gibt man dem Elektron einen Stoß, man verändert dessen Impuls. Und will man präziser messen, muss die Energie des Lichts größer sein: »Je genauer der Ort bestimmt ist, desto ungenauer ist der Impuls bekannt und umgekehrt.«
Das Jahr 1925 legte also die Basis für einen konzeptionell völlig neuen, umfassenden Blick auf die Quantenwelt. Schnell wurde der physikalischen Gemeinschaft klar, dass dieser mathematische Weg auch praktisch funktionierte. So berechnete Pauli mit den neuen Regeln erfolgreich die Zustände des Wasserstoffatoms. Es ist zwar das einfachste Atom, aber es galt bereits als notorisch schwieriger Anwendungsfall. Am Wasserstoff musste sich jede Theorie messen lassen. Im Gegensatz zu Bohrs Atommodell bestand die Matrizenmechanik den Test bravourös.
Urheber der Revolution war also nicht Heisenberg allein – schon gar nicht einzig sein Aufenthalt auf Helgoland. Der Held war Teil einer Heldenmaschinerie. Immerhin, das Jahr scheint gut gewählt. Oder doch nicht? Auftritt eines Widersachers.
Konkurrenz durch Wellen
Gerade, als die Matrizenmechanik erste Triumphe feierte, sorgte eine andere Interpretation der Quantenwelt für Aufsehen. Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger beschrieb im Jahr 1926 das Verhalten von Teilchen nicht mit unhandlichen Matrixmultiplikationen, sondern mit Hilfe eines viel vertrauteren Mechanismus: Schrödinger formulierte alles mit Wellen, die sich von einem gewissen Anfangszustand an ausbreiten.
Das hielt Einsteins Einsicht aus dem Jahr 1905 den Spiegel vor. Einstein hatte Licht, das ehemals als Welle galt, auch Teilchencharakter zugeschrieben. Nun begriff Schrödinger vermeintlich punktförmige Teilchen, wie Elektronen, ihrerseits als Wellen. Die Idee hatte kurz zuvor der französische Physiker Louis de Broglie ins Spiel gebracht.
Schrödingers Ansatz: Die Wellenfunktion des Teilchens verändert sich mit der Zeit. So lässt sich zu jedem Zeitpunkt vorhersagen, in welchem Zustand ein System ist. Das beschreibt viele physikalische Vorgänge elegant und einfach. Diese »Wellenmechanik« liefert mathematisch gesehen dieselben Ergebnisse wie die Matrizenmechanik. Das ließ sich bald darauf beweisen.
Schrödingers nachvollziehbare Wellen waren für viele Zeitgenossen reizvoller als die abstrakten Matrizen
Schrödingers nachvollziehbare Wellen – und seine in der Physik bereits etablierten Differenzialgleichungen – waren für viele Zeitgenossen reizvoller als die abstrakten Matrizen. Die Wellenmechanik hatte auch praktische Vorteile; veränderliche Prozesse lassen sich damit recht einfach berechnen. Vieles kann man im Wellenbild leicht, geradezu intuitiv fassen.
Allerdings lässt sich Schrödingers Ansatz gerade deshalb als Schwäche auslegen. Das vertraute Bild von Wellen suggeriert Anschaulichkeit – und das für eine Welt, die doch offenbar völlig anders funktioniert als in unserer Erfahrung. In der Wellenmechanik ist nun wieder alles auf gewisse Weise deterministisch: Kennt man die Wellenfunktion zu einer bestimmten Zeit, kann man sie auch für alle darauf folgenden Zeitpunkte berechnen. Für viele wirkte Schrödingers Bild gerade deshalb so attraktiv. Wer könnte es ihnen nach zwei Jahrzehnten verwirrender Suche nach der Natur der Quanten verdenken?
Born schlug noch im Jahr 1926 eine eigene Interpretation vor, die Wellen- und Teilcheneigenschaften verband. Er verwies dabei auf eine Bemerkung Einsteins, »dass Wellen nur dazu da seien, um den korpuskulären Lichtquanten den Weg zu weisen«.
Übertragen auf die Quantenmechanik bedeute das: Schrödingers Wellen seien lediglich ein »Führungsfeld«, das sich entsprechend der Schrödingergleichung im Raum ausbreite. Es zeige den Teilchen gewissermaßen die Möglichkeiten, die sie haben, eine Bahn einzuschlagen. Welchen Weg das Teilchen dann aber tatsächlich nimmt und an welchem Ort es erscheint, das sei rein zufällig. Damit gab Born die theoretische Determiniertheit der Wellenmechanik auf, ohne auf ihren praktischen Nutzen zu verzichten. Mit dem Ansatz lässt sich die Chance berechnen, ein Teilchen an einer bestimmten Stelle anzutreffen: Die Amplitude der Wellen – wie stark sie ausschlagen – liefert die Wahrscheinlichkeit dafür, das Teilchen dort zu beobachten.
Unerträgliche Unanschaulichkeit
Die erste radikale Aussage der Quantenmechanik war das, was etwa Planck, Einstein und Bohr früh herausgearbeitet hatten: nämlich dass die Welt im Kleinsten unteilbare Schritte macht. Revolutionärer war jedoch die Erkenntnis von Heisenberg und Born: Wohin diese Quantenschritte führen, ist unvorhersagbar.
Borns statistische Interpretation legt schonungslos offen, was die Quantenmechanik so schwierig zu begreifen macht. Einerseits ist aus dem Alltag völlig klar, dass sich Dinge in einem eindeutigen Zustand befinden: Eine Katze ist entweder tot oder lebendig, und es wäre Unsinn, zu behaupten, sie sei beides gleichzeitig. Das ist das Argument aus Schrödingers inzwischen berühmtem Gedankenexperiment, das er 1935 beschrieb.
Quantenmechanische Superposition
Wenn bei einem System mehrere verschiedene Zustände möglich sind, ist laut unserer Alltagserfahrung immer nur entweder der eine oder der andere realisiert. In der Quantenphysik können aber auch beide gleichzeitig vorliegen.
Bei einem solchen Überlagerungszustand hat beispielsweise der Drehsinn eines Teilchens mehrere Werte – gewichtet mit ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeitsamplitude. Erst durch eine Messung entscheidet sich, in welchem tatsächlichen Zustand man das Quantensystem vorfindet, ob sich das Teilchen also etwa links- oder rechtsherum dreht.
Andererseits suggerieren uns Schrödingers Wellen, dass sich in einem Quantensystem alles in einem Ozean der Überlagerungen unendlich vieler Zustände befindet. Das Ganze offenbart sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem konkreten Zustand erst dann, wenn wir hinschauen. Völlig zufällig. Schrödinger wollte diese fundamental neue Unbestimmtheit nicht akzeptieren. Auch Einstein nicht: Gott würfle nicht, schrieb er an Born in einem oft zitierten Brief.
Erbitterte Auseinandersetzungen – bis heute
Damit entbrannte der bislang größte Streit der Quantenmechanik. Die Fachwelt war gespalten zwischen denen, die der von Zufall geprägten Interpretation anhingen – gewisse Ereignisse lassen sich ganz grundlegend auf keine Ursache zurückführen –, und denen, die »verborgene Variablen« vermuteten. Das sind unsichtbare Parameter, die Ereignisse miteinander verknüpfen auf eine Weise, die wir bloß nicht messen können. Irgendwelche Verbindungen muss es geben – in der Quantenmechanik heißen sie Verschränkung.
Quantenverschränkung
In der Quantenmechanik können in einem zusammengesetzten System mehrere Zustände miteinander verknüpft sein – auf eine Weise, die sich klassisch nicht erklären lässt.
Hier befinden sich Teilchen 1 und Teilchen 2 jeweils in einer Überlagerung von zwei möglichen Drehungen und sind miteinander verschränkt. Das Besondere an der Verschränkung: Wenn man einen der beiden Partner durch Messung auf einen eindeutigen Zustand festlegt, dann erhält auch der andere sofort einen bestimmten Zustand.
Beispielsweise können die Drehrichtungen von Teilchen 1 und 2 so miteinander verknüpft sein, dass Teilchen 2 stets andersherum rotiert als Teilchen 1. Dann legt man den Drehsinn von Teilchen 1 durch eine Messung fest – und kennt in diesem Moment zugleich den Zustand von Teilchen 2. Das gilt selbst dann, wenn dieses sich so weit vom ersten Teilchen entfernt befindet und seinerseits so schnell gemessen wird, dass sich beide Experimente keinesfalls gegenseitig beeinflussen können.
Jahrzehnte später ließ sich die Existenz mancher solcher Parameter experimentell ausschließen. Dabei ging es um solche, die »lokal« sind und nur ihre unmittelbar erreichbare Umgebung beeinflussen. Heute ist klar: Teilchen können stärker miteinander verknüpft sein, als es eine lokale Theorie mit verborgenen Variablen zulassen würde. Dafür gab es im Jahr 2022 einen Nobelpreis. Doch viele Fragen zur wahren Natur der Quantenmechanik bleiben offen.
Deshalb dauert noch heute die Diskussion darüber an. Weiterhin gibt es Deutungen der Quantenmechanik, die auf verborgene Variablen setzen. Dann gäbe es irgendetwas, was alles im Universum vorherbestimmt. Dass die Quantenmechanik mitsamt ihrer Verschränkung einen statistischen Charakter hat, sei Zeichen einer unvollständigen Theorie, so die Anhänger dieser Sichtweise.
Welches Bild das beste ist, ist heute so wenig klar wie vor 100 Jahren
Etliche verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik haben versucht, sich auf die seltsamen Phänomene des Mikrokosmos einen Reim zu machen. Sie sollen die zahlreichen Paradoxa auflösen, die entstehen, wenn Objekte zugleich Teilchen und Wellen sind. Oder wenn sich Zustände überlagern und offenbar erst durch Messungen festgelegt werden. Oder wenn etwas an einem Ort mit etwas anderem, weit Entferntem auf klassisch unfassbare Weise verschränkt sein kann. Welches Bild das beste ist – und ob man sich überhaupt ein Bild machen kann – ist heute so wenig klar wie vor 100 Jahren. Sicher ist seit 1925 nur: Mathematisch funktioniert alles. »Shut up and calculate!« – »Halt die Klappe und rechne!« – wurde deswegen zu einem geflügelten Wort. Das stößt vielen auf.
Denn wer diesem Mantra stur folgt, erhält zwar stets präzise Ergebnisse, erstickt aber jede kritische Auseinandersetzung, jede Suche nach Verständnis. Vielleicht auch jede Kreativität, die von jahrzehntelangen Diskursen rund um die Wunder der Quantenwelt beflügelt wurde. Philosophische Diskussionen mögen fruchtlos erscheinen, aber: Moderne Anwendungen wie Quantenkryptografie und Quantencomputer verdanken wir gerade auch dem Ausloten der Grenzen der Quantenmechanik und der experimentellen und theoretischen Suche nach Schlupflöchern.
Mathematisch ist alles klar, anschaulich nichts
Schon jetzt ist absehbar, dass wir im Jahr 2035 erneut ein 100-jähriges Quantenjubiläum feiern werden. Denn 1935 erweckte zum einen Schrödinger seine berühmte Katze zum Leben (oder tötete sie). Zum anderen ging ein weiteres Gedankenexperiment in die Geschichte ein, mit dem Albert Einstein und seine Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen 1935 zeigen wollten, dass die Quantenmechanik unvollständig sei: Zwei weit voneinander entfernte Teilchen könnten sich auf scheinbar unzulässige Weise gegenseitig beeinflussen. Diese Diskussionen drehten sich längst nicht mehr um die grundlegende Mathematik hinter der Theorie. Zehn Jahre nach Heisenbergs Umdeutung war das kein großes Thema mehr. Stattdessen versuchten nun alle, die Quantenmechanik zu deuten.
Während die Welt also auf das erste umfassende Konstrukt der Quantenwelt zurückblickt, sind die konzeptuellen Schwächen noch immer nicht ausgeräumt. Mathematisch gesehen ist seit 100 Jahren alles klar, anschaulich gesehen nichts. Vielleicht ändert sich das im kommenden Jahrzehnt. Es läuft eine fieberhafte Suche nach einer Theorie der Quantengravitation, die unsere fundamentalen Konzepte der größten und kleinsten Skalen verbindet. Gleichzeitig kratzen immer präzisere Experimente an den Grenzen zwischen klassischer und Quantenwelt. Damit kommen wir eventuell einer Antwort darauf näher, was Quanten eigentlich sind.
Im Jahr 2035 gibt es womöglich eine ganz neue Interpretation der Quantenmechanik. Wenn dann neue Heldengeschichten geschrieben werden, lohnt sich die Erinnerung an Heisenberg. Erkenntnis entstand schon damals nicht in Abgeschiedenheit. Die Natur offenbart nicht von selbst ihre geheimen, Schwindel erregend schönen mathematischen Formen. Wir entreißen sie ihr im Streit.
Manchmal brauchen wir eine eingängige Geschichte, um uns für etwas zu begeistern. Aber die vielschichtige Story hinter der Kurzversion verdeutlicht, was auch die Zukunft der Quantenmechanik prägen wird. Wenn Wissenschaft bereits vor 100 Jahren nur durch das Nebeneinander konkurrierender Ansätze, durch intensiven Austausch und leidenschaftlich geführte Debatten vorankam, dann gilt das umso mehr für die gegenwärtige Physik.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.