Wechseljahre: Schädigt ein Medikament gegen Hitzewallungen die Leber?
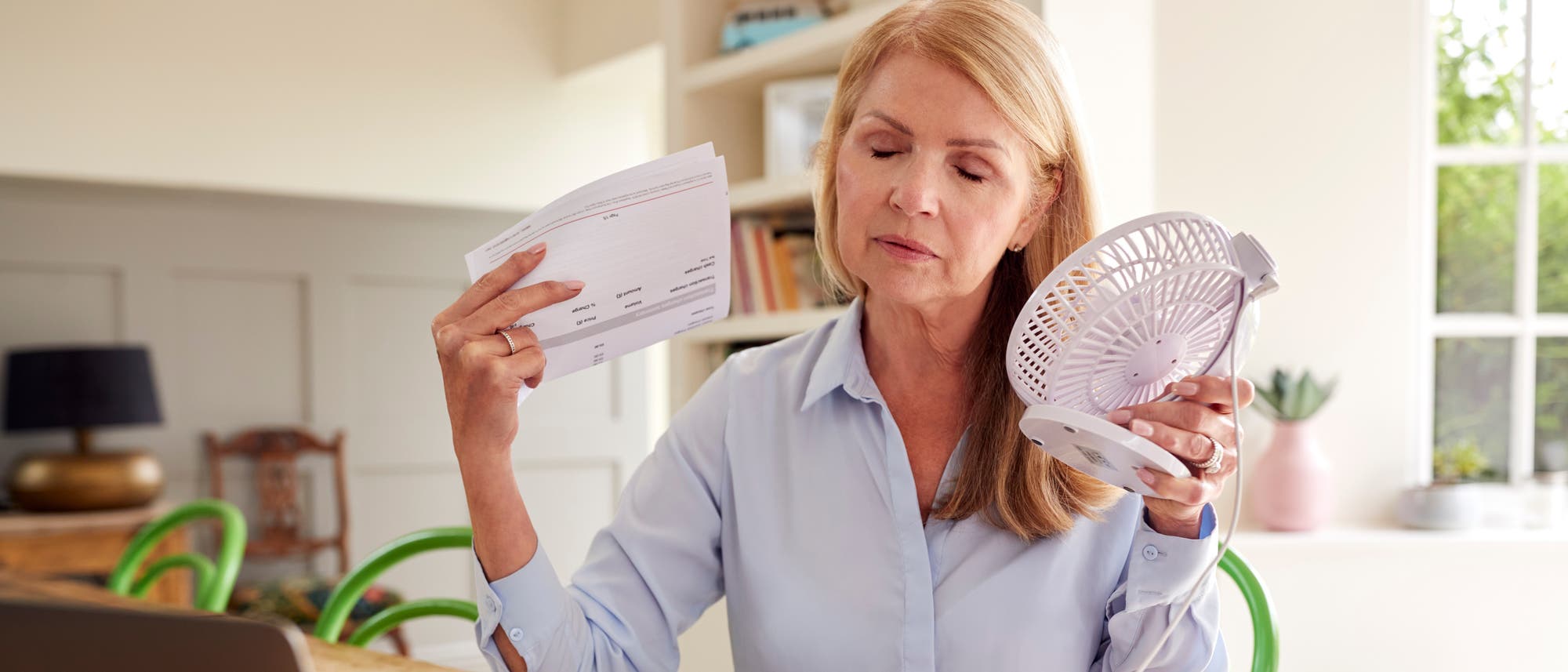
Wieder einmal fand Frauenarzt Kai Bühling einen Werbe-Flyer für das neue Medikament Fezolinetant gegen Wechseljahresbeschwerden in der Post. Darauf abgebildet war ein Feuerlöscher – offenbar sollen betroffene Frauen ihre Hitzewallungen mit dem Produkt einfach löschen können. »Ich sehe öfter Werbung von der Firma, und deren Vertreter kontaktieren mich auch direkt«, erzählt Bühling, der die Hormonsprechstunde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf leitet. »Das ändert aber nichts an meiner Meinung: Ich sehe kaum Gründe, Fezolinetant zu verschreiben – und nach den neuesten Warnungen noch weniger.« Arzneimittelbehörden haben nämlich wegen möglicher Leberschäden durch das Medikament Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.
Fezolinetant ist seit Februar 2024 in Deutschland auf dem Markt. Es wird als »neue Hoffnung« und »neue Ära der Therapie« gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren angepriesen. Denn Fezolinetant ist kein Hormon und hat nicht die typischen Nebenwirkungen einer klassischen Hormontherapie, unter anderem ein etwas erhöhtes Risiko für Thrombosen, Schlaganfälle und Brustkrebs. Die Substanz blockiert bestimmte Antennenmoleküle auf Nervenzellen des Hypothalamus im Gehirn und bringt so die wegen des abnehmenden Hormonspiegels durcheinandergeratene Temperaturkontrolle ins Lot (siehe »So wirkt Fezolinetant«).
Im Dezember 2024 bekam die Begeisterung allerdings einen Dämpfer. Nachdem eine Frau während einer Fezolinetant-Behandlung einen schweren Leberschaden erlitten hatte, veranlasste die amerikanische Zulassungsbehörde FDA, dass die Therapie nur noch unter Einschränkungen erfolgen und die Packungsbeilage bestimmte Warnhinweise enthalten solle. Anfang 2025 zog auch die europäische Zulassungsbehörde EMA Konsequenzen. Ihr war von fünf Frauen berichtet worden, bei denen im Verlauf einer Fezolinetant-Behandlung bestimmte Messwerte im Blut, die auf Leberschäden hindeuten, auf mehr als das Zehnfache des Normalen gestiegen waren. Nun muss man diese Leberwerte auch hier zu Lande vor der Behandlung sowie regelmäßig während der Therapie erfassen. Sind sie deutlich erhöht, darf die Frau das Medikament nicht nehmen beziehungsweise soll es sofort absetzen. Das Gleiche gilt, wenn sie Symptome zeigt, die auf einen Leberschaden hinweisen: ungewöhnliche Erschöpfung, Übelkeit, die Haut wird gelb und juckt, der Stuhl verfärbt sich hell und der Urin dunkel.
Die Leber hat eine hohe Regenerationsfähigkeit
»Ich finde die Vorsichtsmaßnahmen gut, aber man sollte jetzt nicht in Panik verfallen und Fezolinetant von sich aus stoppen oder per se ablehnen«, sagt Ali Canbay, Professor für Hepatologie und Direktor der Medizinischen Klinik im Universitätsklinikum Bochum. Leberwert-Erhöhungen bis auf das Doppelte seien erst einmal nicht schlimm. »Es reicht, sie alle paar Wochen zu kontrollieren.« Denn die Leber hat eine hohe Regenerationsfähigkeit und kann geschädigte Zellen rasch wieder ersetzen. Es sei dann dennoch zu überlegen, Fezolinetant abzusetzen, sagt Canbay. Sofort beenden solle man die Einnahme, wenn die Werte auf mehr als das Dreifache steigen. Denn Patienten mit solchen Auffälligkeiten haben ein hohes Risiko, an Leberschäden zu sterben, vor allem wenn noch Gelbsucht als Symptom hinzukommt.
So wirkt Fezolinetant
Fezolinetant blockiert so genannte NK3-Rezeptoren im Hypothalamus, einer Region im Gehirn, die unter anderem die Körpertemperatur reguliert. Über diese Antennenmoleküle stimuliert Neurokinin B die so genannten KNDy-Neurone, die hierbei eine wichtige Rolle spielen. Durch die sinkenden Östrogenspiegel in den Wechseljahren nimmt die bis dahin vorliegende hemmende Wirkung des Hormons ab, wodurch die KNDy-Neurone übermäßig aktiv werden. In der Folge gerät das Temperaturregulationszentrum durcheinander und veranlasst den Körper, Wärme abzugeben: Die Blutgefäße in der Haut werden erweitert, was Hitzewallungen, Nachtschweiß und gleichzeitiges Frösteln verursacht. Die NK3-Blockade bremst die überschießende Neuronenaktivität, und die Temperatur wird wieder normaler reguliert.
Zu den Leberwerten gehören unter anderem die Aspartat-Aminotransferase – abgekürzt AST – und die Alanin-Aminotransferase ALT, die wichtige Rollen im Aminosäure-Stoffwechsel spielen und deren Pegel ansteigt, wenn Leberzellen sterben. Auch der Farbstoff Bilirubin zählt dazu, der beim Abbau von alten Blutkörperchen entsteht. Der Bilirubinspiegel im Blut steigt, weil geschädigte Leberzellen den Farbstoff nicht mehr gut in die Gallenwege ausscheiden können. Bilirubin reichert sich daher an, gelangt ins Blut und wird mit dem Urin ausgeschieden, der sich deshalb bräunlich färbt. Der Stuhl bleibt hell, weil weniger Bilirubin mit der Galle in den Darm gelangt.
Erhöhte Leberwerte waren schon in den beiden Zulassungsstudien Skylight 1 und 2 aufgefallen sowie in der anschließenden Studie Skylight 4, die noch einmal speziell auf Nebenwirkungen hin geprüft hatte. Bei rund zwei Prozent der in diesen Studien behandelten Frauen stieg der Blutspiegel von AST oder ALT auf mehr als das Dreifache der Norm. Immerhin gingen die Werte in den meisten Fällen wieder zurück, entweder noch während der Therapie oder nachdem die Frauen das Medikament abgesetzt hatten. Zudem gab es keine Anzeichen für gefährliche Leberschäden. Bei der Frau in den USA, wegen der die FDA ihre Warnung aussprach, war die Situation dagegen dramatischer: Nicht nur war ihre ALT auf mehr als das Zehnfache der Norm gestiegen, auch ihr Bilirubinspiegel lag mehr als dreimal zu hoch, und sie litt unter typischen Symptomen eines schweren Leberschadens.
»Das Präparat schließt eine Lücke in unserem Therapiespektrum«Petra Stute, Vizepräsidentin der Europäischen Menopausen- und Andropausen-Gesellschaft
Warum Fezolinetant die Leber schädigen könnte, darüber lässt sich bisher nur spekulieren. Möglich sei, dass sich toxische Abbauprodukte bilden, die die Leberzellen in Mitleidenschaft ziehen, sagt Manuel Haschke, Chefarzt für Klinische Pharmakologie und Toxikologie an der Universitätsklinik Bern. Gemäß Labortests kann das Hauptabbauprodukt von Fezolinetant die Funktion der Mitochondrien stören – diese Organellen gelten als »Kraftwerke« der Zellen. Sie liefern dann mitunter nicht mehr genug Energie, woraufhin die Zellen sterben. In weiteren Untersuchungen mit Ratten und Affen wurden aber keine Leberschäden beobachtet, weshalb der Zusammenhang damals nicht weiter überprüft wurde. Anfang 2025 haben Forscher aus Indien zudem mit Computermodellen gezeigt, dass aus Fezolinetant so genannte Carben-Abbauprodukte entstehen können. »Diese Stoffe könnten sich direkt mit Eiweißen in der Leberzelle verbinden, dadurch wird die Funktion der Leberzelle beeinträchtigt und sie kann zu Grunde gehen«, erklärt Haschke.
Petra Stute, Vizepräsidentin der Europäischen Menopausen- und Andropausen-Gesellschaft, warnt allerdings davor, Fezolinetant vorschnell zu verteufeln. »Das Präparat schließt eine Lücke in unserem Therapiespektrum.« Es sei nämlich eine Alternative für Frauen, die Hormone nicht einnehmen wollen oder dürfen, etwa weil sie früher eine Thrombose hatten oder eine hormonabhängige Krebserkrankung. »Aus Panik Fezolinetant nicht zu verschreiben, halte ich für übertrieben.« Jeder Frauenarzt und jede Frauenärztin müssten aber penibel auf die empfohlenen Laborkontrollen achten.
Sogar Placebos scheinen zu helfen
Frauenarzt Bühling aus Hamburg bleibt dagegen skeptisch: »Wir haben andere hormonfreie Alternativen.« Helfen könnten zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie, Extrakte aus der Traubensilberkerze, Isoflavone oder Medikamente, die sonst gegen Depressionen oder Epilepsie eingesetzt werden. Sogar Placebos scheinen zu nützen: In den Fezolinetant-Studien sank die Häufigkeit der Hitzewallungen von im Schnitt elf auf vier pro Tag, aber in der Placebogruppe immerhin auch von elf auf sechs. Erwäge eine Frau die Einnahme von Fezolinetant nur deshalb, weil sie Hormone per se ablehnt, würde er sich das an ihrer Stelle gut überlegen, sagt Bühling. Anders als Hormonpräparate lindert es nämlich keine anderen wechseljahresbedingten Beschwerden wie Schlafstörungen oder Stimmungsveränderungen und schützt auch nicht die Knochen vor Osteoporose.
»Wir haben andere hormonfreie Alternativen«Kai Bühling, Frauenarzt
Außerdem erscheinen die Risiken einer Hormontherapie begrenzt: In einem Zeitraum von fünfeinhalb Jahren erkrankten von 10 000 Frauen mit Östrogen-Gestagen-Tabletten statistisch gesehen 51 mehr an Brustkrebs, 52 mehr an einem Schlaganfall und 120 mehr an einer Thrombose als bei 10 000 Frauen ohne Hormone.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.