Quantenmechanik: Ist die Quantenphysik auf imaginäre Zahlen angewiesen?
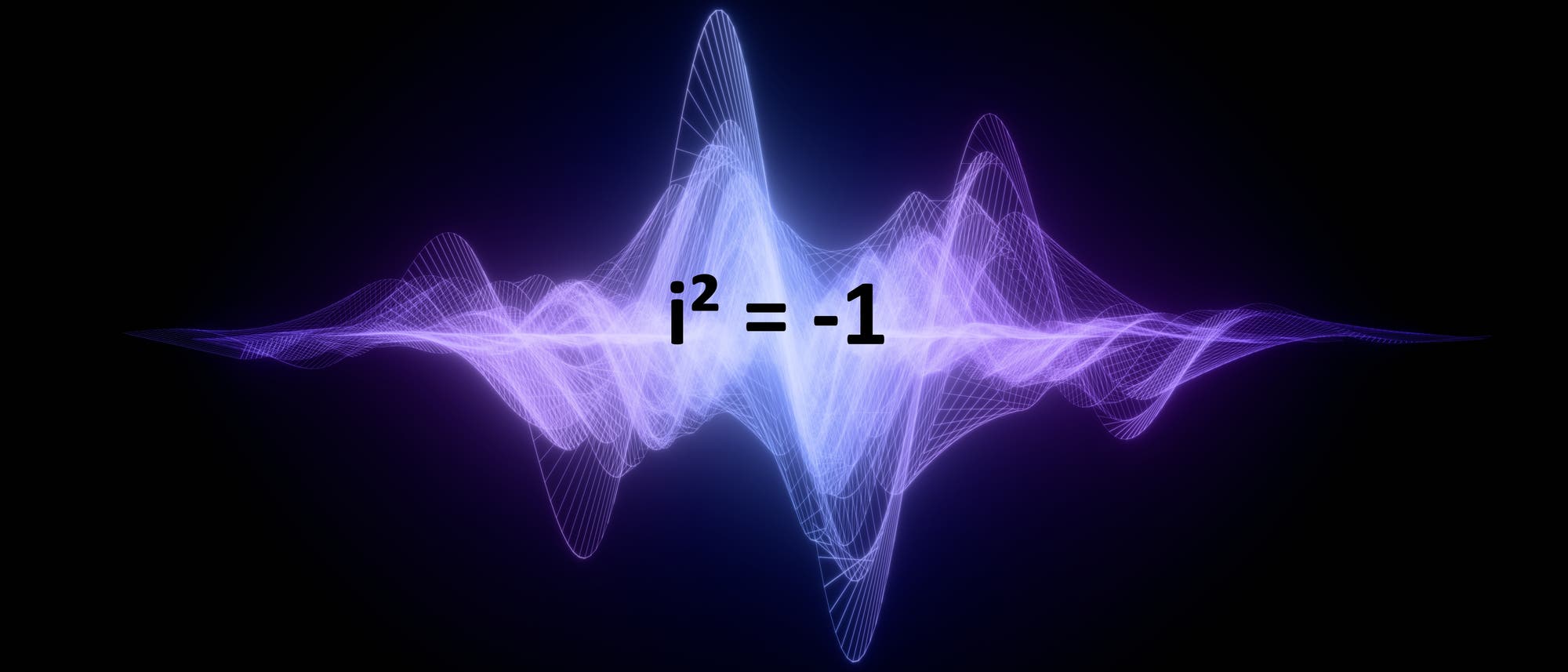
Vor rund 100 Jahren offenbarte sich erstmals das seltsame Verhalten von Atomen und Elementarteilchen. Das veranlasste Fachleute, eine grundlegend neue Theorie der Natur zu formulieren. Diese Theorie, die Quantenmechanik, hatte sofort Erfolg. Sie bewies ihren Wert mit Vorhersagen für experimentelle Befunde, etwa die Emission und Absorption von Licht durch Wasserstoff. Es gibt allerdings einen Haken. Die zentrale Gleichung der Quantenmechanik enthält die imaginäre Zahl i, die Quadratwurzel aus –1.
Physikerinnen und Physiker wissen, dass i nichts weiter als ein mathematisches Hilfskonstrukt ist. Reale Größen wie Masse und Geschwindigkeit ergeben quadriert niemals einen negativen Betrag. Und dennoch scheint diese unwirkliche Zahl, die sich wie i2 = –1 verhält, das Herzstück der Quantenwelt zu sein.
Nachdem Erwin Schrödinger die nach ihm benannte Gleichung mit dem i hergeleitet hatte – im Wesentlichen das Bewegungsgesetz für Quanten –, hoffte er, sie durch eine reelle Version ersetzen zu können, ganz ohne i. Doch die imaginäre Formulierung der Schrödingergleichung setzte sich durch, und neue Generationen von Physikerinnen und Physikern übernahmen sie ohne große Bedenken.
Im Jahr 2021 erregte die Rolle der imaginären Zahlen in der Quantenphysik neues Interesse, als ein Team einen Weg vorschlug, um die Bedeutung von i in der Quantenwelt empirisch zu testen. Kurze Zeit später führten zweiForschungsgruppen die komplizierten Experimente durch – und fanden vermeintliche Beweise dafür, dass die Quantenphysik nicht ohne i auskommt.
Aber nun wurde diese Schlussfolgerung offenbar durch mehrere Forschungsarbeiten widerlegt. Im März 2025 legte eine deutsche Gruppe eine reelle Version der Quantentheorie vor, die mit der Standardversion übereinstimmt. Zwei französische Physiker folgten mit einer eigenen reellen Quantentheorie. Und im September 2025 betrachtete ein weiterer Forscher das Problem aus Sicht der Quanteninformatik und kam zum gleichen Schluss: i sei für die Beschreibung der Quantenrealität nicht notwendig.
Obwohl die reellen Theorien die explizite Verwendung von i vermeiden, behalten sie die Merkmale der imaginären Arithmetik bei. Das führte zu Diskussionen darüber, ob der imaginäre Aspekt der Quantenmechanik – oder gar der Realität selbst – wirklich widerlegt ist.
Eine unvorstellbare Größe
Amsterdam, 1637: der Höhepunkt der Tulpenmanie, einer der ersten Spekulationsblasen der Geschichte. Damals beschäftigte sich der Gelehrte René Descartes statt mit überteuerten Blumenzwiebeln mit anderen befremdlichen Zahlen. Er arbeitete an Gleichungen, deren Lösungen unmögliche Werte aufweisen. Am Beispiel von x3 – 6x² + 13x – 10 = 0 schrieb Descartes, dass die Lösungen »nicht immer real sind, sondern manchmal nur imaginär. Es gibt manchmal keine Größe, die dem entspricht, was man sich vorstellt.« Die drei Zahlen, die man für x einsetzen kann, sind 2, 2 – i und 2 + i. Die beiden letztgenannten Werte, die je einen reellen und einen imaginären Anteil besitzen, werden als komplexe Zahlen bezeichnet.
Descartes betrachtete sie mit Spott. Trotzdem wurden komplexe Zahlen später wegen ihres Nutzens in so unterschiedlichen Bereichen wie Geometrie, Optik und Signalanalyse übernommen.
Und auch Schrödinger erkannte zähneknirschend ihren Nutzen in der Quantentheorie an. Seine Gleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung von Wellenfunktionen und codiert damit die möglichen Quantenzustände eines Objekts. Schrödingers Wellenfunktion ist zwar komplexwertig, doch die Messgrößen eines Quantensystems sind stets reell. »Die Quantentheorie ist die erste physikalische Theorie, bei der die komplexen Zahlen zentral erscheinen«, sagt der Quantenphysiker Bill Wootters vom Williams College in Massachusetts.
Komplexe Zahlen der Form a + ib lassen sich als Punkt in einer Ebene darstellen, wobei a die Position auf der x-Achse ist (die man sich als die reelle Zahlengerade vorstellen kann) und b die Position auf einer imaginären y-Achse. Jede komplexe Zahl ist demnach ein Pfeil, ein sogenannter Vektor, der vom Ursprung zur komplexen Koordinate (a, b) zeigt. Diese komplexwertigen Vektoren gehorchen der ungewohnten Arithmetik der komplexen Zahlen: Multipliziert man beispielsweise mit i, so wird der Vektor um 90 Grad gedreht.
Durch diese Eigenschaften eignen sich komplexe Zahlen besonders gut, um Wellenfunktionen zu beschreiben. Denn diese sind ebenfalls Vektoren, die den ungewöhnlichen Kombinationsregeln gehorchen.
Im Lauf der Jahrzehnte versuchten Physiker und Physikerinnen immer wieder, reellwertige Vektoren für die Quantenmechanik zu definieren. 1960 entwickelte der Schweizer Mathematiker Ernst Stückelberg erstmals eine reelle Quantentheorie. Dafür nutzte er einige Tricks, um reelle Zahlen dazu zu bringen, die Drehungen um eine imaginäre Achse nachzuahmen. Doch während die komplexe Formulierung kompakt ist, erscheint die reelle Theorie schwerfällig. Zum Beispiel umfasst die Wellenfunktion zweier Teilchen nur vier komplexe Zahlen – in Stückelbergs Formalismus sind es 16 reelle Zahlen.
In den Jahren 2008 und 2009 zeigten zwei Forschungsgruppen, dass die reelle Quantentheorie die Ergebnisse der sogenannten Bell-Tests reproduzieren kann. Diese sind eine Art Fingerabdruck für die Quanteneigenschaften eines Systems. »Für viele Dinge kann man tatsächlich mit einer reellen Theorie auskommen«, sagt Wootters. Aber würde sie immer die gleichen Ergebnisse liefern wie die komplexe Version?
Bellsche Ungleichungen
1935 formulierten die drei Physiker Albert Einstein, Boris Podolsky and Nathan Rosen ein Gedankenexperiment. Mit diesem argumentierten sie, die Quantenmechanik sei zwar korrekt, aber unvollständig. Demzufolge müsse es versteckte Variablen geben, die aus der Quantenphysik eine klassische, deterministische Theorie machen.
Als John Stuart Bell in den 1960er Jahren auf die Arbeit von Einstein, Podolsky und Rosen stieß, schrieb er ein paar algebraische Gleichungen nieder, die in die Geschichte eingingen: die berühmten bellschen Ungleichungen. Mit diesen lässt sich mathematisch beweisen, dass die Quantenphysik grundlegend anders ist als klassische Theorien – und dass die Natur offenbar den wirren Quantenregeln folgt.
Bell beschrieb in seiner Arbeit folgendes Experiment: Die zwei Physiker Alice und Bob befinden sich in verschiedenen Laboren. Charlie, der sich auf halber Strecke zwischen beiden befindet, sendet ihnen jeweils ein Elektron zu. Alice und Bob vermessen dann jeweils den Spin des Teilchens – eine quantenmechanische Eigenschaft, die wie ein Magnet entweder nach oben (Nordpol) oder nach unten (Südpol) ausgerichtet ist.
Charlie verschränkt die beiden Teilchen miteinander, bevor er sie an Alice und Bob sendet. Das heißt: Falls das von Alice empfangene Elektron einen nach oben ausgerichteten Spin hat, ist es bei Bob genauso. Die beiden Physiker erhalten demnach immer das gleiche Messergebnis. Allerdings könnten die Messapparaturen der beiden Experimentatoren unterschiedlich ausgerichtet sein: Alice könnte den Spin des Elektrons bezüglich der x-Achse messen, während Bob die y-Achse nutzt. Oder sie könnten eine um 45 Grad gekippte Achse wählen. Die Ausrichtung der Messapparatur beeinflusst die Ergebnisse, die Alice und Bob erzielen.
Wenn man nun davon ausgeht, dass der Quantenphysik eine klassische Theorie zugrunde liegt, dann befindet sich jedes Elektron vor der Messung in einem eindeutigen Zustand bezüglich der drei Messachsen, zum Beispiel: (oben, rechts, rechts oben) oder (oben, links, rechts oben). Insgesamt kann ein Teilchen in diesem Experiment acht verschiedene Zustände annehmen (je zwei pro Achse). Diese klassischen Zustände lassen sich in einem Venn-Diagramm verzeichnen.
Da Alice und Bob jeweils lediglich eine Messung bezüglich einer Achse durchführen können, kann man nur die Wahrscheinlichkeiten für die Ausgänge der Messungen aus je zwei Bereichen der Venn-Diagramme ermitteln (hellblau, siehe Bild unten).
Aus den Messungen gehen folgende Ergebnisse hervor: Wenn Alice und Bob sich für Messausrichtungen entscheiden, die senkrecht zueinander stehen (also die waagerechte und senkrechte Achse), dann stimmen ihre Messungen mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit überein. Falls sie aber jeweils um 45 Grad gekippte Achsen nutzen, dann stimmen die Ergebnisse in 85 Prozent der Fälle überein. Grafisch lässt sich das durch die Venn-Diagramme folgendermaßen darstellen:
Die Messergebnisse erzeugen aber einen Widerspruch zur klassischen Theorie (die durch die Venn-Diagramme veranschaulicht wird). Denn die hellblau markierten Flächen des Diagramms sollten aus klassischer Sicht die eingezeichneten Ungleichungen erfüllen. Die Messergebnisse (in Prozent eingezeichnet) passen jedoch nicht zu den Ungleichungen.
Daraus lässt sich folgern, dass die Teilchen keinen festgelegten Zustand innehaben können, bevor Alice und Bob sie messen. Die bellschen Ungleichungen veranlassten Physikerinnen und Physiker, das klassische Bild aufzugeben und eine quantenmechanische Sichtweise zu akzeptieren: Elektronen können bis zu ihrer Messung überlagerte Zustände annehmen und miteinander verschränkt sein – zwei Phänomene, die klassische Theorien nicht erfassen können.
Prüfung der Quanteneigenschaften
2021 erkannte eine Gruppe von Physikern um Nicolas Gisin von der Universität Genf, dass sie die Grenzen der reellen Theorien testen könnten, wenn sie den Standard-Bell-Test erweiterten.
Bei Bell-Tests wird in der Regel ein Paar verschränkter Teilchen erzeugt: Teilchen, deren Zustände miteinander verbunden sind und die sich daher nur durch eine gemeinsame Wellenfunktion beschreiben lassen. Das heißt, die Eigenschaften verschränkter Teilchen, etwa die Polarisation von Photonen, hängen unmittelbar voneinander ab. Im Bell-Test werden die verschränkten Teilchen getrennt und an zwei Experimentatoren geschickt, Alice und Bob, die ihre Polarisationen messen und die Ergebnisse miteinander vergleichen.
Statt dieser Version konzipierte das Team um Gisin einen Bell-Test mit zwei separaten Quellen verschränkter Teilchen und drei Experimentatoren: Alice, Bob und Charlie. Seinen Berechnungen zufolge sollte es eine Obergrenze für die Korrelation der Polarisationen der verschränkten Teilchen bei einer reellen Quantentheorie geben – bei der komplexen Quantentheorie würde diese Grenze hingegen höher liegen. Das eröffnete erstmals einen Weg für einen empirischen Test, der die reelle Quantenmechanik ausschließen könnte.
Bald darauf führte eine Gruppe an der University of Science and Technology of China (USTC) in Hefei das Experiment durch und stellte fest, dass die beobachteten Korrelationen zwischen verschränkten Photonen die Grenze einer reellwertigen Theorie weit überschritten. Komplexe Zahlen schienen für die Beschreibung dieser Quantenzustände unerlässlich. Doch das hat nicht alle überzeugt.
Ein neues Vektorprodukt
»Komplexe Zahlen sind einfach zwei reelle Zahlen mit bestimmten Rechenregeln«, sagt der Physiker Michael Epping vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Autor der neuen Arbeit. »Warum sollte man die Quantenmechanik nicht einfach mit reellen Zahlen beschreiben können?«
Mischa Woods von der École normale supérieure in Lyon und Timothée Hoffreumon von der Universität Paris-Saclay, Autoren der neuen französischen Arbeit, waren ebenfalls skeptisch. Gisin und seine Kollegen trafen 2021 eine Annahme über das »Tensorprodukt«, eine mathematische Operation, die komplexe Vektoren zu einem verschränkten Zustand zusammenfügt. Die Forscher nahmen an, dass eine reelle Quantentheorie die gleiche mathematische Formulierung des Tensorprodukts verwenden würde, um Zustände zu kombinieren.
Die französischen und deutschen Teams argumentieren allerdings, dass diese Form des Tensorprodukts die falsche Regel für eine reelle Theorie ist. Das ist nicht unbedingt abwegig. Ein Beispiel: Im flachen Raum ist die Hypotenuse c eines rechtwinkligen Dreiecks durch a² + b² = c² gegeben. Diese Regel gilt jedoch nicht für ein Dreieck im gekrümmten Raum, etwa auf einer Kugeloberfläche. Tatsächlich könnte auch das Standard-Tensorprodukt ein Spezialfall einer allgemeineren Klasse von Vektorkombinationsregeln sein. Die beiden Forschungsteams entwickelten verschiedene Regeln, um reelle Quantentheorien zu schaffen, die dieselben Vorhersagen liefern wie eine komplexe Quantentheorie.
Reelle Quantencomputer
Eine neue Entwicklung in der Quanteninformatik zeigt ebenfalls, dass man ohne komplexe Zahlen auskommt. Quantencomputer verwenden logische Gatter, um Quantenbits zu verarbeiten. Ein gängiges Logikgatter, das sogenannte T-Gatter, wirkt auf den Vektor, der den Zustand des Quantenbits repräsentiert, wie eine Drehung in der komplexen Ebene. Und damit erinnert er an die Multiplikation mit imaginären Werten. Im September 2025 hat der Programmierer Craig Gidney von Google Quantum AI einen Weg gefunden, T-Gatter aus jedem Quantenalgorithmus zu entfernen – und damit bewiesen, dass Quantencomputer keine komplexen Zahlen erfordern.
Dennoch werfen reelle Quantentheorien noch viele Fragen auf. Zum Beispiel, warum diese Versionen so viel komplizierter sind. Das beschäftigt Forschende seit den Anfängen der Quantenmechanik. Schrödinger versuchte, mit einer reellen Wellengleichung zu arbeiten, entschied sich dann aber für die komplexe Variante, weil sie deutlich einfacher war.
»Wir simulieren komplexe Zahlen mithilfe von reellen Zahlen«Anton Trushechkin, Physiker
Nun scheint es so, als ob die Quantentheorie nicht auf i angewiesen ist. Doch die Einfachheit, die es mit sich bringt, hat etwas Natürliches. »Die komplexe Quantentheorie mit ihrem Tensorprodukt ist nach wie vor weitaus prägnanter, eleganter und mathematisch einfacher«, so der Physiker Chao-Yang Lu vom USTC, der Gisins vorgeschlagenen Bell-Test umgesetzt hat. Und auch Wootters sagt: »Selbst wenn man die Quantentheorie in reelle Zahlen übersetzt, sieht man immer noch die Merkmale der komplexen Zahlenarithmetik.«
Selbst diejenigen, die die Theorie von den komplexen Zahlen befreit haben, geben zu, dass diese eine natürliche Ergänzung darstellen. Die reellen Quantentheorien enthalten zwar kein i, aber sie kopieren dessen Fähigkeit, Vektoren zu drehen. »Wir simulieren komplexe Zahlen mithilfe von reellen Zahlen«, sagt der Physiker Anton Trushechkin von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.