Konsumsucht: Warum kaufen wir so viel Zeug?
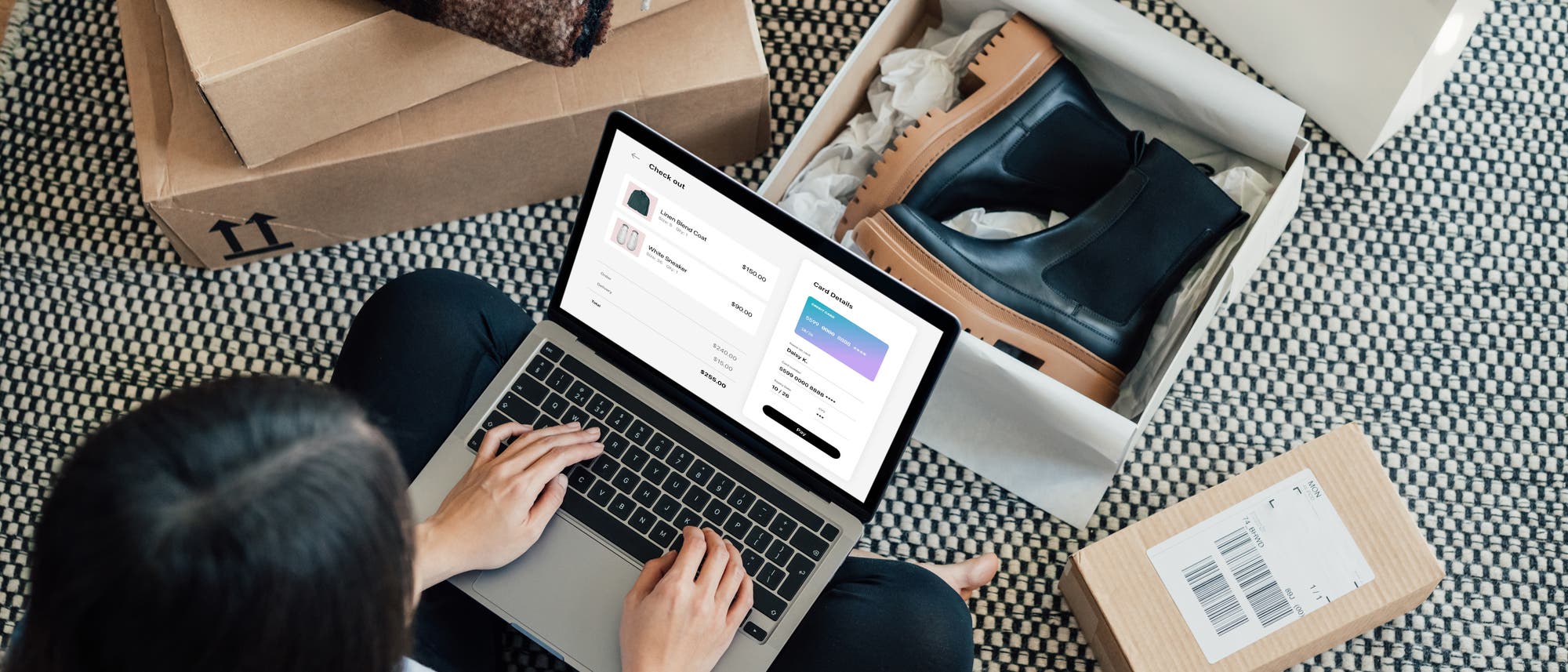
Seit Jahren versteckt Sadie ihr Problem vor ihrer Familie. Tagsüber arbeitet sie als Einkäuferin bei einem Forschungsunternehmen und gibt Bestellungen im Wert von vielen Millionen US-Dollar auf. Nach Feierabend ordert sie dann wahllos Dinge für sich selbst: Kameras samt Zubehör, Bastelmaterial, Metalldetektoren, Laser, Brettspiele, Kalender, Füllfederhalter, Technik-Gadgets, Nagellacke, Tastaturen für Computer, Nähgarn. All das bestellt sie online. Und plötzlich hat sie 20 000 Dollar Schulden – ohne genau zu wissen, wie es dazu kommen konnte.
»Ich konnte es selbst kaum fassen«, sagt sie. »Meinem Mann habe ich nie erzählt, wie schlimm es wirklich ist.« Nun versucht sie, ihre Schulden nach und nach zurückzuzahlen. Wie viel sie noch begleichen muss, weiß sie nicht genau. »Ich schäme mich so sehr, dass ich nicht aufs Konto schaue«, sagt sie. Sadie will anonym bleiben, aus Angst, ihre Familie könnte erfahren, dass sie kaufsüchtig ist.
Schon 1899 beschrieb der deutsche Psychiater Emil Kraepelin eine »krankhafte Kauflust«. Heute befürchten Fachleute allerdings, das Problem könnte neue Dimensionen annehmen. Onlineplattformen wie Amazon, Temu oder Shein gewinnen immer mehr an Popularität. Einige setzen gezielt auf Gamification-Elemente, spieleähnliche Funktionen, die zum ständigen Weiterkaufen verleiten. 2024 kündigte die Europäische Kommission an, Temus Geschäftsmodell genauer unter die Lupe nehmen zu wollen, unter anderem wegen potenziell abhängig machender Designelemente.
Mit dem Boom des Onlinehandels setzen Unternehmen zunehmend auf raffinierte psychologische Tricks, um ihre Kundschaft bei der Stange zu halten. Das Internet habe eine alltägliche Handlung in etwas verwandelt, das »einer Droge ähnelt«, sagt Anna Lembke, Psychiaterin an der Stanford University in Kalifornien und Autorin mehrerer populärer Bücher über Abhängigkeit. »Plötzlich betrifft es die breite Masse.«
Das Problem besteht auf der ganzen Welt. Forschende haben suchtähnliches Kaufverhalten in vielen Ländern untersucht, etwa den USA, Deutschland, der Türkei, Polen, Indien, Brasilien und Südkorea. In Pakistan sind laut einer Studie von Saman Attiq und ihrem Kollegen Moin Ahmad Moon rund ein Drittel der Studierenden betroffen. Sie kaufen sowohl in klassischen Geschäften als auch auf Onlineplattformen. Besonders kritisch ist die Situation in China. Der Marketingforscher Heping He von der Universität Shenzhen führte eine Befragung durch, bei der sich zeigte: Rund 29 Prozent der chinesischen Bevölkerung leiden unter einer Kaufstörung.
Kaufsucht ist keine eigenständige Diagnose
He ist einer von vielen Forschenden weltweit, die untersuchen, wie häufig suchtähnliches Kaufverhalten ist, welche Hirnmechanismen dabei eine Rolle spielen und wie es mit ähnlichen Störungen zusammenhängt. Die Schwierigkeit: Kaufsucht – auch zwanghaftes Einkaufen genannt – ist bislang keine eigenständige Diagnose. Diese wäre wichtig, um die Forschung voranzutreiben und gesetzliche Regulierungen durchzusetzen.
Suchtähnliches Kaufverhalten gibt es vermutlich schon so lange wie Geld und Märkte. Doch das Internet hat Shopping bequemer denn je gemacht. »Bevor sich der Onlinehandel in China durchgesetzt hat, war krankhaftes Einkaufen kein großes Thema«, sagt He. Heute hat China »einen der weltweit stärksten Onlinemärkte«. Zusammen mit einer »materialistischen Konsumkultur« habe das zu einer regelrechten Kaufsucht-Epidemie geführt.
Lange galt der krankhafte Konsum als ein Problem, das vor allem Frauen betrifft. Doch nicht alle Studien zeigen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, vor allem nicht bei den Jüngeren. In China, so He, schließt sich die Lücke zwischen Männern und Frauen. Seit der Internethandel boomt, entdecken immer mehr Männer den Onlinemarkt für sich.
Obwohl Studien zeigen, dass suchtähnliches Kaufverhalten längst kein Randphänomen mehr ist, taucht es in den beiden wichtigsten Diagnosemanualen bislang nicht auf – weder in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (ICD) noch im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM). Viele Fachleute fordern, das zu ändern. Nur so, sagen sie, könnten Betroffene Hilfe erhalten.
Ein Grund, warum Kaufsucht bisher keine offizielle Diagnose ist: Man ist sich nicht einig, was die Ursachen sind. Forschende diskutieren, ob es sich um eine Störung der Impulskontrolle handelt, um ein zwanghaftes Verhalten ähnlich einer Zwangsstörung, oder um eine Verhaltenssucht, die das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert, so wie Alkohol und andere Drogen. Viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, wünschen sich daher mehr Studien. Dennoch setzt sich unter Fachleuten zunehmend das Suchtmodell durch – auch, weil Verhaltenssüchte bereits breit akzeptiert sind. So wurde etwa die Glücksspielsucht, die dem pathologischen Kaufen in vielerlei Hinsicht ähnelt, 2013 in die fünfte Ausgabe des DSM aufgenommen und dort auf eine Stufe mit den Substanzabhängigkeiten gestellt.
Laut Lembke rutscht man in eine Kaufsucht ganz ähnlich wie in andere Abhängigkeiten. »Am Anfang machen es die Menschen, um Spaß zu haben oder um ein Problem zu lösen, etwa um mit Angst, Einsamkeit, einer Depression oder Langeweile klarzukommen.« Wenn das für sie funktioniert, machen sie damit weiter, und zwar so lange, bis es »ihr Gehirn verändert« und sie nicht mehr aufhören können, selbst wenn sie sich verschulden oder sogar Beziehungen zu Familienmitgliedern zerstören.
Das Gehirn in Kauflaune
Einige bildgebende Studien stützen die Theorie, dass es sich um eine Form der Abhängigkeit handelt. Patrick Trotzke, Psychologe an der Charlotte Fresenius Hochschule in Köln, hat die Hirnaktivität von 18 Menschen, die wegen ihres Kaufverhaltens in Behandlung waren, mit der von 18 Kontrollpersonen verglichen. Er zeigte ihnen Bilder von Einkaufszentren, Einkaufstaschen und begehrten Konsumgütern wie Handtaschen oder elektronischen Geräten. Bei den Betroffenen aktivierten diese das Striatum im Belohnungssystem, eine Region, die auch bei Drogenabhängigkeit eine Rolle spielt. »Sie geraten geradezu in Hochstimmung, wenn man ihnen solche Bilder zeigt«, sagt Trotzke. »Das dopaminerge Belohnungssystem steht dann regelrecht unter Strom.« Die Kontrollinstanz im Präfrontalkortex werde dadurch geschwächt, sodass die Betroffenen nicht widerstehen können.
Ein weiterer Hinweis darauf, dass das dopaminerge Belohnungssystem beim suchtähnlichen Kaufverhalten eine Rolle spielt, kommt von Menschen mit Morbus Parkinson, die Medikamente einnehmen, die auf genau diesen Teil des Gehirns wirken – und die daraufhin unkontrolliert einkaufen. In einem Fallbericht nahm ein Patient mehr Medikamente ein als verordnet und erschien in bunter Kleidung und mit drei goldenen Halsketten. Es stellte sich heraus, dass er mehr als 5000 Taschenuhren und 42 alte, nicht mehr fahrtaugliche Autos gekauft hatte.
2021 befragte eine Gruppe um Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover 138 Fachleute aus 35 Ländern, wie sich der unkontrollierbare Kaufdrang diagnostisch am besten erfassen lässt. Sie nutzten die sogenannte Delphi-Methode, ein anonymisiertes, mehrstufiges Verfahren, das verhindern soll, dass einzelne Forschende zu viel Einfluss nehmen. Unterm Strich waren sich die Befragten einig: Es handelt sich um eine eigenständige, suchtähnliche Störung. Sie einigten sich auf die Bezeichnung »Compulsive Buying Disorder«, zu Deutsch: zwanghafte Kaufstörung. Müller entwickelte daraufhin eine Liste mit Diagnosekriterien. Dazu zählen: ein starker innerer Drang zu kaufen; Kontrollverlust; das Anhäufen von Dingen, die man gar nicht benutzt; die Suche nach dem nächsten Kick; der Versuch, durchs Kaufen unangenehme Gefühle zu verdrängen – und schließlich die negativen Folgen im Alltag.
Die Vorstellung, dass man entweder kaufsüchtig ist oder nicht, greift aber wohl zu kurz. »Es handelt sich um eine Spektrum-Störung, so wie bei Drogen- und Alkoholabhängigkeit«, sagt Lembke. »Manche Menschen haben nur ein kleines Shoppingproblem, bei anderen ist es richtig ernst: Sie verschulden sich massiv und verlieren am Ende sogar ihre wichtigste Beziehung.«
In einer Studie von 2020 teilte eine Gruppe um die Psychologin Mareike Augsburger von der Universität Zürich über 1000 Menschen aus der Schweiz in verschiedene Käufergruppen ein, darunter Kategorien wie »riskant« und »abhängig«. Das Forschungsteam schätzte, dass rund drei Prozent der Teilnehmenden tatsächlich süchtig nach Onlineshopping waren. Elf Prozent stufte es als gefährdet ein, weil sie Aussagen zustimmten wie »Ich denke die ganze Zeit darüber nach, etwas zu kaufen« oder »Ich kaufe, um meine Stimmung zu verändern«.
Bildgebende Studien wie die von Patrick Trotzke eignen sich nicht zur Diagnosestellung, denn Einkaufen ist für viele Menschen ein Stück weit belohnend. »Ich kaufe gern Dinge«, sagt er, »und wenn man mir etwas zeigt, was man kaufen kann, feuert auch mein Belohnungssystem.«
Für Kaufsucht gibt es wenig Behandlungsansätze
Laut Trotzke ist die kognitive Verhaltenstherapie bislang die einzig nachweislich wirksame Behandlungsmethode. Nur wenige Studien haben andere therapeutische oder medikamentöse Ansätze untersucht. Bisher weiß man kaum etwas darüber, inwiefern die Gestaltung der Einkaufsumgebung problematisches Kaufverhalten auslösen oder verstärken kann.
Maèva Flayelle und Joël Billieux erforschen Verhaltenssüchte an der Universität Lausanne in der Schweiz. Sie wollen mit ihrer Arbeit den Blick weg vom Individuum und hin zu Websites und Apps lenken. Diese brächten ihre Nutzerinnen und Nutzer schnell »an die Grenzen der Selbstkontrolle«, so Flayelle. Wenn etwa Shopping und Social Media miteinander verknüpft sind, wenn man für Käufe Punkte erhält oder Rabatte gewinnen kann, verleitet das Menschen, die dafür besonders empfänglich sind, dazu, immer mehr zu kaufen. Eine ähnliche Wirkung haben Timer, die Kaufdruck erzeugen, oder Apps, die Ratenzahlungen anbieten.
In manchen Videospielen tauchen sogenannte Lootboxen auf. Wer sie öffnen will, muss zahlen und erhält dafür einen – mit etwas Glück wertvollen – digitalen Gegenstand, der an andere Spielerinnen und Spieler weiterverkauft werden kann. Lootboxen verbinden Videospiel, Shopping und Glücksspiel, eine für manche Menschen nahezu unwiderstehliche Mischung. Anders als bei klassischen Spielautomaten existieren für Lootboxen keine gesetzlichen Regulierungen.
2024 forderte der Europarat die Videospielindustrie in einem Positionspapier dazu auf, mehr Verantwortung für die Schäden zu übernehmen, die ihre Produkte anrichten, und sprach sich für effektive gesetzliche Maßnahmen aus. Doch, so Flayelle, »wir stehen wirklich ganz am Anfang«. Die Onlinemärkte entwickeln sich so schnell, dass Forschung und Gesetzgebung kaum hinterherkommen.
Anna Lembke hat an akademischen Diskussionen teilgenommen, in denen es darum ging, dass Werbung auf Websites für Jugendliche verboten werden sollte. Ein Vorschlag, der in den USA auf Widerstand stoßen dürfte, vor allem, nachdem die Regierung unter Präsident Trump angekündigt hat, Regulierungen abbauen zu wollen. In China, sagt He, sind Händler ohnehin »eher geneigt, den Konsum anzukurbeln, statt etwas gegen Kaufsucht zu unternehmen«.
Mit der Kaufsucht alleingelassen
Wenn Länder keine klaren Regeln einführen, könnten Handelsbeschränkungen den globalen Onlinemärkten spürbar zusetzen. Die Europäische Kommission will nicht nur das potenziell süchtig machende Design von Temu untersuchen. Im Februar 2025 kündigte sie außerdem an, prüfen zu wollen, ob sogenannte Billigimporte schädlich oder gefälscht sind. Täglich gelangen laut Kommission rund zwölf Millionen Pakete in den EU-Raum – dreimal so viele wie 2022.
Derzeit sind Shopping-Süchtige auf sich allein gestellt. Manche holen sich professionelle Hilfe, andere versuchen aus eigener Kraft, mit dem Kaufen aufzuhören. In sozialen Netzwerken wie Reddit haben sich Gemeinschaften von Betroffenen gebildet, die ihre Geschichten teilen und sich gegenseitig dabei unterstützen, ihr Verhalten zu ändern. Sadie, die inzwischen als Moderatorin in einem solchen Forum aktiv ist, hat ihren Konsum stark reduziert. »Mein Blick auf die Welt und meine Prioritäten haben sich verändert«, sagt sie. Nicht mehr endlos durch Produkte zu scrollen, war wie eine Offenbarung für sie. »Wir alle rennen im Hamsterrad dem Dopaminschalter hinterher.«
Wege aus der Sucht
Kaufen Sie auch oft mehr, als Sie eigentlich wollten? Möchten Sie damit aufhören, schaffen es aber nicht? Dann wenden Sie sich bitte an Anlaufstellen, die helfen können, zum Beispiel an Suchtberatungsstellen oder an niedergelassene Psychotherapeuten oder Psychiater. Kontakte vermitteln auch Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und in akuten psychischen Krisen der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117.
Die Telefonseelsorge berät rund um die Uhr, anonym und kostenfrei: per Telefon unter den bundesweit gültigen Nummern 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie per E-Mail und im Chat auf der Seite www.telefonseelsorge.de. Kinder und Jugendliche finden auch Hilfe unter der Nummer 0800 1110333 und können sich auf der Seite www.u25-deutschland.de per E-Mail von einem Peer beraten lassen.


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.