Künstliche Biomoleküle: KI-Halluzinationen erzeugen neuartige Proteine
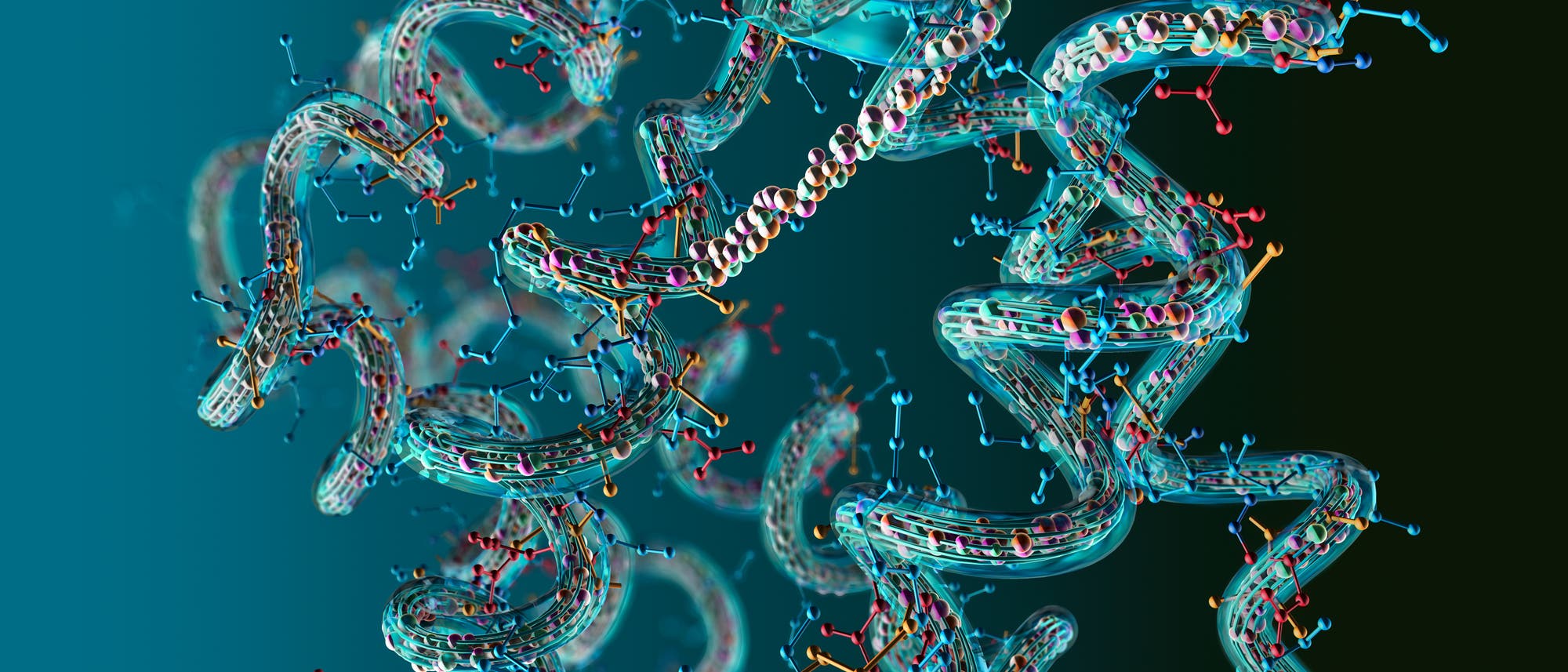
Eine neue, auf mehreren KI-Systemen basierende Technik nutzt die Halluzinationen von selbstlernenden Algorithmen, um völlig neue, funktionsfähige Proteine zu konstruieren. Das von einem Team um Kashif Sadiq vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg entwickelte »AlphaDesign« erzeugte in ersten Experimenten einen funktionierenden Hemmstoff für ein bakterielles Verteidigungssystem. Wie die Arbeitsgruppe in der Fachzeitschrift »Molecular Systems Biology« schreibt, blockierten 17 der 88 mit dem System generierten Proteine auch in Experimenten das Zielprotein RcaT. Zusätzlich erzeugte AlphaDesign auch Proteine mit zwei Bindungsstellen oder solche, die für die Bindung ihre Form ändern müssen – besonders anspruchsvolle Aufgaben des Proteindesigns. Dem Team um Sadiq zufolge funktioniert das neue System vergleichbar oder sogar besser als andere aktuelle Proteindesign-Verfahren.
Das Heidelberger Verfahren besteht aus zwei Stufen. Als Erstes erzeugen die Fachleute zufällige Abfolgen von Proteinbausteinen, sagen deren Struktur mit dem bereits etablierten, von Google entwickelten Tool »AlphaFold« vorher und überprüfen, wie gut sie für ihre Aufgabe geeignet sind. Ein spezieller Maschinenlern-Algorithmus, der zufällig Veränderungen in die Proteinsequenz einfügt, erzeugt bessere Versionen dieser Proteine mithilfe von Halluzinationen, die wiederum mit AlphaFold simuliert und geprüft werden. Mehrere Durchgänge dieses Zyklus erzeugen optimierte Proteine. Solche Verfahren gibt es bereits, bisher jedoch waren sie anderen KI-basierten Techniken unterlegen, besonders den Diffusionsmodellen, die auch in Bildgeneratoren eingesetzt werden. Der entscheidende Trick ist die zweite Stufe, wie das Team berichtet. In dieser erzeugt ein solches Diffusionsmodell aus den Kandidatenproteinen ähnliche Proteine mit neuer Bausteinabfolge. Aus diesen filtert AlphaFold wiederum solche heraus, die mit höchster Wahrscheinlichkeit die gewünschte Struktur und Funktion ergeben.
Durch diese Kombination zweier Verfahren sei die AlphaDesign-Plattform besonders leistungsfähig, schreibt die Arbeitsgruppe in der Veröffentlichung. Der halluzinationsbasierte erste Schritt erzeugt eine große Bandbreite an möglichen Proteinversionen und macht laut den Fachleuten auch komplexere Proteine zugänglich, die zum Beispiel ihre Form ändern müssen, um zu binden. Das Diffusionsmodell dagegen erzeugt aus diesen Kandidaten Proteine, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auch im Organismus funktionieren, als es bei reinen Halluzinationsverfahren der Fall ist.
Um das zu zeigen, erzeugte das Team einen Hemmstoff gegen das Protein RcaT – ein Toxin, das bei einer Infektion mit Bakteriophagen gebildet wird und andere Bakterien am Wachsen hindert, sodass sich das Virus schlechter ausbreitet. Unter den von den KI-Systemen erzeugten Strukturen seien mehrere effektive Hemmstoffe gewesen, von denen einige sogar gegen verwandte Proteine wirken, berichtet die Gruppe. Bisher habe das System jedoch weiterhin den für Halluzinationsverfahren typischen Nachteil, dass es bei großen Proteinen schlecht funktioniert. Zukünftige Verbesserungen sollen helfen, dieses Problem zu beheben.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.