Robotik: Klein ist das neue Schwarz
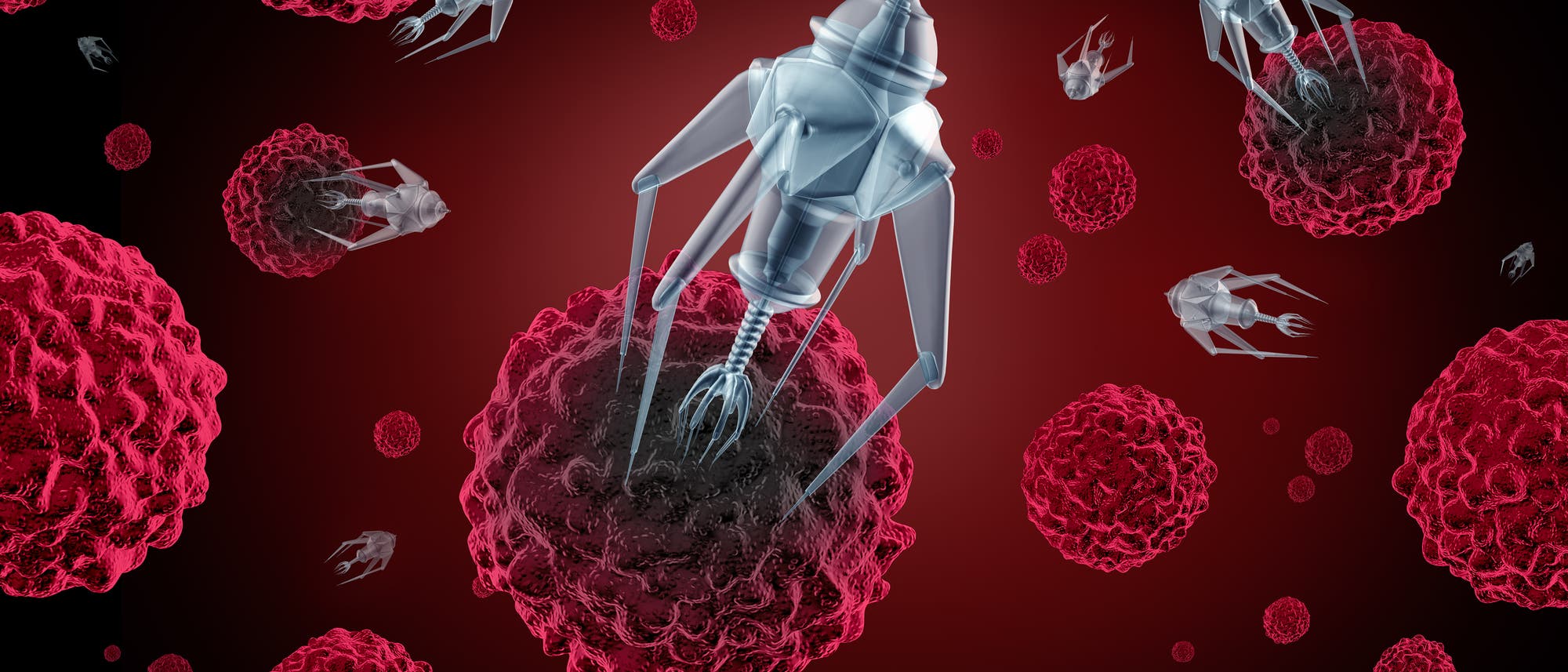
Mit diesem Roboter kann man herrlich spielen! Wenqi Hu zeigt ihn in einer Petrischale, die leer ist bis auf dieses winzige Plättchen, das erst reglos am Boden liegt. Dazu reicht der Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart einen Magneten – und schon kommt Leben in das kleine Wesen: Es biegt sich zu einer Art Halbmond – erst in die eine, dann in die andere Richtung, und schafft es so, sich fortzubewegen. Dreht man den Magneten, rollt es sich zusammen oder kriecht wie eine Raupe. Das vier Millimeter lange Plättchen scheint auf einmal lebendig zu sein.
Dieser Roboter, der im Fachjournal »Nature« vorgestellt wurde, ist nur die Speerspitze einer wachsenden Bewegung: Immer mehr Forscher beschäftigen sich mit winzig kleinen Robotern. Und auch, wenn man schon beim Plättchen des MPI stets Angst haben muss, es zu verlieren: Es gehört bei Weitem nicht zu den kleinsten existierenden Robotern. Denn diese spielen mittlerweile auf Nanoebene, in der Größe zweier Blutzellen.
Das Revolutionäre an der neuesten MPI-Entwicklung ist seine Fortbewegungsart, erklärt Metin Sitti, Direktor der Abteilung für Physische Intelligenz. »Die Idee, einen Roboter zu bauen, der sehr klein und obendrein weich ist, ist neu. Doch nur durch diese Eigenschaft kann er sich auf viele Arten fortbewegen: Der Trick ist die Formveränderung.« Das 0,1 Millimeter dünne Gerät besteht lediglich aus einer Art Gummi, in das verschiedene Magnetpartikel eingearbeitet sind. Dank dieser reagiert es auf magnetischen Einfluss.
Und natürlich bleibt es nicht dabei, dass man den Roboter händisch steuert, indem man einen Magneten um ihn herumbewegt. Im Labor zeigt Wenqi Hu einen schrankgroßen Aufbau mit diversen Spulen, die ein Magnetfeld aufbauen, das er vom Computer aus dirigiert. In die Mitte legt er die Petrischale mit dem kleinen Roboter – diesmal schließt er sie wohlweislich mit einem Deckel. Denn kaum hat Hu ein paar Befehle am Rechner eingegeben, schon hüpft das kleine Ding wie ein winziger Flummi. Die nächste Einstellung lässt es kriechen wie eine Raupe, und als Hu die Petrischale gegen ein mit Wasser gefülltes Gefäß austauscht und ein anderes Programm startet, beginnt der Roboter mit seinen beiden Enden zu schlagen wie ein Kolibri mit den Flügeln – und schwimmt so vom Boden an die Wasseroberfläche.
»Er kann tauchen, schwimmen, laufen, kriechen, krabbeln, hüpfen und rollen«, sagt Metin Sitti stolz: Insgesamt sieben Fortbewegungsarten hat der kleine Roboter drauf, abgeschaut von der Natur, unter anderem von Käfern, Raupen und Quallen. Auch das ist selten für Roboter, sogar für große, wie Sitti betont: »Die meisten Roboter sind sehr spezialisiert, sie können sich nur in einem bestimmten Gelände bewegen.« Kaum einer kann auch nur laufen und schwimmen. Doch diese Fertigkeiten wird Sittis kleiner Roboter brauchen, wenn er tatsächlich dort unterwegs sein wird, wo ihn seine Erfinder in Zukunft sehen: im menschlichen Körper. Er soll eines Tages Medizin im Körper ausliefern, und zwar ganz genau dorthin, wo sie gebraucht wird. »Bislang kann man zwar an viele Stellen innerhalb des Körpers gelangen, beispielsweise mittels sehr kleiner Katheter«, sagt Sitti. Der Haken solcher Lösungen: Sie sind immer angebunden, sie haben alle eine Leitung nach draußen und sind von daher begrenzt in ihrer Bewegungsfreiheit. »Wenn wir Roboter bauen, die sich frei bewegen können, können wir alle Stellen im Körper erreichen.«
Sitti kooperiert mit Ärzten an der Tübinger Uniklinik: »Sie sind sehr angetan.« Die Vorteile liegen auf der Hand. Noch nimmt man Medikamente meist über die Blutbahn auf, »doch das verursacht Nebenwirkungen, weil sie nicht nur dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden«. Der kleine Roboter kann eine gewisse Menge an Medizin transportieren, entweder in einer winzigen Tasche, die sich am Ziel durch eine gezielte Formänderung öffnet, oder indem er die Medizin absorbiert und sich am Ziel mittels Formveränderung selbst auswringt wie ein Schwamm.
Roboter waren schon fast überall, jetzt wollen die Robotiker den menschlichen Körper erobern
Bradley Nelsons Vision ist beinahe so alt wie er selbst: In einem TED-Talk zeigt der Forscher der ETH Zürich einen Hollywoodfilm von 1966: »Fantastic Voyage«. Darin werden Mediziner samt U-Boot geschrumpft, um dann als Winzlinge im Gehirn eines Mannes ein Blutgerinnsel zu entfernen. Während die Männer tapfer wie Krieger gegen Blutzellen kämpfen, präsentiert Nelson grinsend ein Plättchen auf der Fingerspitze, noch kleiner als das von Sitti, doch sonst ähnlich. Dieser Miniroboter soll Medizin in den Augapfel transportieren, ebenfalls angetrieben durch ein externes, computergesteuertes Magnetfeld. Er wird mittels einer sehr feinen Nadel injiziert, die das Auge kaum verletzt – schließlich ist er nur ein drittel Millimeter dick und knapp zwei Millimeter lang. »Und das ist der größte Roboter, den wir machen«, erklärt Nelson weiter.
Normalerweise arbeitet er in einem 1000-mal kleineren Maßstab, was von Vorteil sei, da man umso weniger magnetische Kraft benötige, je kleiner der zu bewegende Roboter ist. Aber es hat auch Nachteile: Die Physik verändert sich. Nelson demonstriert das anhand eines Roboterfisches, der sich in normaler Größe mittels seiner Schwanzflosse voranbewegt. Die Natur ist ein beliebtes Vorbild für Robotiker, weil die Evolution hochangepasste und effiziente Methoden der Fortbewegung hervorgebracht hat – doch Nelsons Beispiel zeigt, dass das nur funktioniert, wenn man sich an die Größenmaßstäbe hält. Denn Oberflächeneffekte spielen eine viel größere Rolle, wenn die Roboter winzig klein sind – sie werden im Verhältnis stärker und können den Roboter lähmen. Es ist, wie wenn der Fischroboter in Sirup schwimmen müsste: Er kommt nicht von der Stelle.
Folgerichtig nehmen sich Nanorobotiker kleinere Strukturen der Natur zum Vorbild, im Fall der ETH-Forscher Bakterien, beispielsweise das E.-coli-Bakterium. Dieses bewegt sich durch Flüssigkeiten dank einer rotierenden Spirale, dem so genannten Flagellum. Das künstliche Flagellum eines der Züricher Nanoroboter, der nur doppelt so groß ist wie eine rote Blutzelle – und der neben einem menschlichen Haar unter dem Mikroskop wie eine Maus neben einem Autobahnbrückenpfeiler wirkt –, wird von einem rotierenden Magnetfeld in Bewegung versetzt.
Ein Anwendungsszenario, in das besonders viel Hoffnung gesetzt wird, ist die Krebsbehandlung. Schließlich fallen hier Nebenwirkungen extrem stark ins Gewicht, die mit einer gezielteren Medikamentenabgabe verringert werden können. Nelson experimentiert in diesem Zusammenhang unter anderem mit großen Schwärmen von Nanorobotern mit dem Ziel, dass diese beispielsweise einen Tumor umzingeln und Medizin frei geben. 2014 injizierte er einen Schwarm von 80 000 solcher Roboter in den Magen einer Maus, wo er sie an bestimmte Orte steuerte und sie einen Wirkstoff abgaben. Wenn Nelson seine Nanoroboter mittels eines gefilmten Blicks durchs Mikroskop in Aktion zeigt, wirken sie wie perfekte Synchronschwimmer. »Dafür wollen wir eine Medaille bei der nächsten Olympiade«, scherzt er. Bis jetzt hat es immerhin für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gereicht, im Jahr 2012 für den kleinsten medizinischen Roboter.
Doch bis Roboter durch unsere Körper schwimmen und Medikamente verteilen, vergehen wohl noch einige Jahre. Die meisten Projekte sind bis jetzt kaum über die Grundlagenforschung hinaus, auch Sitti hat seinen neuesten Roboter bislang lediglich durch ein Stück Hähnchenfleisch navigiert und per Ultraschall beobachtet – das allerdings mit Erfolg, wie er betont. Er schätzt, dass erste medizinische Pilotstudien im menschlichen Körper in etwa zehn Jahren stattfinden. Der nächste Schritt sei, die Roboter aus biologisch abbaubarem Material zu konstruieren, so dass sie keinen Schaden anrichten, sollten sie im Körper verloren gehen.
»Es ist eine große Herausforderung, biokompatible Materialien zu finden«, bestätigt auch Daniela Rus vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aktuell arbeitet ihre Gruppe mit getrockneter Schweinehaut. Ähnlich wie Sittis Roboter nutzt auch der zunächst in einer schluckbaren Kapsel zusammengefaltete Roboter unter anderem seine eigene Formveränderung zur Fortbewegung. Löst sich die Kapsel im Körper auf, entfaltet sich der Origami-Roboter, wie ihn die Forscher nennen. Er bewegt sich anschließend fort, indem er abwechselnd durch Reibung an der Oberfläche haftet und sich dann selbst befreit, indem er seine Form verändert und ein Stück weiterrutscht. Der Roboter transportiert zudem einen kleinen Magneten, durch den er von außen gesteuert wird – stets in einer rotierenden Bewegung, die ihn abhängig von der Frequenz der Rotation entweder selbst auf der Stelle drehen lässt oder um einen seiner festen Füße herum.
Kombiniert mit der so genannten »stick-slip«-Bewegung (Haft-Rutsch-Bewegung) kommt er so voran. Diesen kleinen Magneten nutzten die Forscher zudem, um im Rahmen einer Demonstration in einer künstlichen Speiseröhre verschluckte Batterien im Verdauungstrakt einzufangen und durch den Darm nach draußen zu befördern – angesichts von jährlich 3500 verschluckten Knopfbatterien allein in den USA ein sinnvoller Anwendungsfall. Doch auch hier kommt ein Vorbild aus dem Tierreich zum Tragen: Da der menschliche Körper auch viel flüssiges Material enthält, hilft dem kleinen Roboter zusätzlich ein Flossenantrieb wie der eines Fisches.
Wenn die Natur so ein gutes Vorbild ist – wieso sie dann nicht direkt nutzen? Das tun unter anderem Oliver Schmidt und sein Team vom Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden. Die Forscher nutzten unter anderem echte Spermien als eine Art Lastesel, indem sie sie mit einem Krebsmedikament beluden und ihnen einen winzigen, eisenbeschichteten so genannten Tetrapod umlegten. Damit konnten sie die Spermien von außen per Magnetfeld direkt zur Tumorzelle steuern. »In der Petrischale hat das bereits geklappt«, sagt Schmidt. »Die Spermien haben die Substanzen an die Krebszellen abgegeben, die zu einem hohen Prozentsatz getötet wurden.« Der Vorteil dieser Methode: Spermien können nicht nur Zellwände durchdringen, sie haben auch – in Relation zu ihrer Größe – eine enorme Transportkapazität. Zudem können sie auf Grund ihrer natürlichen Beschaffenheit lange in der Gebärmutter verweilen, was viel versprechend sei, so Schmidt, um in Zukunft beispielsweise Gebärmutterhalskrebs zu bekämpfen. Auch aus seiner Sicht ist das der bedeutendste Anwendungsfall: »Die effiziente Krebsbekämpfung mit Mikromotoren könnte in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.« Sein Institut hat dafür gerade eine Kooperation mit der Dresdener Uniklinik gestartet.
Künstlich angetriebene Spermien könnten zudem künstliche Befruchtungen erleichtern, ergänzt Schmidt – zumindest wenn der Kinderwunsch an bewegungsunfähigen oder zu langsamen Spermien scheitert. Schließlich fehlt diesen Spermien »nur« der Motor. In einem Versuch, ebenfalls in der Petrischale, ließ er Rinderspermien von einem so genannten »Spermbot« einfangen, der sie zur Eizelle transportierte. Dieser Roboter besitzt das gleiche Antriebskonzept, das auch Nelsons Arbeitsgruppe verfolgt: eine Helix, die per Magnet von außen in Rotation versetzt wird und so für Schub sorgt.
Eine der größten Herausforderungen bei diesen winzigen Robotern – Schmidt arbeitet mit Strukturen in der Größe zwischen einigen wenigen bis zu mehreren hundert Mikrometern – sei, ihre Bewegungen innerhalb des Körpers in Echtzeit und sehr exakt abzubilden. Schließlich kann man sie nur dann von außen steuern, wenn stets klar ist, wo sie sind. »Deshalb sind wir jetzt wieder an größeren Strukturen interessiert.« Zudem untersucht er neben den physikalischen Mikromotoren via Magnet und biologischen Antriebskonzepten auch chemisch angetriebene Miniroboter, die die Energie einer chemischen Reaktion als Antrieb nutzen. Und auch Schmidt wartet mit einem Guinness-Weltrekord auf: 2011 für den kleinsten von Menschenhand gebauten Düsenantrieb (600 Nanometer im Durchmesser).
Ein Konzept, in dem viele dieser Ansätze konsequent zum Tragen kommen, sind die »Robo-Bienen«, die Forscher der Harvard University im Oktober 2017 in »Science Robotics« vorgestellt haben: Miniinsekten, die sowohl tauchen und schwimmen als auch fliegen können und den Wechsel zwischen diesen Medien mittels physikalischer und chemischer Antriebskonzepte nutzen.
Wichtig sei hier umzudenken, betont Kevin Chen vom Harvard Microrobotics Lab, da die Physik in kleinen Größenverhältnissen nicht intuitiv sei: »In diesem geringen Maßstab wird der Oberflächeneffekt sehr viel größer.« Die Kraft der Oberflächenspannung des Wassers ist zehnmal stärker als die Kraft, die das Gewicht des Roboters auf das Wasser ausübt: Hineinzutauchen gleicht dem Versuch, durch eine Betonwand zu rennen. »Das kann hinderlich sein«, sagt Chen, »vor allem, wenn er vom Tauchen ins Fliegen übergehen will.«
Und hier gab es auch nichts von der Natur abzuschauen, denn Insekten krabbeln aus dem Wasser und trocknen dann erstmal ihre Flügel – doch so lange wollte Chen nicht warten: »Wir schauen, was die Natur kann, und versuchen darüber hinauszukommen.« Nachdem es zunächst schier unmöglich schien, die Robo-Biene durch die Wasseroberfläche zu bekommen, hatten die Forscher schließlich die Idee, eine Explosion zu nutzen – und mangels Transportkapazität für entsprechenden Brennstoff nutzten sie kurzerhand das Wasser selbst. Sobald die Robo-Biene an die Oberfläche schwimmt, verwandelt eine elektrolytische Platte in einer kleinen Kammer im Roboter Wasser in Knallgas, das zunächst den Auftrieb erhöht. Für den letzten fehlenden Schwung entzündet ein kleiner Zünder das Gas – das künstliche Insekt poppt quasi an die Wasseroberfläche. »Und dort nutzen wir dann wiederum die Oberflächenspannung, um den Roboter zu stabilisieren«, erklärt Chen. Hier hat die unintuitive Physik erneut Vorteile. Der Stuttgarter Metin Sitti nutzte diese bereits 2006 und konstruierte einen Wasserläuferroboter.
Noch sind allerdings einige Probleme zu lösen, beispielsweise die Energieversorgung: Die 175 Milligramm leichte Biene kann keine Batterie transportieren, weshalb sie bis jetzt an einem Kabel hängt. »Daran arbeiten wir gerade«, verrät Chen. »In zwei Jahren wird es autonome fliegende Roboter geben, die ihre Batterie transportieren.« Danach gehe es daran, kollaborative Roboterschwärme zu konstruieren, die dann beispielsweise in Such- und Rettungsmissionen in eingestürzten Gebäuden Überlebende aufspüren und eine Karte des Geländes erstellen können.
Im Gegensatz zu den magnetisch betriebenen medizinischen Robotern hat die Robo-Biene immerhin eigene Motoren: Ihre Flügel werden mit Piezoaktoren angetrieben. Doch sonst können die Winzroboter wenig, was man klassischerweise von einem Roboter erwartet. Müssen wir unsere Idee von Robotern überdenken? Wenqi Hu vom Stuttgarter MPI wiegt den Kopf und sagt »gute Frage« – ohne die magnetische Steuerung ist sein Roboter schließlich nichts anderes als ein winziges weiches Kunststoffplättchen. Es hat keinen Motor, keine Sensoren, keine künstliche Intelligenz. »Man muss das gesamte Konzept betrachten«, sagt er schließlich. »Das Plättchen ist nur ein Teil des großen Ganzen.« Ähnlich argumentiert auch Harvard-Forscher Chen: Die Robo-Insekten haben keine zentrale künstliche Intelligenz, »aber das ist auch nicht nötig. Nicht jeder Roboter muss wissen, was alle anderen tun.« Ähnlich wie Ameisen organisieren sich die Schwärme dennoch selbst, indem jeder einzelne Informationen nur an seinen Nachbarn weitergibt, beispielsweise in Form von Lichtsignalen. Die winzige Robo-Welt zwingt zu ganz neuer radikaler Einfachheit – die gleichzeitig ziemlich smart ist.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.