KI in der Materialforschung: Künstliche Intelligenz für smarte Werkstoffe
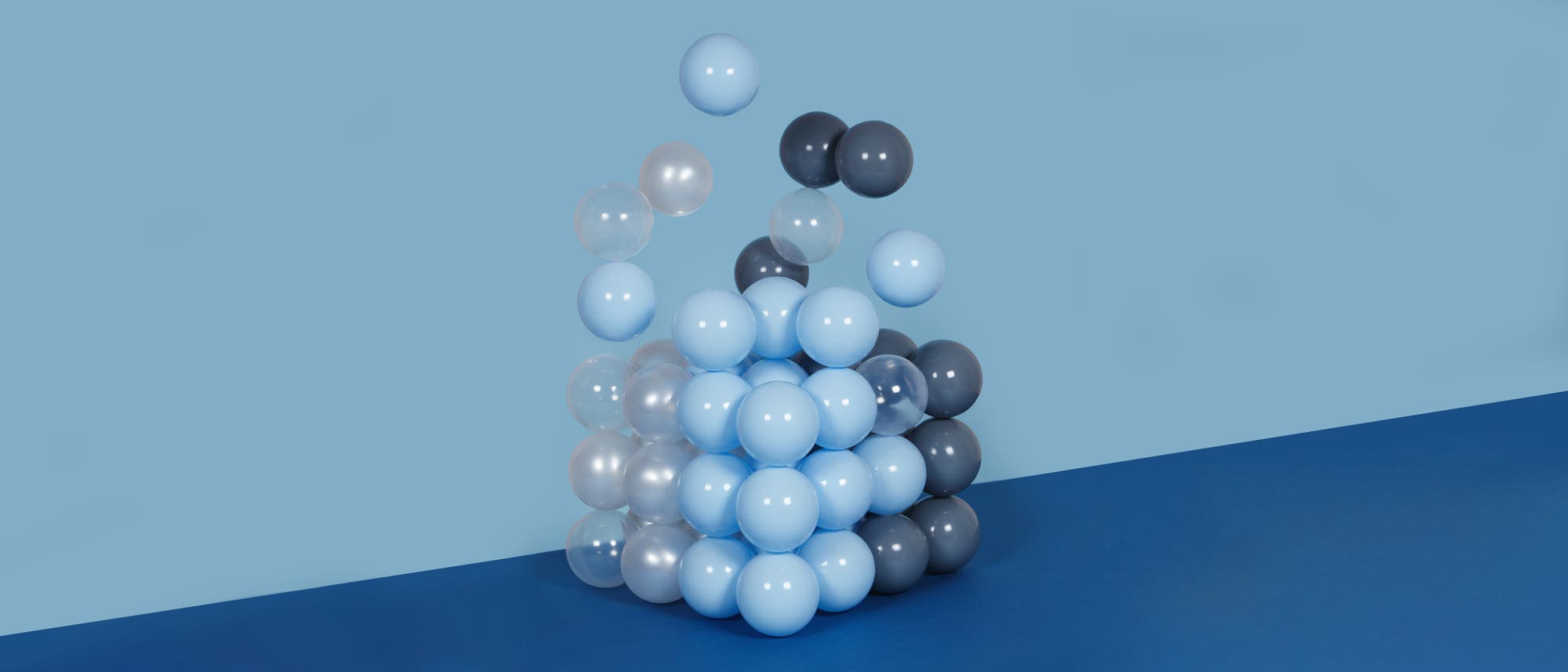
Es wäre ein Erfolg, der die Welt verändert. Hochleistungsmagnete für Windkraft und Elektroautos, die ohne seltene Erden auskommen – und bloß drei Monate will das britische Unternehmen Materials Nexus für deren Entwicklung gebraucht haben. Möglich gemacht haben soll das eine KI-Plattform, die nicht nur ganz neue Werkstoffe findet, sondern ihre Entwicklung auch dramatisch beschleunigt. Die Materialentwicklung sei damit 200-mal schneller als mit herkömmlichen Trial-and-Error-Verfahren, behauptet das Unternehmen. Derartige Erfolgsmeldungen von Startups sind bekanntermaßen mit Vorsicht zu genießen, doch der dahintersteckende Trend ist real: KI spielt eine immer größere Rolle in der Materialforschung.
Die Materialforschung ihrerseits spielt eine immer größere Rolle für die Technik. Solarzellen, Batterien, Windkraftanlagen, Computerhardware, Elektromotoren sowie Sensoren werden effizienter und leistungsfähiger, und entsprechend steigen die Anforderungen an die Werkstoffe.
Wichtige Kriterien für Anwendungen sind Leistungsfähigkeit, Produktionskosten, Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen oder Recycelbarkeit. Meist zählt die Kombination mehrerer solcher Eigenschaften. Eine weitere Herausforderung für alle Forscherinnen und Forscher, die nach neuen Materialien suchen: Die Rohstoffe sollten aus verschiedenen Ländern zu beziehen sein, um nicht von einzelnen Staaten oder Unternehmen abhängig zu sein. Zudem sollten sie klima- und umweltverträglich gefördert oder hergestellt werden.
Die Vorteile der KI
»Herkömmliche Methoden der Materialentdeckung beruhen auf iterativen, ressourcenintensiven Suchvorgängen und sind häufig durch menschliche Intuition und experimentelle Beschränkungen limitiert«, scheiben Forschende um Mingda Li vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in einem Übersichtsartikel von 2025. »Diese Methoden waren zwar im letzten Jahrhundert erfolgreich, haben aber Schwierigkeiten, die wachsende Nachfrage nach Materialien mit hochspezialisierten Eigenschaften für moderne Technologien zu befriedigen.« Die Lösung, so die Wissenschaftler in ihrem Übersichtsartikel: KI-gesteuertes Materialdesign.
Themenwoche: Werkstoffe und Materialforschung
Metalle, Textilien, Kunststoffe, Keramik – fast unsere gesamte Umwelt besteht aus verarbeiteten Materialien. Und das seit Tausenden von Jahren. Die Werkstoffe und ihre Eigenschaften prägen unseren Alltag und unsere Kultur. Doch die nächste Revolution steht schon bevor: nachhaltige Materialien ohne Müll und Treibhausgase. Und dabei sollen sie immer noch mehr leisten. Kann das gelingen?
- Interview: »Materialien sind fundamentaler als Sprache«
- Birkenpech: Das Rätsel um den ältesten Kunststoff der Welt
- Nachhaltige Werkstoffe: Hightech auf dem Holzweg
- Kunststoffe: Die radikale Lösung für die Plastikkrise
- Carbonbeton: Revolution im Inneren des Betons
- Aktive Materialien: Werkstoffe an der Grenze zum Leben
- Materialforschung: Künstliche Intelligenz für smarte Werkstoffe
Tatsächlich zeigt sich bereits jetzt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Suche nach neuen Materialien erheblich beschleunigen kann. So entwickelte ein internationales Forscherteam um Dierk Raabe vom Düsseldorfer Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien (MPI-SusMat) mithilfe eines Maschinenlern-Ansatzes zwei metallische Legierungen, die sich bei steigender Umgebungstemperatur pro zusätzlichem Grad nur um zwei Millionstel ausdehnen.
Solche Invar-Legierungen, die ihr Volumen bei Temperaturschwankungen kaum verändern, sind ideal für Tanks, die flüssiges Erdgas oder Wasserstoff speichern. In der Fachzeitschrift »Science« berichtet die Arbeitsgruppe: »Der gesamte Arbeitsablauf dauerte nur wenige Monate, im Gegensatz zum herkömmlichen Ansatz der Legierungsentwicklung, der Jahre und viele weitere Experimente erfordert.« Die gefundenen Stoffe haben außerdem eine sehr komplexe Struktur, sie bestehen aus fünf Elementen zu etwa gleichen Teilen. Diese sogenannten hochentropischen Legierungen erfordern sehr aufwändige Suchverfahren im Vergleich zu klassischen technischen Legierungen aus einem oder zwei Hauptelementen.
Bei Molekülen ist die KI besonders hilfreich
Bei vielen anorganischen Werkstoffen wie Legierungen, Magneten und Gläsern hängen die Eigenschaften erheblich von ihrer Mikrostruktur ab und damit von der Art und Weise, wie sie hergestellt wurden. Anders ist es üblicherweise bei Stoffen, die aus Molekülen aufgebaut sind. Da reicht die chemische Zusammensetzung, um sie zu charakterisieren. Aus diesem Grund sind KI-Verfahren in der Organischen Chemie ausgesprochen erfolgreich.
Ein Beispiel liefert ein internationales Team rund um Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg (HI-ERN). Sie fanden innerhalb weniger Wochen unter Millionen Kandidaten ein organisches Molekül, das besonders gut »Löcher« leitet – Ladungsträger, die durch die Abwesenheit eines Elektrons entstehen, zum Beispiel wenn Elektronen in einer Solarzelle angeregt und abgeleitet werden. Die von der Arbeitsgruppe entdeckte Verbindung soll nun die Effizienz von Perowskit-Solarzellen steigern.
Dank KI mussten die Fachleute nur rund 150 Moleküle tatsächlich im Labor herstellen, um unter einer Million Substanzen die besten zu entdecken. Die Vorauswahl erledigte wiederum ein Maschinenlern-Algorithmus. Mit einem der Moleküle steigerten sie den Wirkungsgrad einer Referenzsolarzelle um rund zwei Prozent. »Unser Erfolg zeigt, dass man bei der Entwicklung neuer Energiematerialien mit einer geschickten Strategie enorm viel Zeit und Ressourcen einsparen kann«, sagt Pascal Friederich vom KIT, Professor für KI in der Materialwissenschaft.
Materialforscherinnen und Materialforscher nutzen maschinelles Lernen in zwei Richtungen. In der Vorwärtsrichtung sagt das KI-Modell die Eigenschaften eines Materials voraus. Dazu trainieren Fachleute es mit bekannten Materialzusammensetzungen und deren Eigenschaften. Auf diese Weise entwickelte das MIT-Team um Li gemeinsam mit Wissenschaftlern der japanischen Universität Tohoku ein KI-Tool, das die optischen Eigenschaften von Materialien so genau prognostiziert wie herkömmliche Dichtefunktional(DFT)-Berechnungen. Dabei arbeitet es aber laut der Universität Tohoku eine Million Mal schneller. Da das KI-Tool wesentlich weniger Computerressourcen verbraucht als DFT-Berechnungen, kann man damit die optischen Eigenschaften zahlreicher Materialien in kürzester Zeit prüfen. Solche Parameter wie Bandlücken, Transparenz und Brechungsindex zu kennen ist entscheidend für die Entwicklung von LEDs, Solarzellen und photonischen integrierten Schaltungen.
Vorwärts und rückwärts
Es ist allerdings nicht immer ganz klar, ob das, was die KI ausspuckt, auch wirklich das Gewünschte leistet. Ein Beispiel dafür ist das KI-Tool GNoME von Google DeepMind. In Kombination mit DFT-Berechnungen sagt GNoME die Stabilität von anorganischen Materialien vorher. Wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Fachmagazin »Nature« berichten, entdeckten sie so 2,2 Millionen neue anorganische Verbindungen. Demnach seien viele davon »bisher der menschlichen Intuition entgangen« und erweiterten die stabilen Materialien, »die der Menschheit bekannt sind, um eine Größenordnung«. Allerdings sind keineswegs alle Fachleute davon überzeugt, dass die vollmundigen Behauptungen stimmen. So bezweifeln die Materialforscher Anthony Cheetham und Ram Seshadri von der University of California die Aussagen. In der Fachzeitschrift »Chemistry of Materials« schrieben sie: »Wir finden leider kaum Beweise für Verbindungen, die die drei Kriterien Neuheit, Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit erfüllen.«
»Solche generativen Modelle schlagen Materialien und Strukturen vor, die noch niemand gesehen hat«Pascal Friederich, Materialwissenschaftler
In der Rückwärtsrichtung, auch inverses Materialdesign genannt, geben Forscherinnen und Forscher der KI die gewünschten Eigenschaften eines Stoffes vor. Die KI schlägt dann mögliche Materialzusammensetzungen vor. Ein prominentes Beispiel ist das generative KI-Modell MatterGen von Microsoft Research. Es entwirft am Computer unter Nutzung fast aller Elemente des Periodensystems vielfältige anorganische Materialien – ähnlich wie ChatGPT Texte oder Bilder erzeugt. »Solche generativen Modelle schlagen Materialien und Strukturen vor, die noch niemand gesehen hat«, erklärt Pascal Friederich.
Allerdings hat sie an dem Punkt auch noch niemand im Labor erzeugt – die Substanzen existieren lediglich im Computer. »Die große Frage ist dann, ob sich diese Materialien überhaupt herstellen lassen«, sagt der Forscher. Eine weitere Herausforderung des inversen Materialdesigns, so der Experte des KIT: »Es deckt nur Materialien ab, die über eine Molekülstruktur oder eine Kristallstruktur definiert werden können. « Das Problem dabei: Viele spannende Eigenschaften gehen auf lokale Unregelmäßigkeiten solcher Strukturen zurück. Doch gerade solche Besonderheiten seien der KI bisher unzugänglich, so Friederich. »Kristalldefekte, amorphe Regionen und Grenzflächeneffekte können noch nicht modelliert werden.«
Einen Ausweg bieten Strategien des aktiven Lernens. Dabei entscheidet die KI selbst, welche Daten oder Experimente für das weitere Lernen am wertvollsten sind – basierend auf Materialdatenbanken oder einer Reihe von Experimenten. Die KI entwickelt ihre Suchstrategie laufend weiter: Jedes Experiment liefert neue Erkenntnisse, die die nächste Versuchsreihe gezielter machen. Die Erfolge der Forscher des MPI-SusMat bei den Invar-Legierungen und der Forscher des KIT und des HI-ERN bei den Solarzellen-Materialien beruhen auf aktivem Lernen.
Auf dem Weg zu KI-gesteuerten Laboren
Doch auch hier gibt es Herausforderungen. Jörg Neugebauer vom MPI-SusMat erklärt dies am Beispiel von Legierungen: »Selbst wenn man nur die Elemente einbezieht, die für Legierungen besonders häufig verwendet werden, ergeben sich 1050 Varianten – eine astronomische Zahl.« Der resultierende Datenraum sei riesig, hochdimensional und nur sehr spärlich mit Daten aus Experimenten besetzt. Daher ergänzen die Forscher des MPI-SusMat die experimentellen Daten durch die Ergebnisse von quantenmechanischen und thermodynamischen Rechnungen. »So hat die KI eine bessere Grundlage, um zu entscheiden, welche Legierungen als Nächstes synthetisiert werden sollten«, sagt Neugebauer.
Von solchen Strategien des aktiven Lernens ist es gedanklich bloß ein kleiner Schritt bis zu vollständig selbststeuernden Laboren: Dort führen Roboter autonom Experimente durch, die die KI vorschlägt, und auch die Ergebnisse werden automatisiert ausgewertet. Zahlreiche Forschungseinrichtungen planen oder betreiben solche Labore bereits – in Deutschland sind das neben dem KIT etwa die Helmholtz-Institute Ulm (Batteriematerialien) und Erlangen-Nürnberg (Photovoltaikmaterialien), das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung und das Fritz-Haber-Institut (Katalysatoren) sowie die Bundesanstalt für Materialwissenschaft.
»Selbststeuernde Labore sind meist auf eine Materialklasse spezialisiert, für die es jedoch sehr viele Parameter gibt, die optimiert werden können«, erklärt Friederich. Die Idee: Dank des aktiven Lernens der KI führt das Labor nur diejenigen Synthesen, Charakterisierungen und Tests durch, die im riesigen Raum der Möglichkeiten besonders erfolgversprechend sind. Gleichzeitig steigern Robotereinsatz und Automatisierung den Durchsatz und verbessern die Reproduzierbarkeit von Synthesen und Messungen. Auf diese Weise sollen selbststeuernde Labore die Forschungs- und Entwicklungszyklen in der Materialwissenschaft erheblich verkürzen. Für den Menschen blieben kreative Aufgaben, etwa die Rahmenbedingungen für die Experimente infrage zu stellen oder neue wissenschaftliche Fragen zu definieren.
»Noch ist manches Wunschdenken«, urteilt Jörg Neugebauer. Er vergleicht die Situation mit den fünf Entwicklungsstufen zum selbstfahrenden Auto: Stufe 1 steht für das assistierte Fahren, Stufe 5 für vollständige Autonomie. Derzeit befindet man sich auf der Schwelle zu Stufe 3. Neugebauer: »Das ist bei den selbststeuernden Laboren ähnlich.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.