Nobelpreis für Chemie 2025: Wie die Chemie die dritte Dimension entdeckte
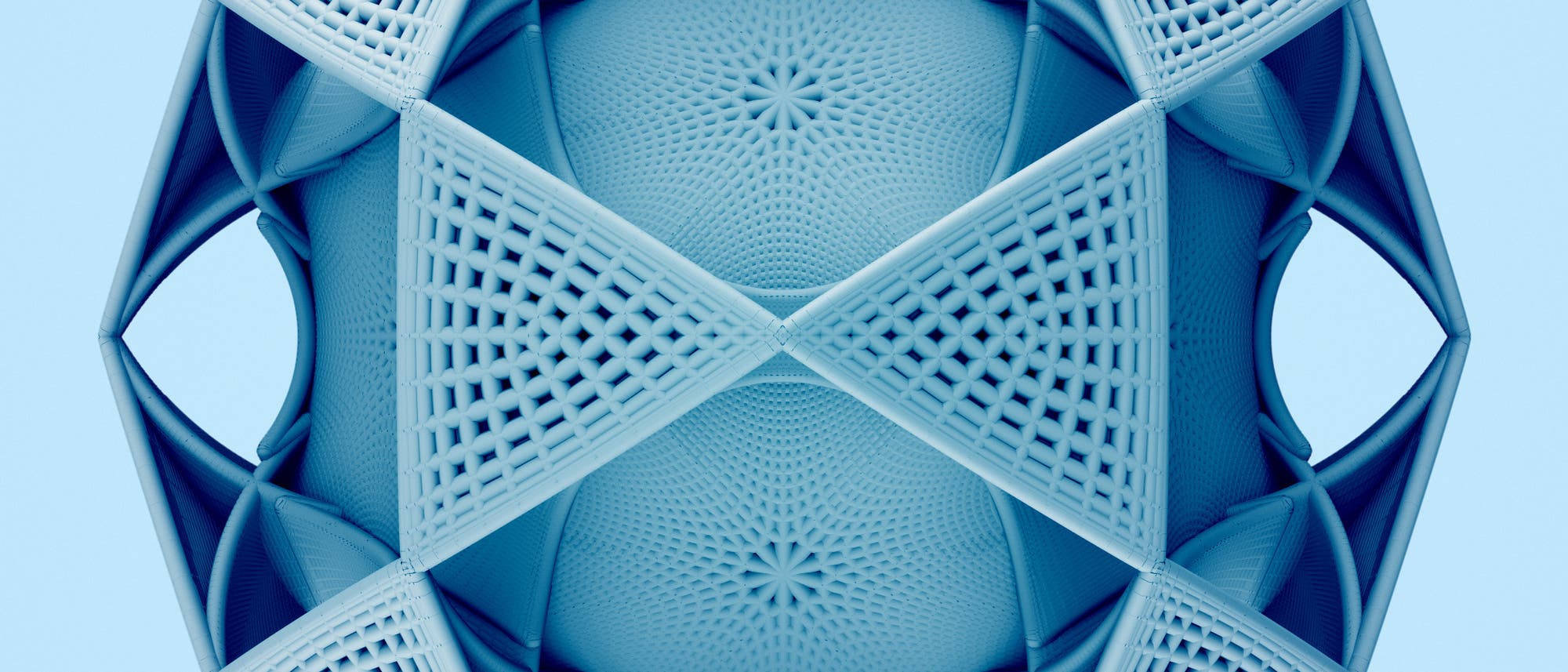
In den letzten 200 Jahren hat die Chemie gelernt, Atome nahezu beliebig zu Molekülen zu verbinden: Farbstoffe, Waschmittel, Medikamente – die Nanobausteine der modernen Welt. Doch größer ging es lange Zeit nicht. Es schien unmöglich, ausgedehnte dreidimensionale Materialien wie Kristalle oder Metalle nach dem gleichen Muster gezielt Atom für Atom zu konstruieren. Der Nobelpreis für Chemie 2025 geht an drei Fachleute, die dieses Problem auf elegante Weise lösten. Richard Robson, Susumu Kitagawa und Omar Yaghi nutzten die besonderen Wechselwirkungen zwischen Metallen und Molekülen, um die chemische Synthese in die dritte Dimension zu erweitern. Und dabei entdeckten sie eine völlig unerwartete neue Welt aus winzigsten Höhlen und Kanälen, die in Zukunft auch unsere eigene Welt verändern könnten.
Könnten – denn bisher leisten diese metallorganischen Gerüstverbindungen (besser bekannt als metal-organic frameworks oder MOFs) zwar im Labor Erstaunliches, doch bis heute haben sie es nicht in praktische Anwendungen geschafft. Deswegen galt zwar einerseits vor allem Omar Yaghi seit Langem als nahezu sicherer Anwärter auf den Chemie-Nobelpreis, andererseits gab es viele, für die die MOFs erst dann preiswürdig wären, wenn sie der »Menschheit den größten Nutzen« gebracht hätten, wie es in Alfred Nobels Testament heißt. Das Nobelkomitee hat sich nun entschieden, darauf nicht zu warten und die Entwicklung dieser bemerkenswert vielseitigen Stoffklasse zu würdigen.
Ihren Namen verdanken die metallorganischen Gerüstverbindungen ihrem eigentlich ganz einfachen Bauprinzip. Sie basieren auf Metallatomen, die ein regelmäßiges Gitter bilden. Untereinander verbunden sind sie durch Moleküle aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und anderen Elementen – also jenen organischen Verbindungen, auf denen die heutige Chemie ebenso wie das Leben selbst basiert. Metalle und organische Moleküle bilden Koordinationsverbindungen, in denen elektronenreiche Atome wie Sauerstoff oder Stickstoff an positiv geladene Metallatome binden.
Diese seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannten Metallkomplexe haben zwei entscheidende Vorteile für den Aufbau komplexer dreidimensionaler Strukturen. Zum einen nämlich enthalten sie keine klassischen Bindungen, die durch chemische Reaktionen erst aufwändig gebildet werden müssen. Vielmehr sind diese Bindungen eher wie Lego: Die Moleküle docken einfach an das Metall an. Zum anderen ist hier, anders als oft bei chemischen Reaktionen, von vornherein klar, was dabei herauskommt. Wie sich die organischen Moleküle räumlich ums Metall herum anordnen, ob sie ein Tetraeder bilden, ein Oktaeder oder einen Würfel, folgt einfachen Regeln.
Ein geniales, nur scheinbar einfaches Prinzip
Dadurch kann man völlig vorhersagbare dreidimensionale Strukturen erzeugen. Man braucht dazu nur organische Moleküle, die mindestens zwei geeignete metallbindende chemische Gruppen tragen. Bringt man diese mit einem passenden Metall zusammen, bauen sich die Komponenten ganz automatisch zu einer dreidimensionalen Gerüststruktur zusammen. Diese Idee ist so offensichtlich, dass sie bereits kurz nach der Entdeckung der Metallkomplexe aufkam. Es sollte allerdings noch ein Jahrhundert dauern, bis Fachleute sie wirklich umsetzten.
Der Erste, der dieses heute genial einfach erscheinende Prinzip umsetzte, war der Brite Richard Robson, der damals an der University of Melbourne anorganische Chemie lehrte. Nach seiner eigenen Darstellung entwickelte er die Idee erstmals, als er 1974 aus Holzkugeln und Metallstäben Kristallmodelle für das Chemie-Grundstudium bastelte. Diese Gitter demonstrieren tatsächlich das grundsätzliche Prinzip der Gerüstverbindungen: Die Bohrlöcher in den Kugeln geben durch ihre räumliche Anordnung bereits die Struktur des gesamten Gerüsts vor, die dann automatisch beim Zusammenstecken entsteht. Er überprüfte das Prinzip allerdings erst zehn Jahre später tatsächlich im Labor.
Robson orientierte sich dabei an einer der einfachsten Kristallstrukturen überhaupt, dem Diamantgitter. Dort ist jedes Kohlenstoffatom mit vier weiteren verbunden, die es in Form eines Tetraeders umgeben. Der Plan des britischen Chemikers: dieses grundlegende Strukturelement aus organischen Molekülen und Metallatomen so nachzubauen, dass das entstehende Gerüst das Diamantgitter exakt nachbildet.
Dazu nutzte er zwei Bausteine, die er sorgfältig danach ausgewählt hatte, dass sie die Geometrie des Tetraeders quasi in sich tragen. Als Metall wählte er Kupfer, das nur eins seiner Elektronen abgegeben hat. Dieses einwertige Kupfer bildet Komplexe mit tetraedrischer Geometrie, wenn es mit dreifach an Kohlenstoff gebundenen Stickstoff, einem Nitril, zusammenkommt. Der von ihm konstruierte molekulare Gegenpart ist ein relativ starres Molekül aus vier ebenfalls tetraedrisch angeordneten »Armen« mit eben solchen Nitrilgruppen an den Enden.
Theoretisch sollte sich daraus umstandslos das vorhergesagte diamantartige Gitter bilden – allerdings rechnete kaum jemand damit, dass das tatsächlich funktionieren würde. Der Grund war jene Besonderheit, die Gerüstverbindungen heute so attraktiv macht. Die Moleküle zwischen den Metallatomen sind recht groß, weswegen sich in der erwünschten Struktur große Hohlräume und Kanäle aufspannen. Die meisten Fachleute erwarteten darum, dass Bruchstücke des Gitters sich gegenseitig durchdringen und blockieren, sodass keine saubere Struktur entsteht, sondern ein formloses Gemenge.
Umso größer war die Überraschung, als das Ergebnis der Reaktion exakt der Vorhersage entsprach – es bildete sich ein wundervolles Diamantgitter. Doch Robson und sein Kollege Bernard Hoskins hatten große Vorbehalte gegenüber dem neuen Material, und das lag an den enormen Hohlräumen in seinem Inneren. Normalerweise haben Kristalle eine dichtgepackte Struktur aus Atomen, deren Anordnung dem Stoff seine Identität verleiht. Das war in diesem Fall ganz anders. Die neue Gitterverbindung war einerseits zweifellos kristallin, bestand aber andererseits zu mehr als der Hälfte aus Flüssigkeit. Die beiden Forscher waren zuerst etwas ratlos, was sie da vor sich hatten.
Doch rasch erkannten Hoskins und Robson das enorme Potenzial der neuen Stoffklasse. Schon bald sagten sie in Veröffentlichungen viele ihrer Besonderheiten voraus. So zum Beispiel, dass sich nicht nur eine endlose Vielfalt solcher Stoffe herstellen ließe, sondern auch, dass sich die Hohlräume im Inneren für bestimmte Moleküle maßschneidern lassen und Bindungsstellen oder Katalysatoren für chemische Reaktionen enthalten könnten.
MOF-Euphorie: Viele Versprechungen
Die beiden Wissenschaftler aus Melbourne nahmen damit schon Ende der 1980er Jahre vieles vorweg, was Jahre später eine wahre MOF-Euphorie befeuern würde. Ironischerweise waren sie zu früh dran: Als das Forschungsfeld zur Sensation wurde, war ihr Beitrag fast schon wieder vergessen. Erst 2018 lud man Robson erstmals zu einer Konferenz über das Forschungsfeld ein, das er 30 Jahre zuvor begründet hatte.
Seither hatte sich allerdings auch eine Menge getan. So hatten die beiden Forscher das Potenzial der Höhlen und Kanäle zwar schon prophezeit – doch selbst noch nicht realisiert. Ihre ersten Gerüstverbindungen nämlich enthielten in ihrem Inneren noch das Lösungsmittel, in dem sie hergestellt wurden. Und auch nur damit war die Struktur stabil.
Das änderte sich 1997. Der Chemiker Susumu Kitagawa stellte damals eine metallorganische Gerüstverbindung vor, die lange, offene Kanäle in ihrem Inneren besitzt. Das Material basiert auf einem hantelförmigen organischen Molekül aus zwei verbundenen Ringen mit je einem Stickstoffatom pro Ring. Verbunden werden die Hanteln über zweiwertige Kobaltatome, sodass senkrecht zueinander verlaufende Kanäle entstehen.
Zwischen dem 6. und dem 13. Oktober geben die Nobelkomitees die Preisträger des Jahres 2025 bekannt. Auf unserer Themenseite »Nobelpreise – die höchste Auszeichnung« erfahren Sie, wer einen der renommierten Preise erhalten hat. Dort können Sie außerdem das Wesentliche über die Laureaten und ihre Forschung nachlesen.
Der Clou: Diese Struktur behält ihre Form, wenn man das enthaltene Lösungsmittel aus den Kanälen entfernt. Das von Kitagawa erzeugte Material war damit das erste MOF, das auch ohne Gastmoleküle im Inneren stabil ist. Und nicht nur das: Die Substanz konnte Methan, Stickstoff oder Sauerstoff in ihre Poren einlagern und bei Bedarf wieder freigeben. Das klingt erst einmal nicht besonders spektakulär, doch damit zeichneten sich erstmals vielversprechende Anwendungen für die damals noch neue Materialklasse ab. Gase zu speichern schien ebenso möglich, wie Moleküle gezielt aus Lösungen zu entfernen.
Die Liste an nützlichen Aufgaben ist riesig: von der Gaswäsche über den Entzug von CO2 aus der Luft, die Reinigung von Wasser oder das Filtern bestimmter Giftstoffe aus Mischungen. Dabei allerdings zeigt sich auch eines der Probleme der MOFs, das womöglich Anteil daran hat, dass diese Stoffe die in sie gesetzten Erwartungen bisher nicht so recht erfüllen konnten. Es gab nämlich schon damals Materialien, die all das konnten und längst industriell hergestellt und auch genutzt wurden: Zeolithe – hochporöse, stabile kristalline Verbindungen. Warum sollte also eine neue Materialklasse Probleme lösen, die man schon lösen konnte?
Flexibilität als Vorteil
Kitagawa erkannte jedoch, dass metallorganische Gerüstverbindungen einen grundlegenden Vorteil haben könnten. Da es sich um Koordinationspolymere handelt und nicht um starre Festkörper, die an jeder Stelle durch feste chemische Bindungen rigide miteinander verknüpft sind, sollten sie grundsätzlich flexibel sein: Die Geometrie an den Metallzentren, die wie Knotenpunkte regelmäßig im MOF-Gitter verteilt sind, sollte sich durch die äußeren Bedingungen steuern lassen.
Kitagawa teilte die metallorganischen Gerüstverbindungen erst einmal theoretisch in drei Generationen ein. Zur ersten gehören solche, die nur in Gegenwart von Molekülen in ihren Poren stabil sind und nach deren Entfernung auseinanderfallen – jene, die Robson hergestellt hatte. In der zweiten Generation finden sich MOFs, die ihre »Gastmoleküle« freisetzen und wieder einlagern können, ohne dass sie kaputtgehen. Die dritte Generation umfasst schließlich »flexible« MOFs, wie Kitagawa sie zuletzt konstruiert hatte. Sie gehören zu den aktiven Materialien, die auf äußere Reize reagieren können. Sie verändern ihre Gestalt, wenn sich die Besetzung ihrer Poren ändert, aber auch, wenn ein äußerer Reiz wie Licht, Temperatur oder Druck auf sie einwirkt.
Und Kitagawa behielt Recht. Heute gibt es zahlreiche Beispiele für solche flexiblen MOFs. Sie ändern ihre Form etwa, wenn sich Gastmoleküle in die Poren einlagern oder wieder daraus entfernt werden, weshalb man sie auch als »atmende« Materialien bezeichnet. Ebenso können sie beispielsweise unter Druck, bei Bestrahlung mit Licht oder abhängig von der Temperatur ihre Geometrie ändern. Wie sich 2024 herausstellte, besitzt auch das 1997 von Kitagawa hergestellte Material derartige Eigenschaften.
Etwa zur gleichen Zeit wie Kitagawa interessierte sich Omar Yaghi, damals an der Arizona State University, für die neue Sorte chemischer Verbindungen. Schon 1995 stellte der damals 30-Jährige zwei poröse Materialien vor, die auf Kobalt- beziehungsweise Kupferzentren basierten, verbunden durch 1,3,5-Benzoltricarboxylat (Trimesinat). Gastmoleküle konnten in die Poren hinein- und wieder hinausdiffundieren. Waren die Poren vollbesetzt, waren die Materialien selbst bei 350 Grad Celsius noch stabil. In diesem Zuge gab der Pionier der noch neuen Materialklasse erstmals einen Namen, den sie bis heute trägt: »metal-organic frameworks«, auf Deutsch metallorganische Gerüstverbindungen.
Grundlegend neue Synthesestrategie
Yaghi wollte von Anfang an mehr als nur eine besondere Substanz erschaffen. Die Idee, die ihn antrieb, war die planbare Synthese von Materialien mit einer vorhersagbaren, streng definierten Struktur. Er suchte nach Methoden, solche Materialien nach rationalen Gesichtspunkten systematisch zu entwickeln – denn solch ein strategisches Vorgehen fehlte ihm damals in der synthetischen Chemie. Dem Pionier schwebte eine Art Baukastenprinzip vor, nach dem man neue kristalline Verbindungen einfach zusammenstecken und deren Eigenschaften variieren konnte.
1999 stellte Yaghi dann eine Substanz mit dem unspektakulären Namen MOF-5 vor. Cluster aus Zink und Sauerstoff bilden die Knotenpunkte dieses MOFs, die über Terephthalatmoleküle verbunden sind. Der Stoff war, selbst ohne Gastmoleküle, bei Temperaturen bis 300 Grad Celsius stabil. Das meiste Aufsehen erregte er aber durch eine andere Kennzahl: eine innere Oberfläche von sagenhaften 2900 Quadratmetern pro Gramm.
Die Kennzahl ist ein Maß für die Nützlichkeit eines porösen Materials, denn in den Poren lassen sich Gase oder Flüssigkeiten speichern und möglicherweise gar Reaktionen bewerkstelligen. Daher rührt die Hoffnung, MOFs könnten eines Tages als Speicher für Wasserstoff, zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Luft oder zur Aufreinigung von Trinkwasser dienen. Je größer die innere Oberfläche, desto mehr Gas lässt sich speichern, desto mehr Giftstoff lässt sich filtern, desto besser lassen sich Reaktionen antreiben. Der Zeolith mit der größten inneren Oberfläche kommt auf 904 Quadratmeter pro Gramm – weniger als ein Drittel des Werts von Yaghis MOF-5.
Dabei beließ es der Chemiker jedoch nicht. In den Jahren 2002 und 2003 zeigte Yaghi, dass sich die Porengröße von MOF-5 durch die Auswahl des organischen Verbindungsmoleküls ganz gezielt verändern ließ; nach diesem Prinzip stellte er 16 verschiedene Variationen des Materials vor. Er zeigte damit, was Robson und Hoskins fast 15 Jahre zuvor vermutet hatten – und er von Anfang an demonstrieren wollte: MOFs lassen sich nach rationalen Gesichtspunkten systematisch konstruieren. Damit stieß der Wissenschaftler die Tür weit auf zu einem riesigen Spielfeld, auf dem potenziell zahllose metallorganische Gerüstverbindungen synthetisiert werden konnten. Man musste es nur machen.
Gezieltes Design
In den frühen 2000er Jahren wuchs die Forschung an MOFs weiter rasant. Und natürlich ist es naheliegend, wenn man die Struktur eines Materials ganz gezielt designen kann, dadurch zielgerichtet MOFs mit bestimmten Eigenschaften herzustellen. Wie groß müssen die Poren sein, damit ein bestimmtes Gas gespeichert werden kann? Wie müssen die Ketten oder Seitengruppen der organischen Moleküle aussehen, die die Metallzentren verbinden, wenn der MOF bestimmte Chemikalien aus einer Mischung einfangen soll?
Forschungsgruppen weltweit haben dazu unterschiedlichste MOFs mit vielversprechenden Funktionen entworfen. So stellte eine Gruppe um Yaghi MOF-303 vor, der nachts Wasserdampf aus der Luft absorbiert und flüssiges Wasser abgibt, wenn die Sonne das Material aufheizt. Ein Material namens UiO-67 kann bestimmte perfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) aus dem Wasser filtern. MIL-101, ein MOF mit ausgesprochen großen Poren, fungiert gar als Katalysator und kann Rohöl oder bestimmte Antibiotika in verunreinigtem Wasser zerstören. CALF-20 wiederum kann besonders viel CO2 aufnehmen und wird gerade in Kanada industriell getestet.
Das ist noch nicht das Ende. Die unglaublich vielseitigen Stoffe haben die chemische Materialforschung grundlegend inspiriert. So arbeiten Forschungsgruppen weltweit nicht nur an MOFs, sondern auch an COFs, kovalenten organischen Gerüstverbindungen: Die ähneln MOFs in ihrer Struktur und ihren Eigenschaften, enthalten aber im Gegensatz zu ihrem Vorbild keine Metallatome. Stattdessen bestehen sie aus kovalent miteinander verbundenen Molekülen – ganz konventionell. Ohne die Forschung an MOFs und den Strategien für deren gezielte Herstellung würden wir sie heute möglicherweise gar nicht kennen. Robson, Kitagawa und Yaghi haben nicht nur eine neue Klasse von Materialien erschaffen. Vielmehr haben sie eine komplett neue Herangehensweise ersonnen, Stoffe gezielt zu entwerfen und herzustellen
Und trotzdem: Bei all dem weltverändernden Potenzial, das den metallorganischen Gerüstverbindungen angesichts der spektakulären Ergebnisse aus der Forschung zugeschrieben wird, haben viele Fachleute ein mulmiges Gefühl. Denn das Muster erscheint bekannt: Eine neue Materialklasse, die fundamental über die bisherige Chemie hinausgeht. Außergewöhnliche Eigenschaften, aufsehenerregende Ergebnisse aus dem Labor und die allgegenwärtige Prognose, der Stoff werde die Technik revolutionieren. Ein Nobelpreis. Und dann … Leider nicht mehr so viel. Die Rede ist von Graphen und Kohlenstoffnanoröhren, die bis heute auf den wirklich großen Durchbruch in der Technik warten. Und auch bei den metallorganischen Gerüstverbindungen dauert es bisher länger aus ursprünglich gedacht, das Potenzial auch in der Praxis zu realisieren. Wie es weitergeht, wird man daher abwarten müssen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.