Quantenmechanik: Die Jagd nach dem Suprafestkörper
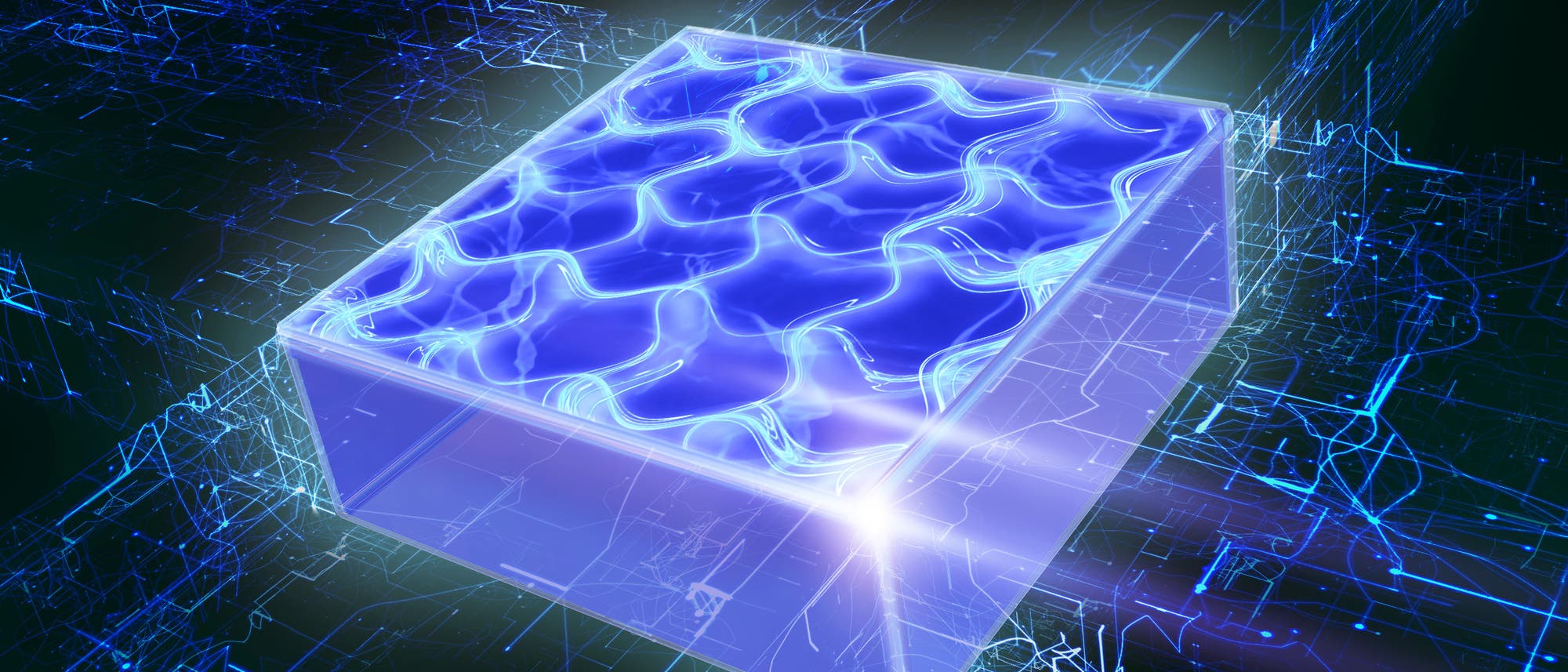
Im Jahr 1741 unternahmen die zwei englischen Forscher William Windham und Richard Pococke eine Expedition ins Tal von Chamonix. Dabei führte ihr Weg sie an einen besonderen Ort: das Mer de Glace. Dieser Gletscher, der sich an die Nordseite des Mont Blanc schmiegt, erstreckt sich über eine Fläche von fast 40 Quadratkilometern. Windham berichtete von dem atemberaubenden Schauspiel, das sich vor seinen Augen entfaltete: »Man stelle sich einen See vor, der von einer starken Brise bewegt wird und auf einmal gefriert.« Windhams poetisches Oxymoron spielt mit der Vorstellung eines vermeintlich unmöglichen Zustands der Materie, die gleichzeitig fest und flüssig ist.
Oder ist dieser Zustand vielleicht doch nicht ganz so abwegig? Seit rund 70 Jahren treibt die Physik die Frage um, ob es Materialien gibt, die spontan eine regelmäßige Anordnung wie in einem Kristall annehmen und gleichzeitig in der Lage sind, wie eine Flüssigkeit zu fließen – oder mehr noch: Das Fließen würde dank der Gesetze der Quantenmechanik ohne Reibung erfolgen, also mit einer Viskosität von null. Ähnlich verhält sich suprafluides Helium bei extrem niedrigen Temperaturen um minus 270 Grad Celsius.
Die Geschichte dieser »suprasoliden« Materialien, die sowohl fest als auch flüssig sind, ist von Kontroversen und Wendungen geprägt. Die Theoretiker brauchten lange, um sich davon zu überzeugen, dass dieser Materiezustand tatsächlich existieren kann. Dazu mussten sie ihre Forschungen manchmal unter einem völlig neuen Blickwinkel betrachten, um zu verstehen, warum bestimmte Argumente, die gegen die Existenz von Suprafestkörpern sprechen, nicht zutreffen. Und auch für Experimentalphysiker war die Suche nach dem Materiezustand kräftezehrend. Sie hangelten sich von Misserfolg zu Misserfolg, bis sie schließlich herausfanden, unter welchen Bedingungen sich dieses paradoxe System möglicherweise bildet.
Dann kam der Durchbruch. Die Existenz dieses suprasoliden Zustands wurde tatsächlich bestätigt. Zu beobachten war er in Systemen, in denen ihn anfangs niemand erwartet hätte: in stark verdünnten Atomgasen. Nun konzentrieren sich die Fachleute darauf, die Eigenschaften dieser erstaunlichen Materialien näher zu ergründen.
Ihren Anfang nahm die Suche im Jahr 1956. Sie schien unter keinem guten Stern zu stehen. In jenem Jahr diskutierten Oliver Penrose – Bruder des Mathematikers Roger Penrose – und Lars Onsager, der 1968 den Nobelpreis für Chemie erhielt, als Erste die Möglichkeit eines suprasoliden Zustands. Ihre Schlussfolgerung ließ wenig Grund zur Hoffnung: Ein solches Phänomen sei physikalisch unmöglich.
Fehlstart und neue Anläufe
Ihre bahnbrechende Arbeit beruhte jedoch auf einer Annahme, die sich später als anfechtbar erwies. In einem gewöhnlichen Kristall befinden sich die Atome genau an regelmäßig angeordneten Orten. In der Quantenmechanik ist das anders. Hier ist ein Objekt, beispielsweise ein Teilchen oder ein Atom, nicht immer an exakt einem Punkt im Raum lokalisiert. Stattdessen lässt es sich besser durch eine Welle beschreiben, die mehr oder weniger gestreckt ist; das Objekt ist delokalisiert.
Ein gewisser Grad an Delokalisierung ist allerdings auch erforderlich, um das Quantenverhalten der bereits bekannten Suprafluidität hervorzurufen. Da die beiden Eigenschaften – die lokalisierten Atome eines Kristalls und die Delokalisierung der Wellenfunktion bei der Suprafluidität – nicht gleichzeitig erfüllt werden können, sollten Suprasolide nach Ansicht der beiden Theoretiker nicht realisierbar sein. Es war ein Fehlstart, wie sich herausstellte, doch die Geschichte ging weiter.
Wie ist die absurd anmutende Idee der Suprafestkörper überhaupt entstanden, und was hat Oliver Penrose und Lars Onsager dazu veranlasst, deren Existenz zu diskutieren? Um das zu verstehen, müssen wir noch etwas weiter zurückblicken. Im Jahr 1937 entdeckte der Physiker Piotr Kapiza, dass flüssiges Helium-4 bei niedrigen Temperaturen eine verschwindend geringe Viskosität hat. Wie ließ sich dieses suprafluide Verhalten erklären? Bereits im folgenden Jahr äußerte der Physiker Fritz London eine geniale Interpretation, indem er einen Zusammenhang mit einem Kondensationsphänomen herstellte, das 1924 von Albert Einstein vorhergesagt worden war. Dieser stützte sich wiederum auf die Arbeiten des indischen Physikers Satyendranath Bose.
Einstein untersuchte zu jener Zeit das Quantenverhalten (man spricht von statistischem Verhalten) einer Gruppe von Teilchen, die nicht miteinander wechselwirken. Diese Familie von Teilchen wird heute Bosonen genannt. Sie sind definiert durch ihren ganzzahligen Spin, wie es beim Photon, aber auch beim Helium-4-Atom der Fall ist. Einstein schlug vor, dass sich in einem System bei niedriger Temperatur eine große Anzahl dieser Teilchen im selben Quantenzustand befinden kann. Sie hätten eine einzigartige Dynamik: Die Bosonen würden sich einheitlich verhalten und dabei über das gesamte System delokalisiert sein, was dem System sehr spezielle Eigenschaften verleiht. Man spricht von einem Bose-Einstein-Kondensat.
Bosonen, die in einem einzigen Quantenzustand kondensieren, hielten Physiker lange Zeit für ein theoretisches Konzept, das experimentell nicht umsetzbar ist. Bestärkt wurden sie in ihrer Annahme dadurch, dass dieser Materiezustand nur für Systeme ohne Wechselwirkung vorhergesagt wurde. In realen Systemen, in denen die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen nicht vernachlässigt werden können, sollte er demnach nicht existieren.
Allein das Vorhandensein von Wechselwirkungen erfordert bei der Bildung des Kondensats nämlich Energie. Das wiederum begünstigt den Ausstoß von Teilchen aus dem System, das sich dadurch entleert. Mit seinem Vorschlag, die Suprafluidität von Helium-4 durch die Kondensation von Bosonen zu erklären, sah sich Fritz London Anfang der 1940er Jahre zahlreichen Einwänden gegenüber, vor allem vonseiten des einflussreichen Lew Landau – der seine eigene Theorie der Suprafluidität entwickelte. Diese basierte auf einer Beschreibung, wie Atome des Suprafluids kollektiv angeregt werden können, was er allgemein als Quasiteilchen bezeichnete. Im Fall des suprafluiden Heliums unterschied Landau diese in zwei spezifische Arten von Anregungen bei niedrigen Energien: »Phononen« und »Rotonen«. Hier ist kein Bose-Einstein-Kondensat erforderlich. In unserer Geschichte werden diese Quasiteilchen eine entscheidende Rolle spielen.
Unterschiedliche Vorstellungen zur Deckung gebracht
1946 machte der russische Physiker und Mathematiker Nikolai Bogoliubow einen ersten Schritt, um die Ansichten von London und Landau in Einklang zu bringen. Er betrachtete theoretisch einen verdünnten Satz von Bosonen, die zwar wechselwirken durften, aber aufgrund der geringen Dichte des Systems nur schwach. Er nahm an, dass das Phänomen der Kondensation in diesem System auftritt, wie von London vorgeschlagen, und fand rechnerisch die Eigenschaften wieder, die Landau intuitiv angenommen hatte, um das Verhalten des suprafluiden Heliums zu erklären. Obwohl die Näherung der schwachen Wechselwirkungen nicht exakt auf den Fall des Heliums anwendbar ist, lieferte Bogoliubows Arbeit die erste Methode, mit der sich das Quantenverhalten von Gruppen wechselwirkender Teilchen untersuchen ließ.
Insbesondere stellte dieser Formalismus eine erste direkte Verbindung zwischen der Suprafluidität und der Kondensation bei Wechselwirkung her. Anders ausgedrückt: Suprafluidität tritt nur in einem System auf, dessen Atome eine makroskopische Quantenwelle bilden und über die Ausdehnung dieser Welle delokalisiert sind. Diese Beobachtung, die im Gegensatz zu den lokalisierten Atomen in Kristallen steht, führte Penrose und Onsager zehn Jahre später zu der Schlussfolgerung, dass Suprafestkörper nicht existieren könnten.
Ihr Argument sollte jedoch bald widerlegt werden. Ab 1957 betrachtete Eugene Gross, damals an der Brandeis University in den USA, in Fortsetzung von Bogoliubows Arbeit auch kondensierte Systeme, in denen die Atome denselben Zustand teilen und nur schwach wechselwirken. Während Bogoliubow den allgemeinen Fall der Wechselwirkung zwischen Teilchen untersucht hatte, ohne zu spezifizieren, wie sich die Kraft mit der Entfernung ändert, interessierte sich Gross für einen Sonderfall, bei dem die Teilchen über große Entfernungen hinweg wechselwirken und sich anziehen.
Das Argument von Penrose und Onsager, mit dem sie die Suprafestkörper widerlegten, wurde bald selbst widerlegt
Ein entscheidender Punkt liegt dabei in der Energie, die mit der Teilchenwechselwirkung zusammenhängt und die den Quantenzustand des Systems beschreibt. Wechselwirken Teilchen über größere Entfernungen miteinander, dann hängt diese Energie von der Wellenlänge der Wellenfunktion ab. Gross stellte die Hypothese auf, dass die Wechselwirkungsenergie für bestimmte Wellenlängen negative Werte annehmen kann. Das bedeutet, dass es sich für diese Wellenlängen um eine anziehende Kraft handelt.
Dabei entdeckte er, dass die Amplitude der Wellenfunktion des kondensierten Zustands räumlich moduliert werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, die Teilchen zu entdecken, folgt demnach einer räumlichen Periodizität; sie ist an einigen Punkten groß und an anderen sehr klein. Mit anderen Worten: Die bevorzugte Anordnung der Atome (dort, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, sie zu finden) ist ähnlich wie in einem festen Kristall.
Gross sagte somit die Existenz eines kondensierten Festkörpers voraus, der die Möglichkeit hat, sich suprafluid zu verhalten. Ein zentraler Aspekt dieses kondensierten Festkörpers ist, dass die Atome, die denselben Quantenzustand einnehmen, nicht an bestimmten Punkten fixiert sind, sondern im gesamten System delokalisiert sind, im Gegensatz zu dem von Oliver Penrose und Lars Onsager betrachteten Fall.
Spurensuche im Helium
Dieser Neuanfang bei den Suprasoliden war wegweisend. Ab Ende der 1960er-Jahre wurde er durch konkretere Arbeiten untermauert, die sich mit Helium befassten. Physiker interessierten sich dafür, wie Materie bei niedrigen Temperaturen und unter Druckänderung vom festen in den suprafluiden Zustand übergeht. Hier weist der Heliumkristall in der Nähe des Übergangs zahlreiche Löcher auf, das heißt unbesetzte Gitterstellen, die sehr beweglich sind. Das unterscheidet ihn von den von Penrose und Onsager betrachteten Kristallen. Im Jahr 1969 zeigten Alexander Andrejew und Ilja Lifshitz und unabhängig davon Geoffrey Chester theoretisch, dass die Gesamtheit dieser Löcher mit einem bosonischen Fluid gleichgesetzt werden kann. Dieses kondensiert bei niedrigen Temperaturen und verleiht dem Heliumkristall suprafluide Eigenschaften.
Die Sichtweise dieser neuen Arbeit, eines festen Zustands, der sich unter dem Einfluss von Quantenfluktuationen delokalisiert und bei dem die Atome im Kristall gewissermaßen von einem Loch zum anderen springen, scheint weit von Gross' Arbeit entfernt zu sein. Dort nimmt das Bose-Einstein-Kondensat eine kristalline Struktur an. Die beiden Ergebnisse lassen sich jedoch wie zwei Seiten derselben Medaille betrachten: Das eine nähert sich dem Suprafestkörper von einem normalen Festkörper aus, das andere aus der Richtung einer kohärenten Quantenflüssigkeit.
Während sich die Theorie von der Existenz solcher Festkörper durchzusetzen schien, blieb ungewiss, ob sie suprafluid sind. Im Jahr 1970 stellte der spätere Physik-Nobelpreisträger Anthony Leggett dann jedoch fest, dass das durchaus der Fall sein kann. Eine Möglichkeit, dies nachzuweisen, bestünde darin, den Festkörper zu verdrehen und sein Trägheitsmoment zu messen. Die Größe charakterisiert die Trägheit eines Systems gegenüber einer Drehbewegung und hängt von der Masse, aber auch von seiner Geometrie ab. Wenn das Moment einen kleineren Wert annimmt als in der klassischen Mechanik vorgesehen, muss man daraus schließen, dass sich mindestens ein Teil des Festkörpers unter der äußeren Belastung nicht in Bewegung setzt. Anders gesagt: Suprafluidität verringert die Reibung.
Lange Zeit blieben die Experimente erfolglos. Doch 2004 führten Eun-Seong Kim und Moses Chan von der Pennsylvania State University das Experiment von Anthony Leggett durch. Sie maßen die Schwingungsdauer von festem Helium, das einer Torsion unterzogen wurde, und beobachteten bei niedrigen Temperaturen ein anormales Verhalten. Sie interpretierten es als eine nichtklassische Änderung des Trägheitsmoments von festem Helium; ein Bruchteil des Feststoffs wäre demnach suprafluid. Diese umstrittene Schlussfolgerung regte zu weitergehenden Experimenten an – mit widersprüchlichen Ergebnissen. Hatte man endlich einen Suprafestkörper beobachtet? Moses Chan fand zusammen mit seinem Kollegen Duk Kim einige Jahre später die Antwort: nein. Das von ihm beobachtete Verhalten hing mit der Temperaturabhängigkeit bestimmter struktureller Eigenschaften der Probe zusammen und nicht mit suprafluidem Verhalten. Die Kontroverse war damit eigenhändig beendet.
Während damit die Chance schwand, einen Helium-Suprasoliden zu beobachten, keimte ein Hauch von Hoffnung im Zusammenhang mit extrem verdünnten Gasen aus Atomen auf. Deren Dichte ist eine Million Mal geringer als die unserer Umgebungsluft. Werden diese Gase auf sehr niedrige Temperaturen von wenigen milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt, offenbaren sich Quanteneigenschaften in makroskopischem Maßstab.
Wie bremst man Gasteilchen fast vollständig aus?
Die Herstellung solcher ultrakalten Gase war eine der großen wissenschaftlichen Herausforderungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Solche Quantengase erregten zunächst das Interesse der Fachgemeinde, weil sich mit ihnen die Möglichkeit bot, Einsteins ursprünglichen Vorschlag aus dem Jahr 1924 umzusetzen. Man könnte somit ein Kondensat aus Teilchen schaffen, die praktisch nicht miteinander wechselwirken und so – durch die bloße Wirkung der Quantenstatistik – einen neuen Materiezustand bilden. Mit dem Versuch, einen derartigen Zustand zu erreichen, hofften die Forscher, die Suprafluidität des Heliums in ein neues Licht zu rücken.
Nach jahrzehntelangen Bemühungen gelang es im Jahr 1995 Teams vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und vom JILA (einem Labor der University of Colorado in Boulder), Gaskondensate aus einigen Hunderttausend Rubidium- oder Natriumatomen zu erzeugen. Diese Experimente mit ultrakalten Gasen lassen sich inzwischen leicht durchführen und individuell anpassen. Sie haben seither unser Verständnis von Quantenmaterie enorm erweitert und ließen dabei auch Analogien zu vielen anderen Systemen zu, von Atomkernen bis hin zu Neutronensternen.
Obwohl ultrakalte Gase extrem verdünnt sind, sind sie nicht frei von Wechselwirkungen. Sie bilden ein System, das der ursprünglichen Bogoliubow-Theorie sehr ähnlich ist. Und auch wenn die Kräfte schwach sind, prägt ihre Anwesenheit viele Eigenschaften. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Alkalimetalle, die zuerst für diese Experimente verwendet wurden, bei niedrigen Temperaturen zwar sehr gut miteinander wechselwirken, allerdings durch unmittelbaren Kontakt. Es gibt keine Fernwechselwirkungen und erst recht keine Möglichkeit, diese für bestimmte Wellenlängen anziehend wirken zu lassen. Das jedoch war der entscheidende Punkt des Suprafestkörpermodells, das Gross 1957 formuliert hatte.
Die Chance auf einen Suprafestkörper schien in solchen Systemen auf den ersten Blick also sehr gering zu sein. Da sich die Parameter dieser Gassysteme aber verändern lassen, fragten sich die Fachleute bald, ob es möglich wäre, komplexere Wechselwirkungen zwischen den Atomen in diesen Gasen einzuführen, insbesondere in der von Gross vorgestellten Form. Einige konkrete Vorschläge drehten sich zum Beispiel darum, Atome oder Moleküle zu verwenden, die man sich als kleine Magnete vorstellen kann (etwa Chrom, ein Element der Übergangsmetalle, oder Dysprosium und Erbium, Elemente der Lanthanoide) und die magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkungen aufweisen. Andere, hybride Wege stützten sich auf Kopplungen zwischen den Atomen und Laserlicht. Solche Systeme wurden bald experimentell umgesetzt. Mit ihrer Hilfe beobachtete man das Phänomen der Quantenkondensation und den Effekt von Fernwechselwirkungen.
Der Baukasten, mit dem suprasolide Zustände zu erreichen sind, schien also komplett: formbare Gassysteme mit Wechselwirkungen, die durch äußere Felder quantitativ und qualitativ gestaltet werden können. Nach Gross' Vorgaben müsste man nur ein System finden, bei dem die Fernwechselwirkungen in einem bestimmten Wellenlängenbereich anziehend wirken.
Schuld war nur die Bosenova
Doch die Fachleute sahen sich noch einem Hindernis gegenüber: der »Bosenova«. Der Name lehnt sich an Supernovae an, die weithin sichtbaren Sternexplosionen im Universum, und zeugt von ihrem spektakulären Charakter. Bosenovae wurden erstmals bei Teilchen beobachtet, deren Kontaktwechselwirkung durch ein äußeres Magnetfeld gesteuert wird. Wenn der Wert des Magnetfelds so eingestellt wird, dass die anziehenden Wechselwirkungen dominieren, wird das System instabil. Wie bei einem Stern, dessen Brennmaterial im Kern aufgebraucht ist und bei dem die Schwerkraft die Hülle ungehindert nach innen zieht, kollabiert das Gas – und explodiert anschließend! Diese Instabilität gibt es auch bei Systemen mit Fernwechselwirkungen; so wurde sie bei Chromgasen beobachtet. Unglücklicherweise tritt die Bosenova genau an dem Punkt auf, an dem die anziehenden Wechselwirkungen eine dominante Rolle im Gas einnehmen und die Bildung eines Suprafestkörpers erwartet wird. Die Natur schien sich gegen diese Phase verschworen zu haben.
Theoretiker zeigten sich erfinderisch und schlugen verschiedene Tricks vor, um dem Problem mit dem explodierenden Gas entgegenzuwirken. Sie ersannen stabilisierende Mechanismen oder analoge Systeme ohne Instabilität. So haben im Jahr 2017 Teams des MIT und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich unter der Leitung von Wolfgang Ketterle und Tilman Esslinger zum ersten Mal Systeme mit suprasoliden Eigenschaften konstruiert.
Die Forscher nutzten Laserlicht, um bestimmte Eigenschaften der Atome zu verändern. Das Gas wies dann spontan eine räumlich periodische Dichte auf, es kondensierte also. Eine wichtige Komponente ließ sich bei den Experimenten jedoch nicht nachweisen. Damit ein fester Körper nämlich ein echter Festkörper ist, müssen sich Schwingungen in ihm ausbreiten können, ähnlich wie Schallwellen. Die Schwingungen des Festkörpers entsprechen kleinen Verschiebungen der Atome aus ihrer Gleichgewichtsposition im Kristallgitter. Das ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass der Abstand zwischen den Atomen in einem Festkörper nicht starr ist. Anders ausgedrückt: Ein Festkörper ist von Natur aus komprimierbar. Ob die in diesen Experimenten verwendeten Geräte durch Anpassung der Parameter die Existenz eines kompressiblen Suprafestkörpers offenbaren können, ist noch Gegenstand der Forschung.
Parallel zu diesen Arbeiten an hybriden Atom-Licht-Systemen wurden wichtige Entdeckungen auf der Jagd nach dem Suprafestkörper in Gasen gemacht, deren Atome einen starken magnetischen Dipol aufweisen. Sie wechselwirken daher über große Entfernungen miteinander. Im Jahr 2015 untersuchte das Team um Tilman Pfau an der Universität Stuttgart das Bosenova-Phänomen in einem System aus einigen 10 000 Dysprosiumatomen, einem Element, das viel stärker magnetisch ist als Chrom. Durch Anpassen des äußeren Magnetfelds brachten die Physiker das Kondensat in einen Zustand, in dem die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen insgesamt anziehend wirkten. Dabei beobachteten sie, dass die erwartete Bosenova nicht eintrat! Vielmehr reorganisierte sich das Gas und bildete stabile Strukturen, die deutlich dichter waren als das ursprüngliche Kondensat. Die Wissenschaftler nannten sie Tröpfchen. Das Ergebnis deutete darauf hin, dass ein unbekannter Mechanismus das magnetische Gas in dem angenommenen Bosenova-Regime stabilisierte.
Der Mechanismus, der dieser Stabilisierung zugrunde liegt, war zur Zeit dieser Beobachtungen unbekannt. Doch bald darauf wurde er entschlüsselt. Er ist ebenso subtil wie interessant und beruht auf kombinierten Kontakt- und Dipolwechselwirkungen. An dem Punkt, an dem die Explosion erwartet wird, wirken sich beide Kräfte entgegen und heben sich im Durchschnitt über das gesamte Gas auf. Es bleibt eine schwach anziehende Komponente übrig.
Da das Kondensat jedoch ein reines Quantenobjekt ist, bleibt es nicht auf sein durchschnittliches Verhalten beschränkt, sondern weist intrinsische Fluktuationen auf. Das bedeutet: Selbst dann, wenn sich die Wechselwirkung im Mittel aufhebt, können die Atome des Kondensats durch die Fluktuationen immer noch interagieren. Die resultierende Wechselwirkungsenergie erzeugt eine kurzreichweitige effektive Abstoßung zwischen den Atomen des kondensierten Gases, deren Amplitude mit der Gasdichte schnell zunimmt. Dies wirkt dem Kollaps des Systems entgegen und stabilisiert es.
Die Physiker näherten sich ihrem Ziel. Anstelle der Bosenova konnte im stabilisierten Dipolgas nun ein Phasenübergang zwischen dem suprafluiden Kondensat und einem Zustand mit modulierter Atomverteilung stattfinden – einem Suprasolid. Es blieb lediglich die Frage, ob es möglich war, die Delokalisierung der Atome des Kondensats und damit seine Kohärenz beim Übergang in den modulierten Zustand aufrechtzuerhalten, um einen Suprafestkörper und nicht nur einen einfachen Festkörper zu bilden. Denn bislang war nicht geklärt, ob die Kristallisation die Atome nicht zu stark an bestimmten Punkten im Raum konzentrieren und damit die makroskopische Wellenfunktion des Kondensats in einzelne Abschnitte an jedem Kristallort zerbrechen würde. Dadurch verlöre es seine suprafluiden Eigenschaften.
Im Jahr 2017 machten dann Francesca Ferlaino und ihre Arbeitsgruppe, zu der auch ich als Postdoc gehörte, an der Universität Innsbruck eine bedeutende Entdeckung. Wir wiesen nach, dass es möglich ist, eine rotonenartige Anregung in einem Kondensat aus etwa 100 000 magnetischen Erbiumatomen, das sich nahe seinem Tröpfchenzustand befindet, kohärent zu besetzen.
In der Landau-Theorie ist die rotonenähnliche Anregung ein Quasiteilchen des Suprafluids. Es entspricht einer Dichtewelle mit kurzer Wellenlänge und erstaunlich niedriger Energie. Während im Allgemeinen die Energie einer Anregungswelle mit abnehmender Wellenlänge zunimmt, zeichnet sich das Roton dadurch aus, dass es ein lokales Minimum für die Anregungsenergie bildet. Grundsätzlich lässt sich dieser niedrige Energiewert dadurch erklären, dass die anziehenden Wechselwirkungen bei bestimmten Wellenlängen auftreten, nämlich bei der Wellenlänge des Rotons, die der Möglichkeit eines suprasoliden Zustands nach Gross zugrunde liegen. Die Beobachtung unseres Innsbrucker Teams legte nahe, dass die rotonische Anregungsenergie frei und kontinuierlich durch einen äußeren Parameter wie ein Magnetfeld kontrolliert werden kann, bis sie sich aufhebt und zu einer rein imaginären Zahl wird. Zudem zeigte sich, dass sich in kurzer Zeit eine kohärente Dichtewelle als Vorläufer eines suprasoliden Zustands bilden kann.
Unsere im Jahr 2018 publizierte Beobachtung war auch deshalb von Bedeutung, weil sie eine bislang wenig beachtete Geometrie ans Licht brachte: ein axial gestrecktes, zigarrenförmiges Gas, bei dem die atomaren Dipole durch ein äußeres Magnetfeld quer ausgerichtet sind. Bis dahin hatten die Physiker vor allem scheibenförmige Geometrien verwendet, die theoretisch einfacher zu behandeln waren. Die Zigarrengeometrie erwies sich als vorteilhaft: Sie erleichterte bei einem festgelegten Wert der Kontaktwechselwirkung das Einstellen der anziehenden Teile der Dipolwechselwirkung bei kleinen Wellenlängen, die für den Roton von Interesse sind. Sie vereinfacht außerdem die Geometrie des mit dem Suprasolid verbundenen Kristalls – er ist in diesem Fall eindimensional. Durch diese Linienform kann der Suprafestkörper mit der Struktur der rotonischen Anregung im System verknüpft werden. Damit lässt sich dann auch der Übergang vom suprafluiden zum suprasoliden Zustand kontinuierlich gestalten – und damit günstig für eine experimentelle Umsetzung.
Fast gleichzeitig haben im Jahr 2019 unser Innsbrucker Team sowie zwei weitere Forschungsgruppen in Pisa und Stuttgart unter der Leitung von Giovanni Modugno beziehungsweise Tilman Pfau Zustände mit suprasoliden Eigenschaften experimentell realisiert. Dazu dienten Gase aus magnetischen Atomen von Erbium und zwei verschiedenen Isotopen von Dysprosium. Indem sie die Wechselwirkungsparameter feinsteuerten, erzeugten die Teams Zustände mit globaler Phasenkohärenz und einer spontanen Modulation der Atomdichte, die für einige zehn bis einige Hundert Millisekunden anhielt. Kurz darauf waren auch grundlegende Eigenschaften dieser suprasoliden Zustände zu beobachten. Dazu gehörte insbesondere, dass sich verschiedene Arten von Tönen im Suprafestkörper ausbreiten können. Einige Töne werden mit Kristallschwingungen und andere mit dem suprafluiden Massenfluss in Verbindung gebracht. Diese Ergebnisse demonstrieren sowohl den kompressiblen Aspekt des spontan gebildeten Festkörpers als auch seine suprafluiden Eigenschaften. Und sie veranschaulichen, wie reich an Dynamik dieser neue Zustand ist.
Diese ersten Beobachtungen haben neue Fragen aufgeworfen. Sie betreffen unter anderem das genaue Verständnis des suprafluiden Verhaltens dieser Feststoffe. Paradoxerweise ist der Anteil der Suprafluidität im System gering, obwohl alle Atome an der Suprafluidität teilhaben, da sie alle denselben Quantenzustand einnehmen. Darüber hinaus spielt die Temperatur eine wichtige Rolle und führt in diesen Systemen zu erstaunlichen Verhaltensweisen. So scheint eine höhere Temperatur einen kristallinen Zustand gegenüber einem gasförmigen zu begünstigen.
Weitere Versuche zielen darauf ab, Suprafluide mit einer komplexeren Kristallstruktur zu erzeugen. Dies würde ein reiches dynamisches Verhalten mit neuen Arten von Anregungen implizieren. Die ersten suprasoliden Zustände mit zweidimensionaler Ausdehnung wurden 2022 in Innsbruck beobachtet, aber ihre Struktur ist immer noch relativ einfach im Vergleich zu der Vielfalt, die man aus theoretischer Sicht erwarten würde. Neue Fallenkonfigurationen sowie die Kondensation von Molekülen, die viel stärker dipolar sind als magnetische Atome, versprechen weitere Entdeckungen in diesem Bereich.
Ein Aspekt in dieser epischen, mit Hindernissen gespickten Suche ist überdies bemerkenswert: In ihrem unbedingten Bestreben, einen suprasoliden Zustand zu verstehen und herzustellen, haben die Fachleute die statistische Quantentheorie auf die Spitze getrieben und damit die Grenzen unseres Wissens verschoben. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich der Suprafestkörper materialisiert. Ob dieser extreme und paradoxe Zustand zu Anwendungen führen wird, das ist noch nicht abzusehen. Wir setzen gerade die ersten Schritte auf dieses gewaltige Meer aus Quanteneis.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.