Tiefe Hirnstimulation: Hirnschrittmacher nach Maß
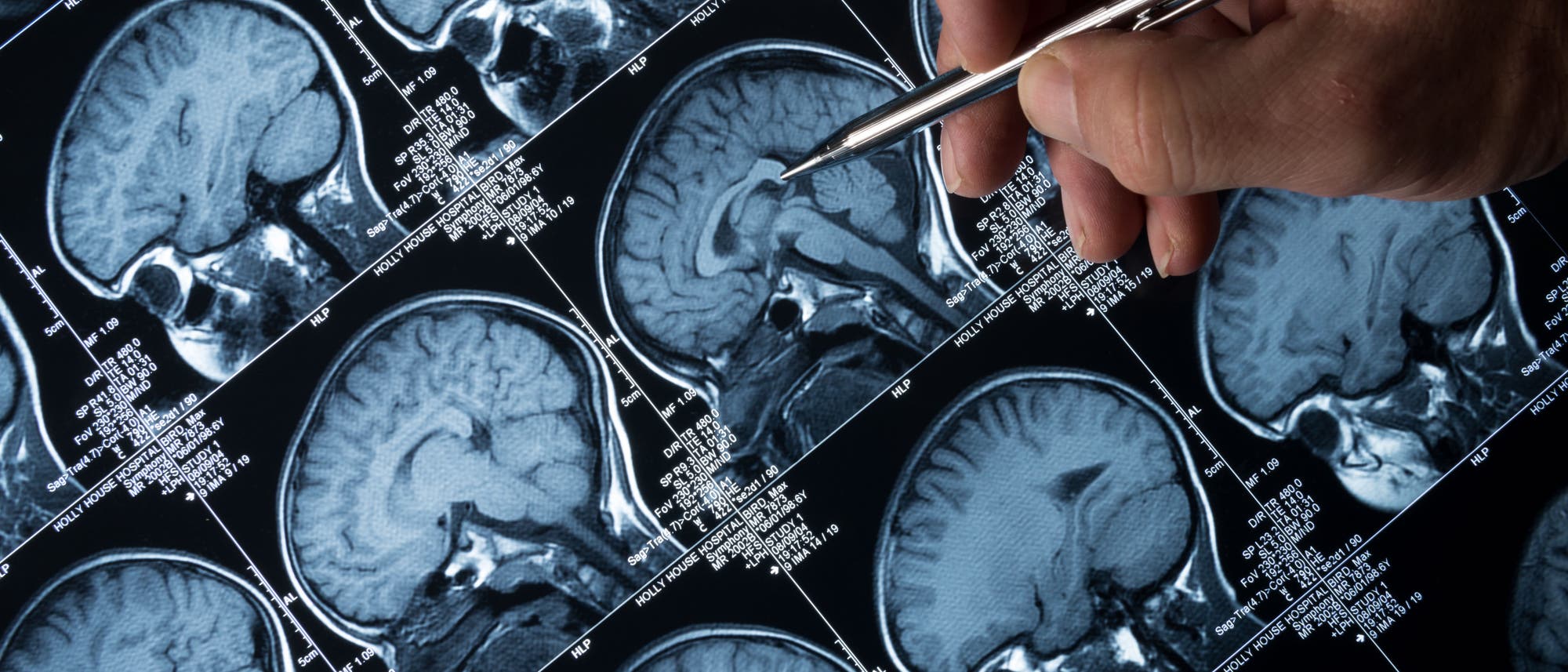
Manchmal ist es der einzige Weg: Wenn Patienten trotz intensiver Behandlung weiter unter Parkinson, Depressionen oder Zwangsstörungen leiden, greifen Ärzte zu ungewöhnlichen Mitteln. Sie bohren kleine Löcher in die Schädeldecke der Patienten und platzieren Elektroden ins Gehirn. Ein Impulsgeber, der unter die Haut auf den Brustmuskel implantiert wird, steuert den Stromfluss in den Elektroden. Das Ziel: Die Tiefe Hirnstimulation soll überaktive und aus dem Gleichgewicht gebrachte Hirnregionen wieder ausbalancieren.
Deutschlandweit bieten rund zwei Dutzend Kliniken Menschen mit Parkinsonerkrankung eine solche Operation an. Schätzungen zufolge haben sich weltweit bereits mehr als 160 000 Betroffene der OP unterzogen. Für Parkinson ist die Tiefe Hirnstimulation eine etablierte Therapie; für andere psychiatrische Erkrankungen wird das Verfahren derzeit noch in Pilotprojekten erprobt.
Bei welchen Störungen hilft die Tiefe Hirnstimulation?
Bei Parkinson sorgt ein Mangel des Botenstoffs Dopamin dafür, dass motorische Netzwerke im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten. Vor allem der überaktive Nucleus subthalamicus drückt auf die Bremse von Bewegungszentren. So kommt es zur krankhaft verlangsamten Motorik der Parkinsonpatienten. Gerade im fortgeschrittenen Stadium helfen Medikamente nicht mehr ausreichend, von Nebenwirkungen ganz zu schweigen. Die Stimulation des erbsengroßen Kerngebiets unterdrückt seine abnorme neuronale Aktivität. Die Behandlung kann die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern, zum Beispiel jungen Parkinsonpatienten wieder ein Berufsleben ermöglichen.
Während die Tiefe Hirnstimulation bei Parkinson schon lange in der klinischen Praxis angekommen ist, steckt man bei psychiatrischen Störungen wie Depressionen und Zwangsstörungen noch in der Experimentierphase. Bei therapieresistenten Depressionen, bei denen alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, werden Gebiete wie der Nucleus accumbens stimuliert, das so genannte Belohnungszentrum des Gehirns, das an Emotionen und Motivation beteiligt ist.
»Wir haben bei unseren Patienten mit schwerer therapieresistenter Depression eine Ansprechrate von rund 70 Prozent«
Thomas Schläpfer, Psychiater am Uniklinikum Freiburg und Pionier der Tiefen Hirnstimulation bei Depressionen
Wie gut die Stimulation bei Depressionen wirkt, ist allerdings umstritten: Manche Studien fielen positiv aus, andere negativ. Um einen Überblick zu bekommen, führten Forscher um den Neurochirurgen Frederick Hitti von der University of Pennsylvania 2020 eine Metaanalyse durch. Ergebnis: Die Hirnstimulation sorgte im Vergleich zu einer Scheinstimulation für deutlich niedrigere Depressionswerte. Positiv äußert sich auch der Psychiater Thomas Schläpfer vom Uniklinikum Freiburg, ein Pionier der Tiefen Hirnstimulation bei Depressionen. »Wir haben bei unseren Patienten mit schwerer therapieresistenter Depression eine Ansprechrate von rund 70 Prozent.« Seine Arbeitsgruppe konnte die Wirksamkeit auch in placebokontrollierten Studien nachweisen. Die Methode stehe aber am Ende aller therapeutischen Möglichkeiten, da sie zurzeit nur in klinischen Studien erprobt werde.
Ein ähnliches Bild offenbart sich bei therapieresistenten Zwangsstörungen. Auch hier wird vielfach der Nucleus accumbens anvisiert, da er etwa bei der Handlungskontrolle und Lernprozessen eine große Rolle spielt. Bei Menschen, die an Zwangsstörungen leiden, ist er übereifrig. Ihn herunterzuregeln, könnte die Patienten aus der Zwangsschleife quälender Gedanken und Handlungswiederholungen befreien. Zur Wirksamkeit gibt es zwar ebenfalls widerstreitende Befunde. Doch eine der aktuellsten Metaanalysen kam zu einem positiven Fazit: Die Tiefe Hirnstimulation könne Zwangssymptome effektiv verringern.
Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?
Grundsätzlich ist das Implantieren von Elektroden ins Gehirn mit Risiken verbunden. Wie bei anderen Operationen kann es zu Verletzungen von Gefäßen und zu Blutungen kommen. Drücken die Blutungen auf Hirngewebe, können in seltenen Fällen neurologische Symptome wie Lähmungserscheinungen auftreten. Infektionen mit Hirnhaut- oder Gehirnentzündung sind eine weitere Nebenwirkung. Im Fall von Parkinson kann die Stimulation zu Dysarthrie, also einer Sprechstörung führen oder zu unwillkürlichen Muskelbewegungen wie einem Zittern der Hand.
Über Nebenwirkungen bei Depressionen gibt wiederum die Metaanalyse von Frederick Hitti und seinen Kollegen Auskunft. Die meisten Patienten berichteten demnach von Kopfschmerzen, gefolgt von Sehstörungen, einer Verschlechterung der Depression, Schlafstörungen und Angst. Häufig waren die Nebenwirkungen jedoch nur vorübergehend oder konnten behoben werden, indem die Stimulation angepasst wurde.
Bei Zwangsstörungen zählen eine gedrückte Stimmung, vermehrte Unruhe und Impulsivität sowie Schlafstörungen zu den häufigeren, zum Großteil aber ebenfalls vorübergehenden Nebenwirkungen. Schwere Nebenwirkungen wie Suizidversuche sind deutlich seltener.
Welche Methode ist State of the Art?
Zum einen wegen der Nebenwirkungen, zum anderen um die Wirksamkeit der Tiefen Hirnstimulation zu verbessern, tüfteln Forscher an optimierten Verfahren. Bei der herkömmlichen Variante wird die Zielregion im Gehirn kontinuierlich stimuliert. Doch das ist offenbar weder nötig noch sinnvoll. Bei Parkinson schwanken die Bewegungsstörungen im Tagesverlauf. Die Idee ist nun, das Verfahren auf den Patienten zuzuschneiden und das Gehirn nur dann zu stimulieren, wenn es erforderlich ist. Forscher sprechen von einer adaptiven Stimulation.
»Mit Hilfe der adaptiven Tiefen Hirnstimulation wollen wir die Therapie für Parkinsonpatienten noch weiter verbessern«, sagt die Neurologin Andrea Kühn, Leiterin der Sektion Bewegungsstörungen und Neuromodulation an der Berliner Charité. Dafür verfolgen Kühn und andere Forscher im Nucleus subthalamicus, in dem die Elektroden implantiert sind, die so genannte Betaaktivität: eine synchrone Hirnaktivität im Beta-Frequenzbereich um 20 Hertz. »Die Betaaktivität verrät, ob der Patient sich gerade sehr gut bewegen kann oder nicht«, erläutert Kühn. »Wenn es dem Patienten schlecht geht, ist die Betaaktivität erhöht.«
Das Ziel ist nun, diese Aktivität kontinuierlich zu messen und sie immer dann, wenn sie zu stark ist, über die Hirnstimulation zu dämpfen. Laut Kühn erwies sich dieses Vorgehen in Laborstudien an kleinen Patientengruppen als sinnvoll. So verbessert sich etwa die Motorik bei der adaptiven Stimulation stärker als bei der kontinuierlichen. Und auf die Nebenwirkungen scheint sich der adaptive Ansatz ebenfalls positiv auszuwirken. Laut einer Studie von Martijn Beudel vom Amsterdam University Medical Center und Kollegen erwies sich die adaptive Stimulation nicht nur als effektiv. Sie führte anders als die kontinuierliche Stimulation auch nicht zu Sprechstörungen.
Wie sehen die neuesten experimentellen Ansätze aus?
Bei Depressionen und Zwangsstörungen sind Forscher bislang noch nicht so weit. In der Regel werden bei allen Patienten die gleichen Hirnareale stimuliert – obwohl sich ihre Symptome und Hirnzustände deutlich unterscheiden können. Doch auch hier gibt es erste Fortschritte, wie eine Fallstudie Anfang 2021 zeigte.
Die Gruppe um Psychiaterin Katherine Scangos von der University of California in San Francisco platzierte bei einer Patientin mit hartnäckigen Depressionen zehn Elektrodenleitungen an mehrere Stellen im Gehirn. Je nach Ort linderte die Stimulation unterschiedliche Symptome der Depression: Mal nahmen Angstzustände ab, mal hatte die Patientin wieder mehr Energie, mal gewann sie die Freude an alltäglichen Aktivitäten zurück. Bei der Stimulation der linken Amygdala etwa berichtete sie von einem »guten Gefühl« und davon, »munterer zu sein«.
Wie viel die Stimulation brachte, hing vom aktuellen Befinden der Patientin ab. Die Stimulation des orbitofrontalen Kortex wirkte nur dann positiv und beruhigend, wenn die Patientin gerade stark erregt war. War sie das nicht, ließ dieselbe Stimulation ihre Stimmung sinken. Die Gruppe um Katherine Scangos will nun Hirnsignaturen für individuelle mentale Zustände und Symptome von Patienten finden. Mit diesen Informationen könnten Stimulationsgeräte so programmiert werden, dass sie in Echtzeit mit gezielter Stimulation reagieren.
Etwas Ähnliches strebt ein Team um Robert Reinhart von der Boston University an, und zwar bei Zwangsstörungen. Zwanghaftes Verhalten entsteht möglicherweise durch übermäßiges Erlernen von Gewohnheiten, was zu einer übermäßigen Wiederholung von Handlungen führen kann. Anomalien in Schaltkreisen des orbitofrontalen Kortex belohnen solches Lernen. Dort setzten die Forscher an, allerdings nicht mit implantierten Elektroden. Vielmehr schickten sie Wechselstrom von außen durch den Schädel, angepasst an die per EEG erfassten individuellen Hirnaktivitätsmuster. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe bildete sich bei den derart stimulierten Probanden das zwanghafte Verhalten zurück, und der Effekt hielt bis zu drei Monate an. Die Forscher sehen ihren Ansatz als ersten Schritt hin zu einer personalisierten Behandlung von Zwangsstörungen.
Die Betaaktivität ist ein aussichtsreicher Kandidat für eine personalisierte Behandlung
Bei Depressionen und Zwangsstörungen steht die Forschung ziemlich am Anfang. Man fahndet noch nach Regionen und Aktivitätsmustern im Gehirn, mit deren Hilfe man die Stimulation individuell passend zuschneiden könnte. Bei Parkinson ist man schon weiter: Die Betaaktivität, die die momentane Schwere von Bewegungsstörungen widerspiegelt, ist ein aussichtsreicher Kandidat für eine personalisierte Behandlung.
Wie gut das im Alltag funktioniert, sei allerdings noch unklar, sagt Andrea Kühn. »Bislang gibt es nur kleine Laborstudien, bei denen die adaptive Stimulation am Patienten für einige Stunden getestet wurde.« Dabei wird eine Schwelle für den Betawert eingestellt, bei deren Überschreiten die Stimulation anspringt. Doch die Betaaktivität hängt von vielen Faktoren ab, etwa von Bewegungen und Medikamenten. »Hier muss sich erst zeigen, ob eine solche Schwelle auch alltagstauglich ist.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.