Unruh-Effekt: Wie Teilchen im Labor aus dem Nichts entstehen
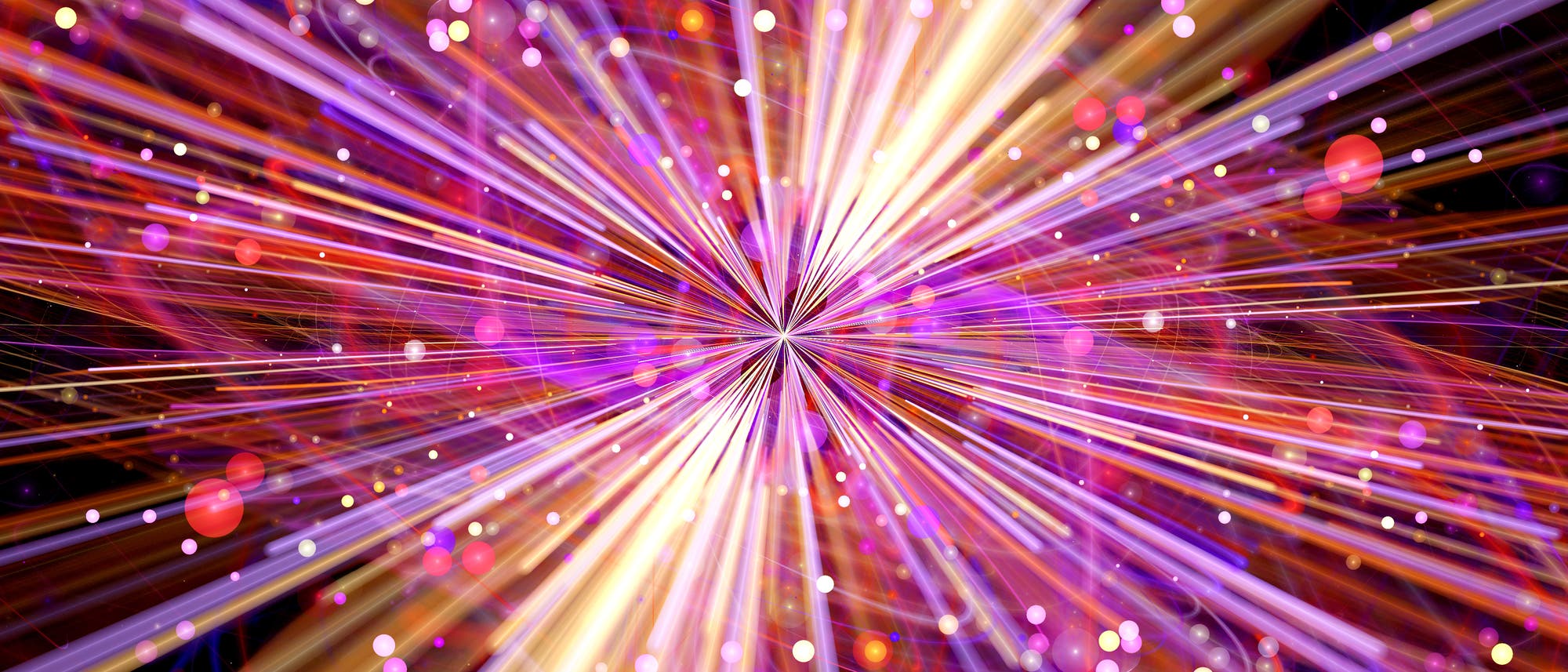
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen neben Han Solo und Chewbacca an Bord des Millennium Falken, eines der schnellsten Schiffe der Galaxis. Sie haben kaum Zeit, sich anzuschnallen, schon geht es los. Das Raumschiff beschleunigt und beginnt seine Reise durch den Hyperraum. Die dunkle Umgebung wird immer heller, während massenhaft leuchtende Punkte an Ihnen vorbeirauschen.
Star-Wars-Fans erinnern sich wahrscheinlich an die legendären Filmszenen, die Millionen von Menschen seit Jahrzehnten in ihren Bann ziehen. So spannend die Geschichte ist – mit echter Wissenschaft hat sie wenig zu tun. Denn eigentlich sollen die vorbeirasenden Lichtpunkte die Sterne darstellen, doch der Doppler-Effekt würde sie bei solchen Beschleunigungen unsichtbar machen. Trotzdem könnte die eingangs geschilderte Szene gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt sein. Die vorbeiziehenden Lichter kämen in diesem Fall nicht von den Sternen, sondern von aufpoppenden Partikeln. In den kommenden Jahren könnten Physikerinnen und Physiker sogar Zeuge davon werden.
Die Rede ist von einem relativistischen Phänomen, das im Gegensatz zur Krümmung von Raum und Zeit oder strahlenden Schwarzen Löchern der breiten Masse kaum bekannt ist: der Unruh-Effekt. Dieser beschreibt, was eine beschleunigte Person, die sich durch ein Vakuum bewegt, erlebt. Sie hat das Gefühl, durch eine Umgebung voller Teilchen zu fliegen, die eine erhöhte Temperatur erzeugen. Ein ruhender Beobachter sieht hingegen nichts von alledem – außer natürlich der sich bewegenden Person. Das verleiht der einsteinschen Relativitätstheorie eine ganz neue Dimension. Nun hängen nicht nur Zeitspannen und Distanzen vom Bezugssystem ab – sondern auch die Existenz von Teilchen!
Das Phänomen hat der Physiker William Unruh, aufbauend auf der Forschung von Steve Fulling und Paul Davies, Mitte der 1970er Jahre entdeckt. Doch die Arbeiten sind rein theoretischer Natur – direkt beobachten konnte den Effekt niemand. Grund dafür sind die extremen Bedingungen, die dafür nötig sind: Um eine Temperaturänderung von bloß einem Grad Celsius zu erleben, müsste man auf 1020 Meter pro Quadratsekunde beschleunigen – »also von null auf 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit innerhalb von 10−12 Sekunden«, erklärt Unruh.
»Der Unruh-Effekt ist eine Art Spielwiese für kompliziertere Phänomene wie die Hawking-Strahlung oder das expandierende Universum«Ulf Leonhardt, Physiker
Inzwischen gibt es zahlreiche ausgeklügelte Ansätze von Forscherinnen und Forschern, die es ermöglichen sollen, den Unruh-Effekt experimentell nachzuweisen. Viel versprechend ist unter anderem eine 2022 erschienene Arbeit von Achim Kempf und Barbara Šoda vom Perimeter Institute for Theoretical Physics und der University of Waterloo, die sie gemeinsam mit Vivishek Sudhir vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge verfasst haben. Darin schildern sie eine Methode, um den Unruh-Effekt zu verstärken und somit unter realistischen Laborbedingungen messbar zu machen. Hierfür greifen sie eine Idee von Albert Einstein auf, die zur Entwicklung von Lasern geführt hat.
Der Unruh-Effekt ist für Fachleute besonders spannend, weil er eng mit Schwarzen Löchern zusammenhängt. Wie der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking 1973 erkannte, sind diese galaktischen Ungetüme nicht einfach nur von luftleerem Raum umgeben, sondern strahlen Teilchen aus. »Der Unruh-Effekt ist eine Art Spielwiese für kompliziertere Phänomene wie die Hawking-Strahlung oder das expandierende Universum«, erklärt der Physiker Ulf Leonhardt vom Weizmann-Institut der Wissenschaften in Rechovot. Schwarze Löcher zählen zu den faszinierendsten Objekten unseres Universums, weil sie sowohl von der allgemeinen Relativitätstheorie als auch der Quantenfeldtheorie beeinflusst werden – den beiden grundlegenden Theorien, die die Welt beschreiben, aber miteinander unvereinbar sind.
Eine neue Auffassung von Raum und Zeit
1915 rüttelte Einstein an unserem traditionellen Weltbild, als er mit der von ihm formulierten allgemeinen Relativitätstheorie zeigte, dass sich die Schwerkraft geometrisch erklären lässt. In diesem Bild krümmt Masse die Raumzeit – und deren Geometrie bestimmt wiederum, wie sich die Materie darin fortbewegt. Seine Theorie betrifft alles Große, also jene Bereiche, in denen die Gravitation die übrigen Grundkräfte übertrumpft: von Planetenbahnen über die beschleunigte Ausdehnung des Universums bis hin zur Rotverschiebung der Lichter von weit entfernten Quasaren.
Die Quantenphysik widmet sich hingegen dem Mikrokosmos, wo die Schwerkraft oft vernachlässigbar ist und die übrigen drei Kräfte an Einfluss gewinnen: die elektromagnetische sowie die starke und die schwache Kernkraft. Das zu Grunde liegende Standardmodell der Teilchenphysik, das auf der Quantenfeldtheorie beruht, beschreibt die Welt der Elementarteilchen und ihr komplexes Zusammenspiel.
Das ganz Große und das ganz Kleine sind inzwischen ziemlich gut verstanden. Sobald man sich jedoch Situationen widmet, in denen die Schwerkraft und die übrigen drei Grundkräfte gleichermaßen zum Tragen kommen, steht man vor einem Rätsel. Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenphysik lassen sich bislang nicht vereinen – seit Jahrzehnten beißen sich die schlauesten Köpfe an dieser Aufgabe die Zähne aus.
Es gibt allerdings durchaus Phänomene, die eine Quantengravitationstheorie erfordern. Zum Beispiel, wenn man Schwarze Löcher oder den Urknall untersuchen möchte – beides Situationen, bei denen Materie auf kleinstem Raum zusammengepresst ist, so dass alle vier Grundkräfte Einfluss haben. Um solche Probleme anzugehen, müsste man herausfinden, wie Quantenfelder die Raumzeit krümmen und wie diese Krümmung wiederum die Felder beeinflusst. Die theoretische Grundlage für derartige Berechnungen fehlt bisher.
Dennoch haben Fachleute wie Hawking schon früh Methoden entwickelt, um solche Phänomene zumindest näherungsweise beschreiben zu können. Dafür lässt man typischerweise eine Hälfte des Problems weg. Man konzentriert sich beispielsweise nur darauf, wie sich Quantenfelder in gekrümmter Raumzeit verhalten, und ignoriert ihren Einfluss auf die Raumzeitgeometrie. Mit diesem Ansatz konnte Hawking berechnen, dass Schwarze Löcher eine nach ihm benannte Strahlung aussenden – und damit langsam »verdampfen«.
Sowohl bei der Hawking-Strahlung als auch beim Unruh-Effekt scheinen also Teilchen aus dem Nichts zu entstehen, wodurch das Vakuum eine endliche Temperatur erhält. Grund für die erstaunliche Materialisierung ist eine Eigenheit der Relativitätstheorie. Noch im selben Jahr, in dem Einstein seine Gleichungen veröffentlichte, erkannte der Astronom Karl Schwarzschild, dass die Formeln seltsame Lösungen zulassen, wenn sich viel Masse auf kleinem Raum konzentriert. Dann wächst die Schwerkraft des Körpers stark an, was dazu führen kann, dass die Fluchtgeschwindigkeit ab einer bestimmten Distanz die Lichtgeschwindigkeit übersteigt. Das heißt, man müsste unterhalb dieser Grenze (die als Ereignishorizont bekannt ist) schneller fliegen als das Licht, um der starken Gravitation zu entkommen. Sobald ein Objekt – selbst ein masseloses Photon – den Ereignishorizont passiert, kann es der Anziehung nicht mehr entgehen. Weil nicht einmal Licht entweichen kann, werden solche extrem dichten Himmelskörper als Schwarze Löcher bezeichnet.
Ereignishorizonte schotten also einen Teil der Raumzeit von den übrigen Bereichen ab. Egal, was sich hinter einem Ereignishorizont abspielt, es hat gemäß der Relativitätstheorie keinerlei Einfluss auf den Rest, weil es die anderen Gebiete niemals erreichen kann. Das wirft zahlreiche Fragen auf, unter anderem physikalischer und philosophischer Natur. Besonders spannend werden Horizonte, wenn man sie unter quantenphysikalischen Aspekten untersucht.
Es gibt kein Nichts
Denn nicht nur Einstein hat Anfang des 20. Jahrhunderts unser Weltbild auf den Kopf gestellt. Quantenphysiker haben in den 1920er Jahren das Verständnis von Teilchen und Wellen umgekrempelt, die beiden Begriffe lassen sich nicht mehr klar voneinander trennen. In den kommenden Jahren entwickelten Fachleute die Quantenmechanik weiter, und es gelang ihnen, sie mit der speziellen Relativitätstheorie in Einklang zu bringen. Das war die Geburtsstunde der Quantenfeldtheorie. Sie ist bis heute das vorherrschende Modell, um die elektromagnetischen und die zwei Kernkräfte zu beschreiben. Ihr zufolge ist die Raumzeit nicht leer, sondern von Quantenfeldern durchzogen, die jeden Winkel unseres Universums ausfüllen. Wie auf einer gespannten Membran können innerhalb der Felder Schwingungen entstehen, so genannte Anregungen: Wenn beispielsweise ein fester Punkt auf und ab oszilliert, entspricht das einem Elementarteilchen an einem bestimmten Ort.
Selbst im Vakuum sind Quantenfelder niemals völlig statisch, sie wabern ständig um den energetisch niedrigsten Zustand herum. Deshalb ist das Vakuum keineswegs langweilig und leer, sondern ein aufregender Ort. Durch die Schwingungen der Membran entstehen durch »Quantenfluktuationen« unentwegt »virtuelle« Teilchen, die sich gleich darauf wieder vernichten. Sie heißen virtuell, weil sie sich von den langlebigen, gewöhnlichen Partikeln unterscheiden. Man kann virtuelle Teilchen nicht direkt messen – ihren Einfluss aber schon.
So etwa beim Casimir-Effekt: Dieser beschreibt zwei Metallplatten, die sich wie durch Zauberhand gegenseitig anziehen – und zwar nicht wegen des geringen gravitativen Effekts, den sie aufeinander ausüben. Die Erklärung dafür geht auf Quantenfluktuationen zurück. Die Schwingungen der elektromagnetischen Felder müssen innerhalb der zwei Platten gewisse Randbedingungen erfüllen (so passt nicht jedes virtuelle Photon mit beliebiger Wellenlänge in diesen Bereich). Deshalb ist die Anzahl der Oszillationen, die im Zwischenraum entstehen können, begrenzt. Außerhalb der Metallplatten ist das anders, dort können alle möglichen Schwingungen und damit virtuelle Partikel auftreten. Da das Vakuum damit innerhalb der Platten »leerer« ist, werden sie zusammengedrückt.
Wenn schon zwei Platten das Vakuum so durcheinanderbringen – was bewirkt dann erst ein unpassierbarer Ereignishorizont? Diese Frage könnte sich Stephen Hawking gestellt haben, als er Quantenfelder in der Nähe von Schwarzen Löchern untersuchte. Ereignishorizonte stellen einen Bruch dar; eine klare Grenze, die Information nicht überschreiten kann. Das quantenphysikalische Vakuum sieht unter dem Einfluss starker Gravitation mit einem Ereignishorizont völlig anders aus als in jener näherungsweise unendlich ausgedehnten, relativ flachen Raumzeit, die wir wahrnehmen. Es ist, als würde man die Schwingungsmembran entlang des Horizonts festhalten. Jener Bereich schwingt nicht mehr mit und ist vom Rest der Oberfläche abgeschirmt. Die Fixierung bewirkt, dass einige oszillierende Wellen am Rand reflektiert werden, während andere komplett fehlen. Die Folge ist drastisch: Manche Schwingungen können sich beispielsweise nicht mehr gegenseitig aufheben, wodurch in der Nähe eines Ereignishorizonts plötzlich Teilchen entstehen, die in der flachen Raumzeit nicht da sind. Die Situation ist also gegensätzlich zum Casimir-Effekt. Während die zwei Metallplatten dazu geführt haben, dass das Vakuum leerer wird, erhöhen Ereignishorizonte die Teilchenzahl.
Hawking erkannte auf diese Weise, dass Schwarze Löcher verdampfen. Denn sie geben wie ein Schwarzkörper allerlei Strahlen gleichmäßig in alle Richtungen ab. Damit lässt sich den galaktischen Ungetümen eine Temperatur zuordnen. Messen konnte man das bisher jedoch nicht. »In der Umgebung von Schwarzen Löchern ist jede Menge los, von Akkretionsscheiben bis zu kosmischen Jets«, erklärt der theoretische Physiker Achim Kempf, »es ist schwer, darunter die Hawking-Strahlung auszumachen.« Zudem entspricht die Wellenlänge der abgegebenen Strahlung ungefähr ihrem Schwarzschild-Radius, der von etwa zehn bis hin zu Millionen Kilometern reicht. »Deshalb sind sie extrem kalt. Diese Temperatur lässt sich unmöglich messen«, so Kempf. Für Experimentalphysiker liegen Schwarze Löcher ebenfalls außerhalb der Reichweite, »schließlich hätten wir ein Problem, wenn wir sie in unseren Laboren erzeugen würden«, sagt Vivishek Sudhir. Das hat ihn, Šoda und Kempf dazu gebracht, sich anderen Systemen zuzuwenden, um quantenphysikalische Phänomene in der Nähe von Ereignishorizonten zu studieren.
Wie sich herausstellt, sind Schwarze Löcher nicht die einzigen Objekte, die einen Ereignishorizont besitzen. Tatsächlich sind diese unpassierbaren Grenzen sogar viel verbreiteter, als man denkt: Sie brauchen sich nur von Ihrem Stuhl zu erheben, und schon erzeugen Sie einen Ereignishorizont. Ein solcher entsteht nämlich durch jede Form von Beschleunigung – ganz gleich, wie stark sie ist. Im Alltag nehmen wir aber weder eine steigende Temperatur noch eine Umgebung voller Teilchen wahr, wenn wir uns in Bewegung setzen oder bremsen. Denn der Unruh-Effekt ist sehr schwach. Da beschleunigte Systeme trotzdem wesentlich nahbarer sind als weit entfernte Schwarze Löcher, haben sich zahlreiche Physikerinnen und Physiker zum Ziel gesetzt, den Unruh-Effekt im Labor nachzuweisen.
Jede Art von Beschleunigung erzeugt einen Ereignishorizont
Dafür muss man zunächst verstehen, warum Beschleunigung überhaupt einen Ereignishorizont erzeugt. Einen ersten Hinweis liefert das Äquivalenzprinzip, wonach es zumindest lokal gesehen keinen Unterschied zwischen Beschleunigung und Gravitation gibt. Ein aufsteigender Fahrstuhl fühlt sich ebenso an, als wäre die Erdanziehungskraft stärker. Wenn die Schwerkraft einen Ereignishorizont erzeugen kann, gilt das auch für Beschleunigung.
Stellen Sie sich vor, eine Person rennt aus der Ferne extrem schnell (mit nahezu Lichtgeschwindigkeit) auf Sie zu, wird immer langsamer, bis sie in Ihrer Nähe stehen bleibt, und dampft dann wieder in die entgegengesetzte Richtung mit wachsender Geschwindigkeit ab. Die Person hat die ganze Zeit über gleichmäßig beschleunigt, wenn man Abbremsen als negative Beschleunigung betrachtet. Um solche Ereignisse zu veranschaulichen, nutzt man so genannte Minkowski-Diagramme. Dabei handelt es sich um ein zweidimensionales Koordinatensystem, wie man es aus der Schule kennt. Allerdings stellt die y-Achse die Zeitrichtung (ct) dar, während die x-Achse einer einzigen Raumrichtung entspricht. Die seltsame Begegnung mit der sich beschleunigenden Person lässt sich in einem solchen Diagramm grafisch darstellen.
»Ich kam zu dem Schluss, dass die Existenz von Teilchen von der Bewegung eines Detektors abhängt, mit dem die Partikel gemessen werden«William Unruh, Physiker
Da Sie selbst dabei die ganze Zeit über am selben Ort verharrt haben, folgt Ihre »Bahnkurve« der y-Achse. Ein anderes Objekt wird aus Ihrer Sicht eine Spur im Diagramm hinterlassen, die sowohl in x- als auch y-Richtung verlaufen kann: etwa eine steile Gerade, wenn es sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Die Achsen im Minkowski-Diagramm sind so skaliert, dass die Lichtgeschwindigkeit einer Geraden mit Steigung eins entspricht. Damit muss die Bahnkurve eines Objekts stets steiler sein, da es sich sonst schneller als das Licht bewegen würde, was gemäß der speziellen Relativitätstheorie nicht möglich ist. Wenn eine Person konstant beschleunigt (wie jene, die auf Sie zugerannt kam), wird sich ihre Trajektorie immer stärker an eine Gerade mit Steigung eins annähern, ohne sie jemals zu erreichen – wie eine Hyperbel, die sich an die Koordinatenachsen schmiegt.
Diese Bahnkurve von beschleunigten Objekten hat extrem spannende Eigenschaften. Zum Beispiel könnte die Gerade mit Steigung eins, an die sich die Kurve nähert, von einem Signal mit einer Nachricht stammen, das Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bewegungsrichtung der Person geschickt haben (siehe »Minkowski-Diagramm«). Die Nachricht wird die Person aber niemals erreichen – ebenso wenig wie alle anderen Lichtstrahlen, die von einer Quelle links von Ihrer Position im gezeigten Minkowski-Diagramm ausgesandt werden. Damit markiert die Gerade, an die sich die hyperbolische Bahnkurve schmiegt, einen Ereignishorizont. Alles, was sich jenseits davon abspielt, wird den beschleunigten Beobachter niemals erreichen – weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Bei gleichförmig bewegten oder ruhenden Objekten ist das anders. Wenn man nur lange genug wartet, wird sie jeder Lichtstrahl aus egal welcher Ecke des Universums erreichen. Überraschenderweise spielt es keine Rolle, wie groß oder klein die Beschleunigung ist. Selbst eine so banale Handlung wie das Losfahren bei einer grünen Ampel erzeugt einen Horizont.
Ähnlich wie bei einem Schwarzen Loch hat das erstaunliche Auswirkungen. Da der Ereignishorizont nur für die beschleunigte Person existiert, nimmt ein ruhender Beobachter den luftleeren Raum als Ort wahr, in dem es gelegentliche Fluktuationen gibt – mehr nicht. Das beschleunigte Bezugssystem ist allerdings von manchen Bereichen der Raumzeit abgeschottet. Dadurch tritt wieder das Phänomen in Kraft, das sich durch eine festgehaltene Schwingungsmembran veranschaulichen lässt: Die wabernden Quantenfelder haben dann eine andere Form als aus ruhender Perspektive. Deshalb nimmt die beschleunigte Person lauter Teilchen wahr, die eine bestimmte Temperatur haben; sie befindet sich in einer Art Wärmebad.
»Ich hatte mich in den 1970er Jahren mit der Frage beschäftigt, wie sich ein Teilchen in Quantenfeldtheorien definieren lässt«, erzählt der Entdecker des Effekts, William Unruh. »Die Entdeckungen von Hawking, Fulling und Parker ließen mich zu dem Schluss kommen, dass die Existenz von Teilchen von der Bewegung (insbesondere der Beschleunigung) eines Detektors abhängt, mit dem die Partikel gemessen werden.«
Schwarze Löcher und beschleunigte Systeme sind sich ähnlich
Wie passen diese zwei verschiedenen Bilder zusammen? Angenommen, die beschleunigte Person würde ein Messgerät mit sich führen, das klickt, sobald es ein Teilchen absorbiert. Das Klicken könnten Sie, während die Person an Ihnen vorbeisaust, ebenfalls hören. Wie sich herausstellt, könnten Sie in dem Fall beobachten, wie der Detektor ein Partikel ausstrahlt. Grund dafür ist, dass das Gerät aus elektrischen Ladungsträgern besteht, etwa Protonen und Elektronen. Wenn diese sich beschleunigt durch den Raum bewegen, regen sie das elektromagnetische Quantenfeld an und produzieren damit Photonen. Auf der anderen Seite kann das Feld ebenfalls die Ladungen anregen. So werden Prozesse möglich, die in ruhenden Systemen niemals stattfinden, etwa dass ein Teilchen angeregt wird (der Detektor klickt) und gleichzeitig ein Photon aussendet. Ein beschleunigtes Messgerät emittiert aus ruhender Perspektive also Strahlung – ähnlich wie ein Schwarzes Loch.
Um den Unruh-Effekt nachzuweisen, müsste man daher einen Detektor beschleunigen und beobachten, ob dieser tatsächlich strahlt. Dafür bräuchte man Beschleunigungen von mindestens 1020 Metern pro Quadratsekunde, wodurch zirka 25 Milliarden Milliarden G-Kräfte ausgeübt werden. Das ist mit einem makroskopischen Detektor natürlich nicht möglich.
Doch man kann auch ein vereinfachtes System als Messgerät einsetzen, etwa ein Atom mit zwei Energiezuständen. Ein solches Teilchen kann Photonen bestimmter Energie nachweisen, indem es ein entsprechendes Lichtteilchen absorbiert. Dann geht es vom Grund- in einen angeregten Zustand über. Der Unruh-Effekt würde sich zeigen, wenn man das Atom stark beschleunigt. In diesem Fall könnte es angeregt werden und dabei ein Photon ausstrahlen. Allerdings gestaltet sich der experimentelle Nachweis aus verschiedenen Gründen schwierig.
Zwar ist es möglich, geladene Partikel wie Ionen in Teilchenbeschleunigern stark zu beschleunigen. Dabei überschattet jedoch etwas anderes den möglicherweise entstehenden Unruh-Effekt: die bereits erwähnte elektromagnetische Strahlung, die Ladungen massenhaft aussenden, sobald man sie beschleunigt – die so genannte Bremsstrahlung. Das macht es sehr schwer, innerhalb der emittierten Photonen eines geladenen Teilchens den winzigen Anteil des Unruh-Effekts auszumachen.
2019 haben Physiker um Morgan H. Lynch vom Technion in Haifa behauptet, genau das zu können. Im Spektrum beschleunigter Positronen meinen die Forscher, Hinweise auf den Unruh-Effekt ausgemacht zu haben. Andere Fachleute zeigen sich allerdings skeptisch, so auch Ralf Schützhold, Direktor des Instituts für Theoretische Physik am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf: »Das ist eine interessante Idee«, erklärt er. »Aber ich denke, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um zu verstehen, welche Ergebnisse als Signaturen des Unruh-Effekts interpretiert werden könnten und welche anderen Phänomenen zuzuschreiben sind.« Zudem seien bei der Auswertung der experimentellen Daten viele Vereinfachungen getroffen worden. »Man braucht eine extrem reine Versuchsumgebung mit möglichst wenig Teilchen, die man sehr gut kontrollieren kann, um einen so subtilen Effekt nachzuweisen«, betont Vivishek Sudhir, der in seinem Labor am MIT Hochpräzisionsmessungen durchführt. »Insgesamt ist sich der Großteil der Physik-Community einig, dass der Effekt noch nicht direkt beobachtet wurde«, sagt Leonhardt.
Das Problem ist die Eigenzeit
Um das Problem mit der Bremsstrahlung zu umgehen, kann man ungeladene Atome beschleunigen. Allerdings geht das nicht so einfach wie bei geladenen Teilchen, denn Erstere lassen sich nicht durch Magnetfelder auf Kreisbahnen zwingen. Beschleunigt man ein Atom etwa mit Hilfe eines Lasers entlang einer geraden Strecke, sind die Zeitspannen, in denen man es beobachten kann, ziemlich kurz. »Das Problem ist die Eigenzeit des Teilchens«, sagt Leonhardt. Denn gemäß der speziellen Relativitätstheorie vergeht die Zeit für ein bewegtes Objekt langsamer als für ein ruhendes. Damit der Unruh-Detektor (das beschleunigte Teilchen) überhaupt eine Chance hat, mit den aus dem »Nichts« entstehenden Partikeln zu wechselwirken, muss eine größere Zeitspanne vergehen. »Wir ruhenden Beobachter müssen richtig lange warten, währenddessen das Teilchen riesige Strecken zurücklegt«, so Leonhardt.
Einen Hinweis auf den Unruh-Effekt könnten Protonen liefern, die zusammen mit den Neutronen die Bausteine der Atomkerne bilden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Elementarteilchen, Protonen und Neutronen bestehen aus jeweils drei Quarks. Ein freies Neutron, das nicht in einem Kern gebunden ist, ist nicht stabil. Es hat eine Halbwertszeit von rund zehn Minuten und zerfällt dann in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino (ein extrem leichtes Elementarteilchen ohne elektrische Ladung). Gemäß dem Standardmodell sollten Protonen hingegen stabil sein. Das untermauern auch experimentelle Ergebnisse. Bisher wurde noch nie ein Protonenzerfall beobachtet. Falls das Standardmodell nicht zutrifft und das Teilchen doch zerfällt, haben Physikerinnen und Physiker eine obere Grenze für die entsprechende Halbwertszeit angegeben: Demnach beträgt sie mindestens 1034 Jahre – wesentlich länger, als unser Universum bisher alt ist. Selbst wenn das Proton instabil wäre, ist es extrem unwahrscheinlich, diesen Prozess jemals zu beobachten.
Die Situation könnte sich ändern, falls man ein Proton stark beschleunigt. Durch den Unruh-Effekt würde es nicht mehr durch einen teilchenleeren Raum fliegen, sondern durch ein Wärmebad voller Teilchen. So besteht die Möglichkeit, dass es auf ein Elektron und ein Antineutrino trifft. Damit ließe sich der Neutronenzerfall umkehren. Aus dem Proton und den beiden anderen Partikeln könnte ein Neutron hervorgehen. Allerdings wären dafür extrem hohe Beschleunigungen nötig. Zudem ist unklar, ob nicht die auf die Protonen ausgeübte Kraft ihren Zerfall bedingt hätten.
Auch wenn ein direkter Nachweis des Unruh-Effekts bisher nicht möglich war, weisen einige Messungen dennoch auf dessen Existenz hin. Zumindest könnte der Effekt ein seltsames Phänomen erklären, das man schon in den 1980er Jahren bei kreisförmig beschleunigten Elektronen beobachtet hat. Teilchenbeschleuniger erzeugen starke Magnetfelder, die den Spin (eine Art intrinsischer Drehimpuls) der Teilchen beeinflussen. Bei einer Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt müssten die Spins aller Elektronen gleich ausgerichtet sein. Doch in Laborversuchen gibt es immer einige Außenseiter, deren Spin in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Ein solches Verhalten würde man bei einer höheren Temperatur erwarten. Wie der renommierte Physiker John Bell erkannte, kann der Unruh-Effekt die Beobachtung erklären. Aus Sicht der beschleunigten Elektronen rasen diese nicht durch das Vakuum bei etwa minus 273 Grad Celsius, sondern durch einen Raum voller Teilchen mit höherer Temperatur. Das bewirkt, dass einige ihren Spin umkehren. »Man könnte also gewissermaßen sagen, dass der Unruh-Effekt schon nachgewiesen wurde«, erklärt Sudhir. »Allerdings lässt sich in einem Teilchenbeschleuniger, wo viele Elektronen miteinander wechselwirken, nicht ausschließen, dass vielleicht andere Prozesse die Beobachtungen verursachen.«
Neben solchen Messungen gibt es weitere Bemühungen, den Unruh-Effekt besser zu verstehen. Eine Möglichkeit bieten so genannte Analogexperimente. Man nutzt sie, um Phänomene zu untersuchen, die sich im Labor nicht realisieren lassen. Dafür kreiert man ein System, das nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat, sich aber aus mathematischer Sicht ähnlich verhält. Auf diese Weise wurden bereits vierdimensionale Materialien, Schwarze Löcher oder Wurmlöcher untersucht. Inzwischen haben Physikerinnen und Physiker mit Analogsystemen den Unruh-Effekt unter die Lupe genommen.
Kalte Atome als Modellbaukasten
Ein beliebtes Werkzeug für solche Experimente stellen ultrakalte Atome dar. Dazu fängt man die Teilchen mit ausgeklügelten Lasersystemen und bremst sie ab, so dass ihre Temperatur nur knapp über dem absoluten Temperaturnullpunkt liegt. Die Atome kondensieren dann in einen gemeinsamen Grundzustand und bilden ein Bose-Einstein-Kondensat. Durch geeignete Einstellung der umliegenden Laser und Magnetfelder lassen sich Wechselwirkungen zwischen den Atomen nach Wunsch kreieren – und damit physikalische Situationen nachahmen, die sonst unerreichbar sind. Im Fall des Unruh-Effekts könnte man so beispielsweise die Vakuumfluktuationen verstärken und ein beschleunigtes Objekt imitieren.
Das haben Fachleute um Cheng Chin von der University of Chicago im Jahr 2019 realisiert, indem sie 60 000 Cäsiumatome auf zehn milliardstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt herunterkühlten. Auch wenn sich die Teilchen kaum bewegten, ahmten sie durch die passend eingestellten Lasersysteme und Magnetfelder die Situation eines sich beschleunigt bewegenden Detektors nach. Ihr Verhalten lässt sich durch dieselben mathematischen Gleichungen beschreiben. Ein weiterer Laser diente als Analogon für die Vakuumfluktuationen. Nach nur wenigen Millisekunden konnten die Physiker beobachten, wie die Cäsiumatome in alle Raumrichtungen ausgestrahlt wurden – ähnlich der thermischen Strahlung eines Ofens. »Die Temperatur, die wir den Aufnahmen entnommen haben, passt hervorragend zu den Vorhersagen von Unruh«, sagte Chin zu »Phys.org«.
Ulf Leonhardt und seine Kollegen haben zwei Jahre zuvor den Unruh-Effekt ebenfalls simuliert – allerdings mit einem ganz anderen Analogsystem: mit Wasserwellen. Ihre Idee bestand darin, eine Wasseroberfläche mit einem Laser zu bescheinen und diesen wie ein gleichmäßig beschleunigtes Objekt in einem Minkowski-Diagramm zu bewegen. Das Wasser im Tank sollte so angeregt werden, dass das Wellenrauschen entlang der y-Achse (der Position eines ruhenden Beobachters) den Mustern von Vakuumfluktuationen entspricht. Ein etwas vereinfachtes Experiment haben die Forscher um Leonhardt genutzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines beschleunigten Beobachters zu untersuchen. So konnten sie nachweisen, dass dieser nicht einfach nur ein Rauschen, sondern echte Anregungen wahrnahm – als ob reale Teilchen da wären.
Das Problem an Experimenten zum Unruh-Effekt, die auf einer rein mathematischen Analogie basieren, ist jedoch, dass man damit die Theorie nicht direkt bestätigen kann. Man kann lediglich die mathematischen Gleichungen simulieren. Falls sich die komplizierten Gleichungssysteme, die beispielsweise das Verhalten von Teilchen vorhersagen, nur schwer berechnen lassen, sind solche Experimente äußerst hilfreich. Das tatsächliche Verhalten eines beschleunigten Beobachters damit zu belegen oder zu falsifizieren, ist jedoch unmöglich.
Deshalb haben Silke Weinfurtner von der University of Nottingham, Jörg Schmiedmayer von der TU Wien sowie William Unruh, der Erfinder des Effekts, ein Experiment vorgeschlagen, das den Unruh-Effekt auf andere Art nachweisen könnte. Zwar finden die Messungen nicht im Vakuum statt, so dass man weiterhin von einem Analogexperiment sprechen kann, doch die Forscherinnen und Forscher wollen durchaus einen beschleunigten Detektor beobachten. »Die Idee hat Jörg Schmiedmayer auf einem Workshop vor einigen Jahren vorgebracht«, sagt der Physiker Sebastian Erne von der TU Wien, der ebenfalls an der Arbeit beteiligt ist. Schmiedmayer schlug vor, einen Laserstrahl als Unruh-Detektor zu verwenden, den man auf einer Kreisbahn bewegt. Das Vakuum soll hierbei durch ein Bose-Einstein-Kondensat oder ein Suprafluid simuliert werden. Die Schwankungen in der Dichte der Atomwolke entsprechen dann den Quantenfluktuationen. »Damit hat man nicht nur eine mathematische Analogie, sondern ein tatsächlich beschleunigtes System«, erklärt Erne.
Anspruchsvoll, aber nicht unrealistisch
Den Berechnungen der Forscherinnen und Forscher zufolge sollte die Intensität des Laserstrahls durch den Unruh-Effekt fluktuieren. »Das sind sehr kleine Effekte. Glücklicherweise ist die Sensitivität der Geräte in den letzten Jahren schon erheblich verbessert worden«, so der Physiker. Die Dichteschwankungen können sich maximal mit Schallgeschwindigkeit durch das Bose-Einstein-Kondensat bewegen – diese Höchstgeschwindigkeit löst die Lichtgeschwindigkeit im eigentlichen Unruh-Effekt ab. Das bietet einen entscheidenden Vorteil: Verglichen mit der Situation im Vakuum muss der Laserstrahl nicht so schnell rotieren, um im relativistischen Regime zu landen – einige Millimeter pro Sekunde reichen bereits. »Die benötigten Beschleunigungen fallen etwa 100 Milliarden Mal kleiner aus als im Vakuum. Dass ein solcher Versuch innerhalb des Möglichen liegt, wurde in den vergangenen fünf Jahren klar«, sagt Unruh.
Das Experiment befindet sich derzeit noch in der Planungsphase – in den nächsten Jahren könnten erste Ergebnisse verfügbar sein. Aktuell widmen sich die Forscherinnen und Forscher einigen Näherungen in ihren Berechnungen. Zum Beispiel haben sie angenommen, dass der Versuch beim absoluten Temperaturnullpunkt stattfindet. Dieser lässt sich allerdings nicht erreichen, deshalb untersuchen die Fachleute, wie sich die Vorhersagen bei endlichen – wenn auch extrem niedrigen – Temperaturen verändern. Außerdem möchten die Fachleute verstehen, wie sich das Bose-Einstein-Kondensat verhält, wenn es mit dem Laserstrahl durch den Unruh-Effekt wechselwirkt. »Das sind alles spannende Fragen, die wir in den nächsten Jahren angehen«, sagt Erne. »Unser Ziel ist anspruchsvoll, aber nicht unrealistisch.« Unruh ist ebenfalls gespannt auf die ersten Ergebnisse: »Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob dieser Effekt tatsächlich existiert – selbst wenn man davon ausgeht, da er keine neuen Aspekte der Quantenfeldtheorie verwendet. Zudem werden wir erfahren, ob sich unsere Annahmen im Analogexperiment als korrekt herausstellen.«
Und auch ein zweites Experiment steht in den Startlöchern. Es basiert auf einem etwas anderen Ansatz, den Achim Kempf, Barbara Šoda und Vivishek Sudhir in ihrer 2022 veröffentlichten Arbeit vorgestellt haben. Sie nutzen ein Laserfeld, um die Quantenfluktuationen zu verstärken. Die zu Grunde liegende Idee ist keine neue, sondern hängt mit dem von Albert Einstein im Jahr 1916 entdeckten Phänomen der stimulierten Emission zusammen, das die Grundlage für Laser bildet.
Wenn sich ein Atom in einem angeregten Zustand befindet, wird es irgendwann wieder in den energetisch günstigeren Grundzustand übergehen, indem es ein Photon mit der entsprechenden Energiedifferenz aussendet. Wann dieser Prozess stattfindet, der als spontane Emission bekannt ist, lässt sich nicht sagen – es kann Millisekunden oder auch Tage dauern. Möchte man einen Laser betreiben, der zahlreiche Lichtteilchen der gleichen Wellenlänge ausstrahlt, ist eine derartige Ungewissheit hinderlich. Schließlich sollen möglichst schnell zahlreiche Photonen entstehen. Wie Einstein erkannte, lässt sich der Prozess stimulieren. Indem man ein angeregtes Atom mit Photonen der Energiedifferenz der Niveaus bestrahlt, wird dieses dazu gebracht, in den Grundzustand zurückzukehren und ein zusätzliches zum ohnehin vorhandenen Lichtteilchen auszustrahlen.
Ein beschleunigter Detektor, wie Unruh es beschrieben hat, lässt sich als Teilchen mit zwei Energiezuständen modellieren. Aus Sicht des ruhenden Beobachters schwirrt es durch den leeren Raum und kann spontan angeregt werden – und dabei gleichzeitig ein Photon aussenden. Kempf hatte mit dem Experimentalphysiker Sudhir schon länger darüber nachgedacht, wie man den Unruh-Effekt experimentell nachweisen könnte. »Vivishek hatte kürzlich seine Stelle am MIT angetreten, und sein Labor wurde gerade aufgebaut«, erzählt Kempf. »Also nutzte er die Zeit und wurde kurzzeitig zum Theoretiker, um mit mir an dem Projekt zu arbeiten.« Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein beschleunigtes Teilchen im Vakuum nur selten angeregt wird. »Man könnte auf die Idee kommen, einfach eine Milliarde Atome zu beschleunigen, um die Wahrscheinlichkeit für den Unruh-Effekt zu erhöhen«, erklärt Sudhir. »Doch man braucht eine extrem gut kontrollierbare Versuchsumgebung. Wenn man viele Teilchen hat, beeinflussen sie sich gegenseitig, und man kann die Messung nicht präzise genug durchführen.«
Eine Kraft, die 10 000-mal kleiner ist als die schwächste, die je gemessen wurde
Daher suchten die Physiker nach einer Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit für eine Unruh-Anregung bei einem einzelnen Teilchen zu verstärken. Und dafür schien die stimulierte Emission geeignet. Schließlich erhöht sie in ruhenden Systemen die Chance für das Ausstrahlen eines Photons. Zusammen mit der Doktorandin Barbara Šoda haben Kempf und Sudhir gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für den Unruh-Effekt tatsächlich zunimmt, wenn man das System mit Photonen bestrahlt. Anstatt also ein Teilchen im Vakuum zu beschleunigen, sollte man versuchen, den Unruh-Effekt in einem starken elektromagnetischen Feld zu messen. Die drei Physiker konnten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit mit der Intensität des Lasers steigt. »Photonen sind billig. Man kann Laserstrahlen mit 1016 Lichtteilchen erzeugen – dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für den Prozess um denselben Faktor.« Damit rückt ein experimenteller Nachweis in greifbare Nähe.
Doch wie die Fachleute herausfanden, verstärkt das elektromagnetische Feld nicht nur den Unruh-Prozess, sondern auch ganz normale Vorgänge: etwa die Anregung eines Atoms durch die Absorption eines Photons. »Dadurch würde man so gut wie nichts mehr vom Unruh-Effekt sehen«, sagt Kempf. »Doch dann hatte Barbara den entscheidenden Einfall.« Die Doktorandin hatte erkannt, dass die Art der Beschleunigung die verschiedenen Prozesse stark beeinflusst. Sie vermutete, dass sich die unerwünschten Übergänge durch eine geeignete Wahl der Flugbahn unterdrücken lassen – und hatte Recht. Indem man ein Teilchen beispielsweise zuerst konstant beschleunigt, dann die Beschleunigung etwas abschwächt und anschließend wieder verstärkt, erhöht sich lediglich die Wahrscheinlichkeit für den Unruh-Effekt. Die gewöhnlichen Übergänge finden den Berechnungen zufolge hingegen so gut wie gar nicht mehr statt.
»Einfach wird die Umsetzung trotzdem nicht«, sagt Sudhir, der den Versuchsaufbau in seinem Labor am MIT bereits plant. Und er weiß, wovon er spricht: Sudhir ist Experte für Hochpräzisionsmessungen, er hat die bisher genaueste Bewegungsmessung durchgeführt, unter anderem am Gravitationswellendetektor LIGO. Seine Versuchsidee besteht darin, ein Teilchen auf einer Kreisbahn stark zu beschleunigen und mit einem Laser zu bestrahlen. Allerdings werde man nicht versuchen, die Photonen zu messen, die durch den Unruh-Effekt entstehen. Denn ein anderes Signal könnte einfacher zu detektieren sein. »Das ist ein Punkt, auf den Unruh in seiner ursprünglichen Arbeit nie eingegangen ist. Wenn ein Teilchen ein Photon aussendet, dann erlebt es eine Art Rückstoß, als ob man eine Waffe abfeuert.« Und genau diese Rückstoßkraft möchte Sudhir messen. »Allerdings ist sie etwa 10 000-mal schwächer als die kleinste Kraft, die bisher jemals gemessen wurde«, erklärt er. »Das Experiment wird extrem aufwändig sein, es wird mehrere Generationen an Doktoranden erfordern, bis es fertig ist. Ich denke, in einem Zeitraum von zehn Jahren könnten wir erste Ergebnisse haben.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.