Quantengravitation: Ist die Weltformel im Klang der Raumzeit versteckt?
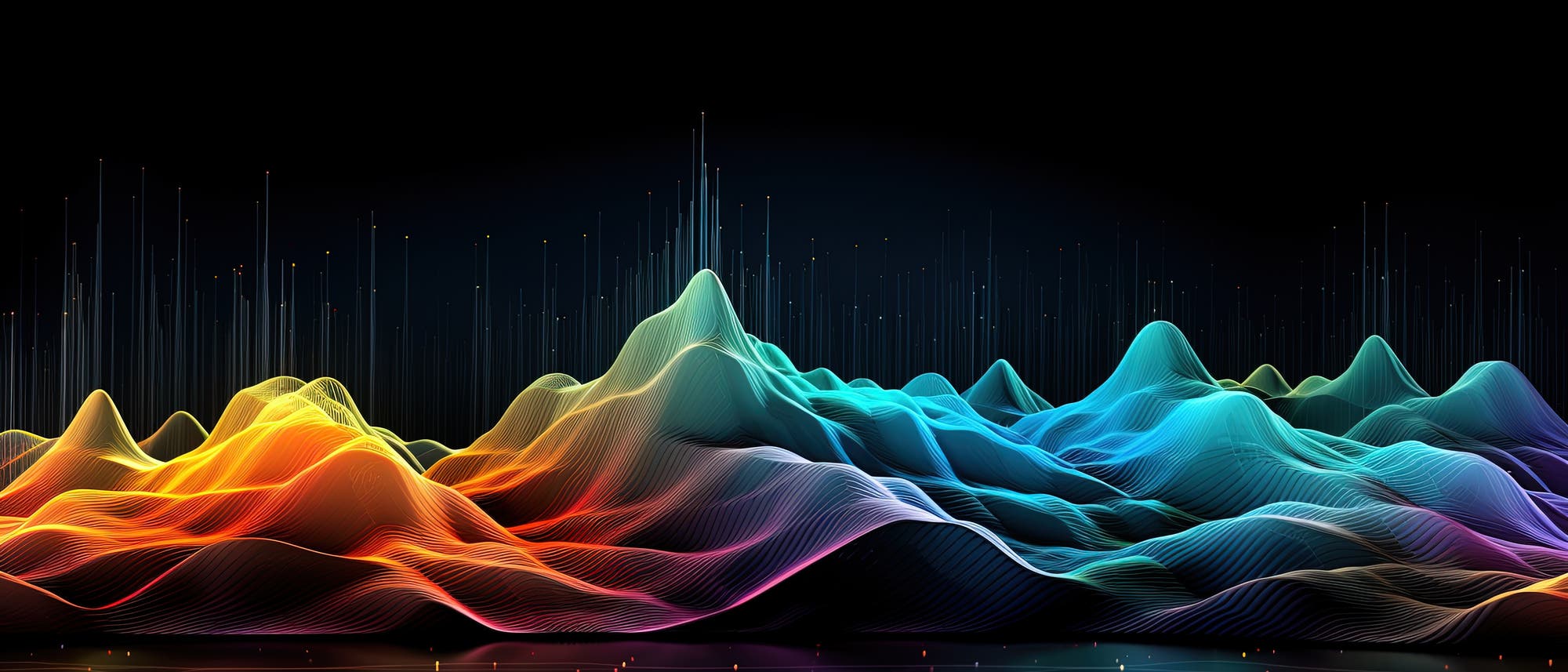
Wie hört sich das Gefüge von Raum und Zeit an? Die Antwort auf diese seltsam anmutende Frage könnte eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Physik preisgeben und verraten, wie die Schwerkraft und die Quantenphysik zusammenwirken. Seit mehr als 100 Jahren suchen Fachleute nach einer Weltformel: einer Theorie, die alle vier Grundkräfte in sich vereinigt. Doch die bisherigen Ansätze scheinen zum Scheitern verurteilt. Ideen wie die Stringtheorie liefern so unvorstellbar viele Lösungen, dass sie jede Vorhersagekraft verlieren. Andere Theorien wie die Schleifenquantengravitation sind so kompliziert, dass sich damit kaum etwas berechnen lässt.
Ein Grundproblem besteht in den völlig verschiedenen Sprachen, die Schwerkraft und Quantenphysik sprechen. Die Mathematik, auf der beide Theorien fußen, unterscheidet sich so stark, dass eine Vereinigung aussichtslos scheint. Doch vielleicht ist die Lösung zum Greifen nah: Wir müssen dem Universum nur genau genug zuhören.
So wie der Klang einer Trommel einige Hinweise auf ihre Form gibt, ist es vielleicht möglich, anhand der schwingenden Quantenfelder, die unsere Raumzeit durchziehen, die Gestalt und Dynamik des Kosmos vorherzusagen. Der mathematische Bereich, der das Bindeglied zwischen Klängen und Geometrie herstellt, könnte die lange gesuchte Sprache liefern, um endlich die Schwerkraft mit der Quantentheorie in Einklang zu bringen.
Der Physiker Achim Kempf forscht seit etwa 20 Jahren an diesem Grenzgebiet zwischen Mathematik und Physik und hat dabei erstaunliche Ergebnisse erzielt. Sein Ansatz könnte zu einer eigenständigen Quantengravitationstheorie führen, die sich von den bisherigen unterscheidet. »Das ist ein neuer, interessanter Zugang«, urteilt der Quantengravitationstheoretiker Martin Bojowald von der Penn State University in Pennsylvania.
Die Natur ist zwiegespalten
Ende des 19. Jahrhunderts wirkte die Physik wie eine ziemlich langweilige Wissenschaft. Durch die newtonschen und maxwellschen Gesetze schienen alle Naturkräfte bekannt; die einzige Schwierigkeit bestand darin, die Berechnungen (ohne Computer) möglichst exakt durchzuführen. Doch diese Auffassung sollte sich schnell ändern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es gleich zwei weit reichende physikalische Revolutionen, einerseits die Entwicklung der Quantenphysik sowie andererseits die der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie. Seither gibt es zwei Arten von Naturgesetzen: solche, die sich mit der Materie und ihren Wechselwirkungen beschäftigen (Quantentheorie), und solche, die die Struktur von Raum und Zeit umfassen (Relativitätstheorie).
Die Quantenphysik hat dazu geführt, dass mit der Zeit das anschauliche Bild von Punktteilchen und Wellen aufgegeben und durch so genannte Quantenfelder ersetzt wurde. Diese durchziehen demnach die gesamte Raumzeit. Anregungen in ihnen kann man sich als eine Art Welle auf einer Wasseroberfläche vorstellen. Sie entsprechen einem von uns wahrnehmbaren Teilchen wie einem Elektron oder einem Photon.
Das mag an den so genannten Äther erinnern. Die Vorstellung von dieser alles durchdringenden mysteriösen Substanz war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet. Doch tatsächlich gibt es einen wesentlichen Unterschied: Die Quantenfelder sind niemals völlig ruhig. Wie ein konstantes Hintergrundrauschen ziehen sich unentwegt kleine, kurzzeitige Kräuselungen hindurch. Dadurch ist das Vakuum alles andere als leer: Die Kräuselungen rufen ständig kurzlebige Teilchen und Antiteilchen hervor, die sogleich wieder verschwinden. Solche Effekte sind nicht nur seltsame theoretische Konstrukte. Ihre Folgen lassen sich messen.
Quantenfeldtheorie
Anfang des 20. Jahrhunderts entstand die Quantenmechanik – und revolutionierte die Vorstellung von Materie. Plötzlich war ein Elektron nicht mehr bloß ein punktförmiges Teilchen; vielmehr besaß es in manchen Situationen Eigenschaften, die eigentlich lediglich Wellen innehaben. In den folgenden Jahren verallgemeinerten die Fachleute die quantenphysikalischen Konzepte, indem sie den Formalismus nicht nur auf die Mechanik, sondern auch auf den Elektromagnetismus und die Kernkräfte übertrugen.
Das führt jedoch schnell zu Problemen: So kann etwa die Quantenmechanik an sich nur Systeme mit einer festen Teilchenzahl beschreiben, die sich nicht ändert. Im Fall des Elektrons und seines Antiteilchens, des Positrons, trifft das aber beispielsweise nicht zu. Sie löschen sich gegenseitig aus. Für solche Systeme braucht es daher eine allgemeinere Theorie.
Und so entwickelte sich die Quantenphysik weiter. In den 1950er- und 1960er-Jahren setzten sich sogenannte Quantenfeldtheorien immer mehr durch. In diesen ist die Raumzeit niemals leer, sondern von verschiedenen Feldern durchzogen. Schwingungen darin entsprechen Teilchen oder Antiteilchen. Doch die Quantenfelder sind niemals ruhig: Sie sind der Theorie zufolge stets von kleinen Kräuselungen durchzogen, die extrem kurzlebigen Teilchen entsprechen. Die »virtuellen« Teilchen lassen sich nicht direkt detektieren – ihre Auswirkungen allerdings konnten bereits nachgewiesen werden.
Damit haben Quantentheorien unsere Auffassung von Realität auf den Kopf gestellt. Alles fluktuiert, nichts ist wirklich scharf definiert; die Punktteilchen, die Menschen sich jahrhundertelang vorgestellt hatten, existieren nicht.
Die zweite Art von Naturgesetz, die Albert Einstein entdeckte, ist nicht weniger revolutionär. Mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie gelang es dem Physiker, die Gravitation nicht als eine gewöhnliche Kraft zu beschreiben, sondern als Folge von Geometrie.
Seit der bahnbrechenden Arbeit aus dem Jahr 1915 ist klar: Die Raumzeit, die Einstein zuvor in seiner speziellen Relativitätstheorie mathematisch aus Raum und Zeit konstruiert hatte, ist dynamisch und kann durch Materie und Energie verformt werden. Je stärker sie gekrümmt ist, desto langsamer vergeht die Zeit verglichen mit einem flachen Teil der Raumzeit. Da Energie – und damit auch Masse – das Universum verformt, verändert sie die Bahnkurven der Objekte, die sich hindurchbewegen. Die Sonne beispielsweise zwingt mit ihrer Masse die um sie herum befindlichen Planeten auf geschlossene Bahnen. Diesen geometrischen Effekt nehmen wir als Schwerkraft wahr.
Die allgemeine Relativitätstheorie umfasst also nicht nur die Raumzeit, sondern auch die darin enthaltene Materie inklusive Licht. Materie folgt aber den seltsamen Regeln der Quantentheorie. Es scheint verlockend, den Materieteil durch den Formalismus der Quantenfeldtheorie auszudrücken: So hätte man eine allumfassende Theorie geschaffen, die das ganz Große wie auch das ganz Kleine beschreibt – fertig!
So einfach ist es aber leider nicht. Denn die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenfeldtheorie passen schon allein aus mathematischer Sicht nicht zusammen. Einsteins Theorie wird in der Physik als klassisch bezeichnet, das heißt, sie arbeitet mit gewöhnlichen reellen Zahlen, so wie auch die newtonsche Mechanik oder der maxwellsche Elektromagnetismus. Die Quantentheorie ist grundlegend anders. Dort entsprechen physikalische Größen so genannten Operatoren, die teilweise durch unendlich-dimensionale Matrizen (Tabellen mit unendlich vielen Einträgen) dargestellt werden und imaginäre Zahlen (Wurzeln aus negativen Werten) enthalten. Das hat erstaunliche Folgen: Manche Größen tauchen nur gequantelt auf, also in kleinen Häppchen, während andere stets mit einer Unschärfe behaftet sind.
Die beiden Theorien unterscheiden sich demnach schon in den mathematischen Grundlagen voneinander. Seit den bahnbrechenden Erkenntnissen von John Stewart Bell aus den 1960er Jahren ist bekannt, dass sich die Quantenphysik unmöglich durch eine klassische Theorie ausdrücken lässt. Deshalb versuchen Fachleute stattdessen, eine quantentheoretische Formulierung der Schwerkraft zu finden. Anfangs gingen sie genauso vor wie bei den anderen drei Grundkräften. Doch sie landeten schnell in einer Sackgasse: Will man die allgemeine Relativitätstheorie »quantisieren«, tauchen überall Unendlichkeiten auf. Bei den übrigen Quantentheorien lassen sie sich zähmen – hier jedoch nicht.
Bellsche Ungleichungen
1935 formulierten die drei Physiker Albert Einstein, Boris Podolsky and Nathan Rosen ein Gedankenexperiment. Mit diesem argumentierten sie, die Quantenmechanik sei zwar korrekt, aber unvollständig. Demzufolge müsse es versteckte Variablen geben, die aus der Quantenphysik eine klassische, deterministische Theorie machen.
Als John Stuart Bell in den 1960er Jahren auf die Arbeit von Einstein, Podolsky und Rosen stieß, schrieb er ein paar algebraische Gleichungen nieder, die in die Geschichte eingingen: die berühmten bellschen Ungleichungen. Mit diesen lässt sich mathematisch beweisen, dass die Quantenphysik grundlegend anders ist als klassische Theorien – und dass die Natur offenbar den wirren Quantenregeln folgt.
Bell beschrieb in seiner Arbeit folgendes Experiment: Die zwei Physiker Alice und Bob befinden sich in verschiedenen Laboren. Charlie, der sich auf halber Strecke zwischen beiden befindet, sendet ihnen jeweils ein Elektron zu. Alice und Bob vermessen dann jeweils den Spin des Teilchens – eine quantenmechanische Eigenschaft, die wie ein Magnet entweder nach oben (Nordpol) oder nach unten (Südpol) ausgerichtet ist.
Charlie verschränkt die beiden Teilchen miteinander, bevor er sie an Alice und Bob sendet. Das heißt: Falls das von Alice empfangene Elektron einen nach oben ausgerichteten Spin hat, ist es bei Bob genauso. Die beiden Physiker erhalten demnach immer das gleiche Messergebnis. Allerdings könnten die Messapparaturen der beiden Experimentatoren unterschiedlich ausgerichtet sein: Alice könnte den Spin des Elektrons bezüglich der x-Achse messen, während Bob die y-Achse nutzt. Oder sie könnten eine um 45 Grad gekippte Achse wählen. Die Ausrichtung der Messapparatur beeinflusst die Ergebnisse, die Alice und Bob erzielen.
Wenn man nun davon ausgeht, dass der Quantenphysik eine klassische Theorie zugrunde liegt, dann befindet sich jedes Elektron vor der Messung in einem eindeutigen Zustand bezüglich der drei Messachsen, zum Beispiel: (oben, rechts, rechts oben) oder (oben, links, rechts oben). Insgesamt kann ein Teilchen in diesem Experiment acht verschiedene Zustände annehmen (je zwei pro Achse). Diese klassischen Zustände lassen sich in einem Venn-Diagramm verzeichnen.
Da Alice und Bob jeweils lediglich eine Messung bezüglich einer Achse durchführen können, kann man nur die Wahrscheinlichkeiten für die Ausgänge der Messungen aus je zwei Bereichen der Venn-Diagramme ermitteln (hellblau, siehe Bild unten).
Aus den Messungen gehen folgende Ergebnisse hervor: Wenn Alice und Bob sich für Messausrichtungen entscheiden, die senkrecht zueinander stehen (also die waagerechte und senkrechte Achse), dann stimmen ihre Messungen mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit überein. Falls sie aber jeweils um 45 Grad gekippte Achsen nutzen, dann stimmen die Ergebnisse in 85 Prozent der Fälle überein. Grafisch lässt sich das durch die Venn-Diagramme folgendermaßen darstellen:
Die Messergebnisse erzeugen aber einen Widerspruch zur klassischen Theorie (die durch die Venn-Diagramme veranschaulicht wird). Denn die hellblau markierten Flächen des Diagramms sollten aus klassischer Sicht die eingezeichneten Ungleichungen erfüllen. Die Messergebnisse (in Prozent eingezeichnet) passen jedoch nicht zu den Ungleichungen.
Daraus lässt sich folgern, dass die Teilchen keinen festgelegten Zustand innehaben können, bevor Alice und Bob sie messen. Die bellschen Ungleichungen veranlassten Physikerinnen und Physiker, das klassische Bild aufzugeben und eine quantenmechanische Sichtweise zu akzeptieren: Elektronen können bis zu ihrer Messung überlagerte Zustände annehmen und miteinander verschränkt sein – zwei Phänomene, die klassische Theorien nicht erfassen können.
Seit mehr als 100 Jahren suchen Fachleute nach einer Theorie der Quantengravitation. Da der direkte Weg nicht funktioniert hat, haben sie inzwischen eine Vielzahl verschiedener Ansätze entwickelt. Diese tragen Namen wie Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, kausale dynamische Triangulation oder asymptotische Freiheit. Bisher sind damit allerdings kaum Vorhersagen möglich, die sich experimentell überprüfen lassen. Das liegt entweder daran, dass die Modelle zu komplex sind oder dass sie Abermilliarden unterschiedliche Lösungen besitzen, ohne Hinweis darauf, welche davon richtig ist.
Die meisten physikalischen Phänomene erfordern keine Weltformel. Die Quantenfeldtheorie sowie die allgemeine Relativitätstheorie sind inzwischen extrem gut überprüft und beschreiben die Natur sehr genau. Es gibt aber Situationen, in denen die Theorien einzeln versagen. Das ist etwa bei der Untersuchung Schwarzer Löcher der Fall, wo Teilchen so dicht zusammengequetscht sind, dass sowohl elektromagnetische und Kernkräfte als auch die Schwerkraft zum Tragen kommen. Unter solchen Umständen müsste man wissen, wie die gekrümmte Raumzeit auf die Quantenfelder wirkt und wie umgekehrt die Quantenfelder durch ihre Energie die Raumzeit beeinflussen. Man braucht eine Theorie, die beide Arten von Naturgesetzen vereint.
Dafür muss eine neue Sprache her, ist Achim Kempf überzeugt. Während seiner Forschung ist er auf einen Bereich der Mathematik gestoßen, der der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheorie gerecht wird: die so genannte Spektralgeometrie. Mit dieser hofft er nun, beide grundverschiedene Theorien miteinander zu verbinden.
Auf der Suche nach Verständigung
Um diese gemeinsame Sprache zu entwickeln, braucht man zunächst Vokabeln. Diese entsprechen den grundlegenden physikalischen Größen, etwa Distanz, Masse oder Zeit. Doch von diesen will sich Kempf in seiner Theorie verabschieden: »Begriffe wie Länge oder Energie verlieren ihre Gültigkeit in Extremsituationen.«
Das kann man verstehen, wenn man sich ein hypothetisches, ultrahochauflösendes Mikroskop vorstellt. Zunächst zoomt man immer weiter in den Raum hinein, vorbei an Molekülen, Atomen und Nukleonen, und stößt auf Gluonen und Quarks. Man dringt zunehmend tiefer vor. Und irgendwann greift die heisenbergsche Unschärferelation: Je kleiner die Distanz, die man misst, desto schlechter lässt sich der Impuls in dem Bereich bestimmen. Dieser kann somit heftig schwanken. Laut der einsteinschen Relativitätstheorie krümmt ein Impuls die Raumzeit, so dass sie an dieser Stelle stark verformt wird. Wenn die Form der Raumzeit allerdings zu stark schwankt, lässt sich keine Distanz bestimmen. An diesem Punkt ist es nicht mehr möglich, mit den üblichen Größen wie Länge, Zeit, Masse oder Energie zu kalkulieren. Ein solcher Zusammenbruch würde sich Berechnungen zufolge erst bei der »Planck-Skala« ereignen, bei Abständen von zirka 10–35 Metern – von der wir in Experimenten noch extrem weit entfernt sind. Experimente am CERN können heute etwa 10–20 Meter auflösen.
Möchte man aber eine Theorie formulieren, die auch jenseits der Planck-Skala gilt, muss man robuste physikalische Größen finden. »Die Erwartung ist, dass Information die sicherste Währung ist«, sagt Kempf. »Denn die Informationstheorie ist universell.« Anstatt also auf Energie, Masse oder Längen zu setzen, wendet er sich Information zu – ein Gedanke, der nicht ganz neu ist. Bereits 1989 hatte der Physiker John Archibald Wheeler ebenfalls vermutet, dass sich unsere Welt in ihrer grundlegendsten Form aus Informationen zusammensetzt. Für das Konzept prägte Wheeler die Bezeichnung »It from Bit«.
Aus Sicht der Quantenfeldtheorie erscheint die Idee durchaus sinnvoll, denn die Quantenphysik ist in ihrer modernen Form informationstheoretisch formuliert. Die mathematischen Bausteine der Informationstheorie sind so genannte Korrelationsfunktionen, die bestimmen, wie wahrscheinlich zwei Ereignisse miteinander zusammenhängen. In der Quantenfeldtheorie lassen sich alle relevanten physikalischen Größen, wie Vorhersagen über Längen oder Energien, durch solche Korrelationsfunktionen ausdrücken.
Bei der Schwerkraft ist das anders. Als geometrische Beschreibung der Raumzeit ist sie gewöhnlich durch Distanzen und Zeitabstände bestimmt. Kempf suchte daher nach einer Möglichkeit, die geometrische Theorie durch informationstheoretische Größen auszudrücken. Und wie sich herausstellt, kann die Quantenfeldtheorie hierbei behilflich sein.
Eine neue Art von Messinstrument
Um die Form eines Objekts möglichst präzise zu untersuchen, braucht man Messinstrumente – so etwas wie winzige Maßbänder –, mit denen man Abstände zwischen verschiedenen Punkten auf der Oberfläche des Objekts ermittelt. Anschaulich kann man sich das folgendermaßen vorstellen: Angenommen, man besprenkelt eine Vase mit etlichen kleinen Farbklecksen. Dann notiert man die Distanzen zwischen je zwei benachbarten Punktepaaren in einer Tabelle. Nun übergibt man die gesammelten Daten an eine Person, welche die Vase noch nie zuvor gesehen hat. Anhand der Informationen kann sie trotzdem die Form des Gefäßes rekonstruieren – zumindest bis zu einer gewissen Auflösung, die durch die Dichte der Farbkleckse bestimmt ist.
Wenn man sich aber für die Geometrie bis hinunter zu Längen der Planck-Skala interessiert, dann muss man einen Ersatz für Farbkleckse und Maßbänder finden. Dabei kann man auf Korrelationsfunktionen zurückgreifen. Unserem bisherigen Wissensstand nach ist die Raumzeit von Quantenfeldern durchzogen, die ständigen Schwankungen ausgesetzt sind. Wie wahrscheinlich eine Kräuselung an Ort A mit einer anderen an Ort B zusammenhängt, wird durch die Korrelationsfunktionen beschrieben. Entscheidend ist hierbei, dass die Wahrscheinlichkeit mit wachsendem Abstand zwischen A und B abnimmt. Wie Kempf erkannte, lässt sich diese Korrelation als Maß für die Distanz verwenden. Das Gute: Korrelationsfunktionen besitzen von Natur aus eine informationstheoretische Bedeutung, das heißt, sie funktionieren auch in Extremsituationen, etwa wenn die Raumzeit stark fluktuiert.
Damit können die Schwingungen der Quantenfelder, ausgedrückt durch Korrelationsfunktionen, die Krümmung der Raumzeit beschreiben. Man kann sich das wie den Klang eines Objekts vorstellen, das man anstößt: Die Schallwellen breiten sich auf der Oberfläche aus und geben Informationen über deren Form preis. »Die Krümmung ist im Rauschen der Raumzeit codiert«, sagte Kempf in einem Vortrag an der University of Waterloo im Jahr 2015. Damit hätte man eine quantenfeldtheoretische Beschreibung der Geometrie der Raumzeit und somit eine gemeinsame Sprache zwischen allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenfeldtheorie geschaffen – ein guter Ausgangspunkt für eine Weltformel.
Welche Struktur hat der Raum?
Wenn man ein Objekt mit Punkten besprenkelt und die Distanzen dazwischen bestimmt, kann man die Form nur bis zu einer gewissen Auflösung rekonstruieren. Dabei bleibt die Frage über die genaue Struktur der Raumzeit unbeantwortet; insbesondere ist unklar, ob die Raumzeit kontinuierlich ist – oder ob sie, wie viele andere quantenphysikalische Größen, diskret ist. In so einem gequantelten Fall würde der Raum aus körnigen Punkten bestehen. Sie lägen bloß so dicht beieinander, dass wir ihn als Kontinuum wahrnehmen. Eine Analogie ist eine ebene Tischplatte, die sich in Wirklichkeit aus einzelnen Atomen zusammensetzt. Ebenso könnte es sein, dass die Zeit nicht fließend verläuft, sondern wie eine Uhr tickt.
Wie Kempf erklärt, könnte die Raumzeit kontinuierlich und diskret zugleich sein. Das mag zwar wie ein Widerspruch klingen, aber es gibt eine Größe, die diese Eigenschaft hat: Information. »Man kann sowohl ein ganzes Gesangsstück ohne Unterbrechungen als auch einzelne Zeichenfolgen übertragen – in beiden Fällen übermittelt man Information«, erklärt Kempf. »Indem man die allgemeine Relativitätstheorie informationstheoretisch ausdrückt und unter der Annahme, dass die Natur eine Bandbreite besitzt, die der Planck-Energie entspricht, könnte die Raumzeit ebenfalls gleichermaßen diskret wie kontinuierlich sein.«
Das Abtasttheorem
Auch wenn Claude Shannon, der Begründer der Informationstheorie, für das Abtasttheorem bekannt ist, hat es der sowjetische Mathematiker Wladimir Alexandrowitsch Kotelnikow bereits 1933 – 25 Jahre früher als Shannon – erstmals bewiesen. Es besagt, dass man ein auf fmax bandbeschränktes Signal exakt rekonstruieren kann, wenn man es mit einer Frequenz von mindestens 2·fmax abtastet. Das heißt: Wenn man die Töne eines Lieds mit einer Bandbreite von 20 Kilohertz mit 40 000 Signalen pro Sekunde aufnimmt, lässt sich das Musikstück lückenlos rekonstruieren. Das nutzen Tonstudios, aber auch Telefone und andere elektronischen Geräte, um Informationen möglichst effizient zu übertragen.
Anschaulich kann man das folgendermaßen erklären: Jedes Signal lässt sich durch eine Summe aus Sinus- und Kosinusfunktionen unterschiedlicher Frequenz zerlegen. Indem man verschiedene Datenpunkte erhebt, kann man die möglichen trigonometrischen Funktionen bestimmen, die zu den Messwerten passen. Je höher die Frequenz dieser Funktionen, desto mehr von ihnen kommen in Frage. Wenn es jedoch eine beschränkte Bandbreite gibt, also ein fmax, dann finden sich nur endlich viele passende Sinus- oder Kosinusfunktionen. Wenn man genügend Messwerte sammelt, ist es sogar möglich, ein bandbeschränktes Signal exakt zu rekonstruieren.
Das so genannte Abtasttheorem zeigt, wie sich ein kontinuierliches Signal mit begrenzter Bandbreite exakt rekonstruieren lässt, wenn man es mit einer bestimmten Frequenz abtastet. Das wird zum Beispiel in Tonstudios genutzt: Die Musik wird dabei meist auf eine Bandbreite von 20 Kilohertz gefiltert und dann mit einer Abtastrate von etwa 40 Kilohertz aufgenommen, was 40 000 Signalpunkten pro Sekunde entspricht. Das genügt, um das gefilterte Musikstück lückenlos zu rekonstruieren. Sofern es also eine beschränkte Bandbreite gibt, spielt es aus mathematischer Sicht keine Rolle, ob ein Signal kontinuierlich oder diskret ist – beides ist äquivalent.
Kempf hat diese Tatsache auf Quantenfelder angewendet. Wenn man annimmt, dass sie beschränkt sind, dann macht es keinen Unterschied, ob sie auf einer diskreten oder einer kontinuierlichen Raumzeit existieren. Beide Sichtweisen sind in diesem Fall identisch.
Eine Bandbeschränkung in den Quantenfeldern würde bedeuten, dass die Energie und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen begrenzt sind. Tatsächlich arbeiten Quantenfeldtheoretiker oft mit solchen »Cutoffs«, bei denen sie die Quantenfelder abschneiden. So entgehen sie den Unendlichkeiten, die in den Berechnungen zwangsläufig auftauchen. Normalerweise handelt es sich dabei um einen mathematischen Trick, den man am Ende rückgängig macht, indem man am Schluss einer Berechnung diesen Cutoffs wieder aufhebt. Ob das wirklich notwendig ist, weiß aber niemand; vielleicht ist die Natur von Grund auf bandbeschränkt. Wenn man den Cutoff hingegen beibehält, ergeben sich durchaus interessante Konsequenzen, wie Kempf feststellte.
»Bisher war in der Community kaum bekannt, dass ein solcher Cutoff eine Bandbeschränkung darstellt und somit das Abtasttheorem greift«, sagt Kempf. Das Abtasttheorem lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres auf die Physik übertragen: Da die Quantenfelder auf einer gekrümmten Raumzeit leben, muss man es schaffen, die Informationstheorie auf komplizierte Geometrien zu verallgemeinern. Die Ergebnisse müssen am Ende allgemein gültig sein und dürfen nicht davon abhängen, welches Koordinatensystem man verwendet. Das ist Kempf gelungen, wie er in einer 2004 im Fachjournal »Physical Review Letters« veröffentlichten Arbeit beschreibt.
Spuren in unserem Kosmos
Falls ein natürlicher Cutoff also existiert, »können physikalische Felder und ihre Bewegungsgleichungen dann als auf einem hinreichend dichten Raumzeitgitter lebend betrachtet werden oder äquivalent in einer kontinuierlichen Raumzeit«, schreibt Kempf. 2017 zeigte er zusammen mit seinen Kollegen Aidan Chatwin-Davies und Robert T. W. Martin, dass Quantenfelder mit beschränkter Bandbreite gewisse Spuren in der Kosmologie hinterlassen, die sich nachweisen lassen könnten.
»Das sind die schwierigsten Berechnungen, die ich jemals gemacht habe«, erinnert sich Kempf. Er versucht im Detail nachzuvollziehen, welche Auswirkungen ein Cutoff auf die kosmische Hintergrundstrahlung und auf die Verteilungen der Galaxien haben würde. Das hängt aber davon ab, bei welcher Skala man den Schnitt ansetzt: Werden Quantenfelder erst bei 10–35 Metern oder schon bei 10–29 Metern beschränkt? »Wenn der Cutoff bei 10–35 Metern liegt, dann wird es sehr schwer, seinen Einfluss auf kosmologische Beobachtungen zu messen«, erläutert Kempf. »Aber bei 10–29 Metern sind die Auswirkungen möglicherweise schon groß genug.« Eine Arbeit über die quantitativen Folgen eines Cutoffs in Quantenfeldern von Kempf, Chatwin-Davies und dem Mathematiker Petar Simidzija ist 2023 erschienen.
Falls Kempf Recht hat und Quantenfelder wirklich eine begrenzte Bandbreite besitzen, dann wird sich niemals unterscheiden lassen, ob die Raumzeit kontinuierlich oder diskret ist. Die Natur hätte ein eingeschränktes Auflösungsvermögen, über das man unmöglich hinausgehen kann. In diesem Fall wären aber auch verschiedene Formen der Raumzeit ununterscheidbar. »Ob eine Raumzeit winzige Falten hat, die kleiner sind als der Cutoff, ist egal: Sie werden von der Materie nicht gesehen«, erklärt Kempf. Demnach wären also zwei Raumzeiten aus physikalischer Sicht identisch, selbst wenn sie sich aus mathematischer Perspektive in den kleinsten Längenskalen unterscheiden.
Korrelationen allein sind nicht die Lösung
Wie sich schnell herausstellte, führen die Korrelationsfunktionen zu Problemen, wenn man mit ihnen die Geometrie der Raumzeit bestimmen möchte. Idealerweise gäbe es nur eine einzige Beschreibung. In Wirklichkeit gibt es aber unendlich viele Koordinatensysteme – und in jedem davon sehen die Korrelationsfunktionen verschieden aus. Möchte man mit ihnen Berechnungen durchführen, stößt man daher unweigerlich auf Unendlichkeiten.
Das Problem lässt sich umgehen, indem man nicht die Korrelationsfunktionen selbst, sondern ihr so genanntes Spektrum betrachtet. Dabei handelt es sich um charakteristische Werte, die den Eigenfrequenzen eines Objekts entsprechen: den Obertönen, die man hört, wenn man mit einem Stab eine Figur anstößt. Das Spektrum hat den Vorteil, dass es im Gegensatz zu Korrelationsfunktionen unabhängig von jeder Wahl des Bezugssystems oder der Koordinaten immer gleich ist.
Doch Kempf musste herausfinden, ob das Spektrum der Korrelationsfunktionen wirklich genügt, um daraus eindeutig auf die Geometrie der Raumzeit zu schließen. »Statt sich dem geometrischen Bild zu widmen, fokussiert er sich auf die algebraische Seite«, sagt die Quantengravitationstheoretikerin Renate Loll. »Das ist eine nette Idee, die an sich nicht ganz neu ist.« Andere Herangehensweisen der Quantengravitation, die sich mit so genannter nichtkommutativer Geometrie beschäftigen, fußen auf ähnlichen Überlegungen. Dem pflichtet Martin Bojowald teilweise bei: »Die Mathematik hinter dem Ansatz ist zwar ähnlich, die zu Grunde liegende Physik aber nicht.«
Kann man die Form einer Trommel hören?
Diese Aufgabe hängt mit einem mathematischen Problem zusammen, das bereits Ende des 19. Jahrhunderts auftauchte: Kann man aus den Klängen eines Objekts auf seine Form schließen?
Stellen Sie sich vor, Sie schlagen mit einem Stab gegen eine große Vase. Und nun nehmen Sie ein kleineres Gefäß mit einer schmaleren Form und wiederholen das Experiment. Der Ton, der jetzt entsteht, wird sich deutlich vom ersten unterscheiden. Deshalb fragten sich Fachleute, ob der Klang ausreicht, um daraus auf die Geometrie eines Objekts zu schließen. Mit Klang bezeichnen die Mathematiker das Spektrum der Schwingungen im Objekt. Diese harmlos anmutende Aufgabe erwies sich als schweres Problem. Es dauerte Jahrzehnte, bis eine Antwort gefunden wurde – und noch heute sind viele Fragen offen.
1992 fanden drei Mathematiker Beispiele für unterschiedliche zweidimensionale Formen, die genau den gleichen Klang erzeugen. Demnach ist es nicht immer möglich, anhand des Spektrums eindeutig auf die zu Grunde liegende Geometrie zu schließen. Umgekehrt gilt das allerdings nicht: Kennt man die Form eines Gegenstands, lässt sich – wenn auch mit teilweise großem Aufwand – stets dessen Spektrum berechnen und damit dessen Klang vorhersagen.
Doch wie sich zeigt, gibt es durchaus Fälle, bei denen das Spektrum genügt, um die Form eindeutig vorzugeben, etwa bei sehr symmetrischen Objekten. »Es ist noch nicht sicher, ob die Gegenbeispiele (bei denen sich die Form nicht aus dem Klang ergibt) die Regel oder die Ausnahme sind. Bis jetzt deutet alles auf Letzteres hin«, schrieben Forschende um den Mathematiker Michael Bronstein vom Imperial College London in einer 2018 erschienenen Veröffentlichung.
»Wir geben hier noch nicht auf, wir sind schließlich Physiker und keine Mathematiker«Achim Kempf, Physiker
Und auch Kempf ließ sich bei seinem Vorhaben nicht von dem 1992 veröffentlichten Ergebnis entmutigen. »Wir geben hier noch nicht auf, wir sind schließlich Physiker und keine Mathematiker«, sagte er in einem Vortrag an der University of Waterloo im Jahr 2015. »Mathematiker beweisen etwas oder beweisen es nicht. Als Physiker haben wir aber die Störungstheorie.«
Die Störungstheorie ist eines der liebsten Werkzeuge des Fachs. Anstatt sich hier einem schweren Problem direkt zuzuwenden, nähert man sich ihm in kleinen Schritten. Zunächst widmet man sich dem einfachsten – noch lösbaren – Teil einer Aufgabe und lässt dann nach und nach kleine Abweichungen einfließen. So kann man beobachten, wie sich die Lösung langsam verändert. Dieser Ansatz funktioniert allerdings nur, wenn die Störungen nicht zu stark sind.
2013 wendete Kempf die Störungstheorie auf die Spektralgeometrie an. Er begann mit einem Klang, der eine geometrische Form eindeutig vorgibt. Dann modifizierte er das Spektrum leicht, wodurch er auf die veränderte Form schließen konnte. »Diesen Prozess kann man iterieren, um schließlich wie gewünscht von Klang auf Form zu schließen«, sagt Kempf. Indem er die Störungstheorie also immer wieder benutzte, konnte er sich Spektren zuwenden, die völlig andere Geometrien hervorbrachten. »Wir konnten dabei genau festmachen, wann ein Klang eine Form überhaupt eindeutig bestimmt.« Damit erweiterte er das Grundverständnis des jahrhundertealten mathematischen Problems.
Allerdings funktioniert der Ansatz nur für zweidimensionale Oberflächen – also etwa für eine Vase. Grund dafür ist die Art der Schwingungen, die in einem Objekt auftreten können, wenn man es anstößt. Auf 2-D-Flächen gibt es nur skalare Wellen, die parallel zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Sobald man aber mehr Dimensionen hinzuzieht, wird die Situation kniffliger. Wie bei Erdbeben können nun auch noch longitudinale, beispielsweise Scherungswellen entstehen – und diese sind entscheidend, um Aufschluss über die Geometrie der betreffenden Figur zu geben. Unsere Raumzeit besitzt vier Dimensionen; die Quantenfelder erzeugen folglich vierdimensionale Schwingungen. Diese zu beschreiben, ist mit der Methode extrem kompliziert.
Doch Kempf erkannte, dass sich das Problem anders lösen lässt: wenn man die Wechselwirkung der Wellen untereinander in Betracht zieht. Das erreicht man, indem man einen Gegenstand so stark anstößt, dass die Schwingungen miteinander interferieren. Schlägt man zum Beispiel eine Trommel fest genug an, wird sie nicht nur lauter, sondern ändert zudem ihren Klang – und zwar in einer Weise, die von der Form der Trommel abhängt.
So konnte Kempf 2021 das spektralgeometrische Problem verallgemeinern. Anstatt die Ausbreitung von gewöhnlichen skalaren Wellen auf einer Oberfläche zu untersuchen, betrachtete er eine vermeintlich kompliziertere Situation: Er ließ zu, dass die Wellen (in diesem Fall durch das Quantenfeld vorgegeben) miteinander wechselwirkten. Im physikalischen Bild können dadurch auch Teilchen aneinander streuen oder abgelenkt werden. Diese Vorgänge liefern genügend Informationen, um eindeutig auf die Geometrie der Fläche zu schließen, auf der sich die Prozesse abspielen.
Von der Beschreibung zu konkreten Berechnungen
Mit dieser Vorarbeit hatte Kempf es geschafft, eine informationstheoretische Beschreibung der Raumzeit zu formulieren. Damit eine Quantengravitationstheorie aber konkrete Ergebnisse liefert, muss man ein so genanntes Pfadintegral berechnen. Dabei handelt es sich um einen komplexen mathematischen Ausdruck, von dem man sämtliche wichtigen Informationen ableiten kann: die Temperatur, die Krümmung der Raumzeit, die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen und so weiter.
Ein essenzieller Punkt von Quantentheorien ist, dass alle möglichen Ereignisse innerhalb eines Systems eine Rolle spielen – unabhängig davon, ob sie tatsächlich eintreten oder nicht. Wenn sich zum Beispiel ein quantenmechanisches Teilchen von A nach B bewegt, muss man jeden Weg, den es einschlagen könnte, in den Berechnungen berücksichtigen. Das tut man in der Regel mit einem Pfadintegral.
Möchte man die Schwerkraft durch eine Quantentheorie ausdrücken, taucht ein solches Pfadintegral ebenfalls auf. Alle möglichen Formen, welche die Raumzeit annehmen kann, kommen dabei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gewichtet vor. All diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ist allerdings in der Praxis so gut wie unmöglich.
Falls Quantenfelder jedoch, wie Kempf es annimmt, bandbeschränkt sind, besteht eine Chance darauf, die Berechnungen durchzuführen. Mitte der 1970er Jahre entwickelten der Physiker Stephen Hawking und der Mathematiker Peter Gilkey unabhängig voneinander eine Methode, durch die sich das Pfadintegral mit Hilfe eines mathematischen Tricks drastisch vereinfachen lässt: Anstatt über unendlich viele Raumzeitgeometrien zu integrieren, kann man das Spektrum der Raumzeit heranziehen.
Zählt man die unterschiedlichen Eigenfrequenzen der Raumzeit, das heißt die Dimension des Spektrums, erhält man laut Gilkey und Hawking das gleiche Resultat, wie wenn man das Pfadintegral über alle möglichen Geometrien bildet.
Gilkey hatte sich in seiner Arbeit auf rein mathematische Situationen beschränkt, ohne auf Gravitation oder eine Raumzeit einzugehen. Und auch Hawking beschrieb in seiner Veröffentlichung die Raumzeit nicht direkt, sondern den vereinfachten Fall einer »euklidischen Geometrie«: Hier wirkt die Zeit wie eine weitere Raumdimension. Das macht die Berechnungen zwar einfacher, aber dadurch verliert die Zeit ihre kausale Rolle, also dass die Wirkung immer auf eine Ursache folgt.
Kempf verwendete in seiner Arbeit ebenfalls die euklidische Geometrie. »Das ist ein interessanter Ansatz, in der Praxis jedoch schwierig«, sagt Loll. Kempf arbeitet aktuell daran, seine Berechnungen für realistische Raumzeitgeometrien inklusive Kausalität zu verallgemeinern.
2023 hat Kempf gemeinsam mit der Physikerin Barbara Šoda und ihrem Kollegen Marcus Reitz seine vorläufige Theorie getestet. Dabei waren die Vorhersagen noch auf zeitunabhängige Größen beschränkt. In dieser Arbeit sind Schwerkraft und Quantenfelder vereint, allerdings können die Felder selbst nicht miteinander wechselwirken. Die Beschreibung enthält also nur Teilchen, die sich ungehindert von A nach B bewegen. Die Quantenfelder und die Raumzeit sind aber miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.
Šoda, Reitz und Kempf untersuchten dabei zwei unterschiedliche Teilchenklassen: so genannte Bosonen und Fermionen. Erstere beschreiben Kräfte vermittelnde Teilchen wie Photonen oder Gluonen. Diese haben die Besonderheit, dass sie sich gerne zusammenfinden. Fermionen, zu denen alle materieartigen Teilchen wie Elektronen oder Quarks zählen, sind hier völlig anders: Sie gehen sich aus dem Weg. Das Team um Kempf konnte zeigen, dass diese abstoßenden und anziehenden Eigenschaften in Extremsituationen (etwa kurz nach dem Urknall) sich außerdem auf die Raumzeit selbst stark auswirken können.
Die drei Fachleute bestimmten nicht nur die Form des betrachteten Kosmos, sondern auch seine Größe und seine Dimensionalität. Je nachdem, wie viele Sorten von Fermionen es im Vergleich zu Bosonen gibt, kann das Universum demnach zunächst zwei- oder dreidimensional sein und sich erst später zu der uns bekannten vierdimensionalen Raumzeit entwickeln. Je mehr Fermionen, desto mehr Dimensionen, fanden sie heraus.
»Aus dem nichtgeometrischen Regime entsteht eine konsistente Raumzeit. Das ist anders als bei vielen anderen Ansätzen wie der Schleifenquantengravitation«Martin Bojowald, Physiker
»Wenn die Temperatur steigt, kann sich das Gleichgewicht der Fermionen und Bosonen ändern, was zu einer Veränderung der Dimensionen der Raumzeit führt«, äußerte sich Šoda in einer Veröffentlichung des kanadischen Perimeter Institute, bei dem sie arbeitet. Auf diese Weise kann man die Zeit gewissermaßen zurück bis zum Urknall drehen: »Wenn die Temperaturen extrem genug sind, könnte dieses Gleichgewicht gestört werden, was zum Zerfall der Raumzeit führen würde.« In einem solchen Regime gäbe es den Berechnungen zufolge nur noch die winzigen Informationseinheiten, die Korrelationen – alle anderen uns vertrauten Größen verlieren ihre Bedeutung.
»Das Gute ist, dass aus diesem nichtgeometrischen Regime eine konsistente Raumzeit entsteht«, sagt Martin Bojowald. »Das ist anders als bei vielen anderen Ansätzen wie etwa der Schleifenquantengravitation.« Zudem benötige Kempf keine zusätzlichen Annahmen, beispielsweise Supersymmetrien oder versteckte Raumdimensionen, wie sie in der Stringtheorie auftauchen. »Zumindest noch nicht«, ergänzt Bojowald. »Bisher steckt die Theorie noch in den Kinderschuhen, vielleicht merkt man in ein paar Jahren, dass zusätzliche Annahmen doch nötig sind.«
Kempf hofft, seine Berechnungen auf wechselwirkende Felder erweitern zu können. Zudem muss es gelingen, von der euklidischen Raumzeit zu einer kausalen Raumzeit überzugehen, um daraus irgendwann eine eigenständige Quantengravitationstheorie abzuleiten. Ob die Natur wirklich die Bandbeschränkung hat, auf der seine Theorie aufbaut, könnte schon in den nächsten Jahren getestet werden.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.