Realität: Warum selbst Physiker die Quantenmechanik nicht verstehen
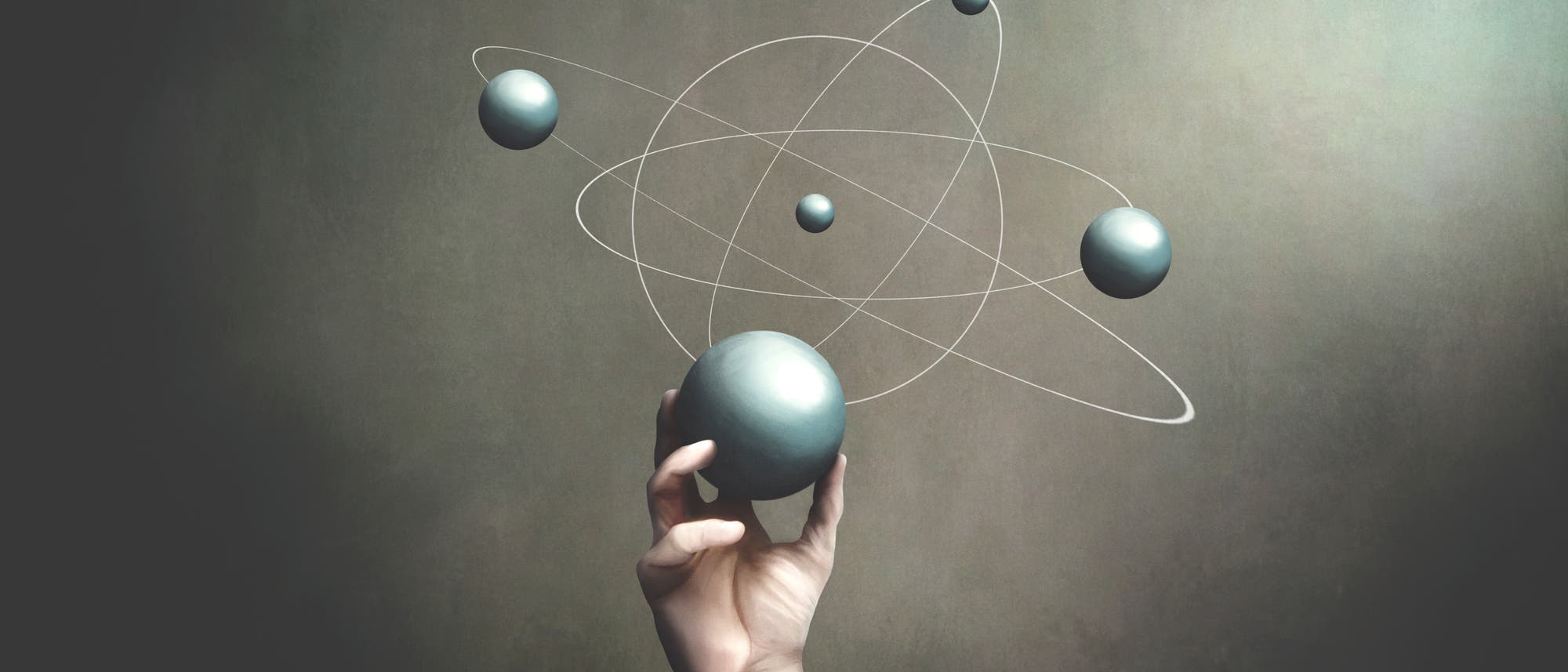
Manche Strategien scheinen Probleme auf wundersame Weise zu lösen, auch wenn man nicht wirklich versteht, warum. Früher war es vielleicht das Klopfen auf die Oberseite des Röhrenfernsehers, wenn das Bild unscharf wurde; heute könnte es der Neustart eines Computers sein.
Mit der Quantenmechanik ist es ähnlich. Sie funktioniert hervorragend und erklärt alles Mögliche: von Lasern und Chemie bis hin zum Higgs-Boson und dem Aufbau von Materie. Doch es ist immer noch unklar, weshalb sie so gut funktioniert. Und wenn eine Person eine Vermutung dazu äußert, erntet sie von anderen meist Widerspruch.
Eine Schwierigkeit: Wie man physikalische Systeme quantentheoretisch beschreibt, unterscheidet sich erheblich von dem, was man beobachtet. Deshalb gelten in der Quantenmechanik die Konzepte von »Messung« oder »Beobachtung« als gesonderte Prozesse – im Gegensatz zu jeder anderen physikalischen Theorie. Bis heute gibt es keine Einigkeit darüber, wieso das nötig ist und was das bedeutet.
Themenwoche »Quantenphysik neu gedacht«
Die Quantenmechanik war von Anfang an heftig umstritten. Auch 100 Jahre später ist sich die Fachwelt nicht einig: Was verraten die Formeln über die Realität? In dieser Themenwoche hinterfragen wir, was nötig ist, um die wahre Natur der Teilchen zu begreifen. Womöglich braucht es eine völlig andere Herangehensweise.
100 Jahre Quantenmechanik: Dichtung und Wahrheit hinter Heisenbergs Quantenrevolution
Realität: Warum selbst Physiker die Quantenmechanik nicht verstehen
Quanten-Holonomie-Theorie: Eine neue Verbindung von Raum, Zeit und Quantenphysik
Unwissenschaftliche Heilsversprechen: Schluss mit dem Quanten-Hokuspokus!
Nobelpreisträger 't Hooft: »Der Grund, warum es nichts Neues gibt, ist, dass alle gleich denken«
Springers Einwürfe: Die Zukunft der Quanten
Mehr zu den seltsamen Phänomenen aus der Welt der Teilchen und Atome finden Sie auf unserer Themenseite »Quantenphysik«.
Erste Hinweise für das seltsame Verhalten der Natur auf kleinster Skala sammelten die Physiker Max Planck im Jahr 1900 und Albert Einstein fünf Jahre später. Sie erkannten, dass sich bestimmte Eigenschaften des Lichts am besten erklären lassen, wenn dieses aus teilchenähnlichen Päckchen besteht – und nicht aus Wellen, wie sie der klassische Elektromagnetismus beschreibt. Die Ideen der beiden Forscher reichten jedoch nicht aus, um daraus eine eigenständige Theorie aufzubauen. Erst Werner Heisenberg legte 1925 ein umfassendes mathematisches Konzept für die Quantenmechanik vor, das er kurz darauf gemeinsam mit Max Born und Pascual Jordan ausbauen konnte. Erwin Schrödinger lieferte bald darauf unabhängig von ihnen eine eigene Formulierung der Quantentheorie.
Deshalb wird 2025 das Jubiläum 100 Jahre Quantenmechanik gefeiert. Und auch wenn in der Zwischenzeit eine Vielzahl von atemberaubenden experimentellen Erfolgen gelang, sollten die Feierlichkeiten außerdem zum Anlass dienen, auf die bis heute ungeklärten Fragen der Theorie hinzuweisen. Die Quantenmechanik ist ein wunderbares Konstrukt, und es wäre schön, wenn wir sicher sein könnten, dass es nicht auf Sand gebaut wurde.
Die Quantenmechanik ist ein wunderbares Konstrukt, und es wäre schön, wenn wir sicher sein könnten, dass es nicht auf Sand gebaut wurde
Abkehr vom Erfolgsrezept der Vergangenheit
Seit Isaac Newton im 17. Jahrhundert die klassische Mechanik formuliert hat, folgen physikalische Theorien stets einem bestimmten Muster. Alle Systeme – ob ein Planet, der um einen Stern kreist, ein elektrisches Feld oder Wasser in einem Fluss – werden jederzeit durch einen »Zustand« beschrieben. Er umfasst die aktuelle Konfiguration und die Änderungsrate der Bestandteile des Systems. Für ein einzelnes Teilchen ist der Zustand beispielsweise durch die Position und Geschwindigkeit (beziehungsweise Impuls) gegeben. Zusätzlich gibt es Bewegungsgleichungen, mit denen sich bestimmen lässt, wie sich die Systeme mit der Zeit verändern.
Egal ob Newtons Gravitation oder Einsteins Relativitätstheorien: Physikalische Theorien folgen immer diesem Grundrezept aus Zustandsbestimmung und Bewegungsgleichung – bis auf die Quantenmechanik.
Grund dafür ist das Prinzip der Messung. Seit Anbeginn der Wissenschaften nutzen Gelehrte Experimente, um die Welt um sich herum zu verstehen und ihre Hypothesen zu testen. Vor dem Aufkommen von Quantentheorien war man davon überzeugt, dass alle physikalischen Größen jederzeit gewisse Werte annehmen, die sich messen lassen. Dabei kann es natürlich zu Fehlern kommen, verursacht durch unvollkommene Versuchsbedingungen. Aber je mehr Mühe man sich gibt, so zumindest die Vorstellung, desto präziser das Ergebnis.
Die Quantenmechanik zeichnet hingegen ein ganz anderes Bild. Während in der klassischen Physik ein Teilchen jederzeit eine eindeutige Position und Geschwindigkeit innehat, lassen sich diese Größen in der Quantenmechanik vor einer Messung nicht objektiv bestimmen. Ort und Impuls sind hier Größen, die man zwar auch weiterhin prinzipiell beobachten kann, doch sie haben bis zur Messung keinen definierten Wert. Damit unterscheidet sich die Quantenmechanik drastisch von allen anderen physikalischen Theorien.
Aus dieser erstaunlichen Tatsache lässt sich unter anderem die heisenbergsche Unschärferelation ableiten, die besagt, dass sich Ort und Impuls eines Teilchens niemals exakt vorhersagen lassen. Stattdessen beschreibt die Quantentheorie den Zustand eines Systems durch eine Wellenfunktion – ein Konzept, das Schrödinger 1926 einführte, zusammen mit einer nach ihm benannten Gleichung. Diese macht berechenbar, wie sich ein Quantensystem mit der Zeit verändert. Für ein einzelnes Elektron hat die Wellenfunktion an jeder Stelle im Raum einen Zahlenwert. Damit ähnelt der Zustand des Teilchens einer Welle, die rund um einen Atomkern eng begrenzt sein kann – oder sich räumlich weit erstreckt.
Knifflig wird es, beobachtbare Größen wie Ort und Impuls mit der abstrakten Wellenfunktion in Einklang zu bringen. Einen Weg fand Max Born kurz nach Schrödingers Veröffentlichung. Wie er erkannte, lässt sich das Ergebnis einer Quantenmessung niemals genau vorhersagen. Stattdessen kann man nur die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass ein bestimmtes Messergebnis eintritt – und hierbei kommt die Wellenfunktion ins Spiel. Möchte man etwa ermitteln, wie die Chancen stehen, ein Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden, muss man das Quadrat der Wellenfunktion dieser Position auswerten. Das stellte die bisherige Vorstellung eines deterministischen Universums auf den Kopf.
Ein neues Weltbild
Rückblickend ist es beeindruckend, wie schnell einige Fachleute diesen Wandel akzeptierten. Aber das taten nicht alle. Einstein und Schrödinger sind berühmte Beispiele für Personen, die sich nicht mit dem neuen Quantenkonsens zufriedengaben. Nicht, weil sie seine Hintergründe nicht verstanden, sondern weil sie überzeugt waren, dass die neuen Regeln nur ein Zwischenschritt hin zu einer noch umfassenderen Theorie seien.
Der Indeterminismus wird oft als ihr Haupteinwand gegen die Quantentheorie dargestellt, wie das einprägsame Zitat von Einstein belegt: »Gott würfelt nicht.« Dabei gingen Einsteins Bedenken viel tiefer. Er sorgte sich vor allem um die Lokalität – die grundlegende Vorstellung, dass Objekte nur an bestimmten Orten in der Raumzeit existieren und lediglich mit Dingen in ihrer Nähe wechselwirken können. Zudem ging es Einstein um Realismus, also darum, dass die Physik reale Vorgänge der Welt abbildet und nicht nur mathematische Behilflichkeit ist.
Einsteins schärfste Kritik findet sich im 1935 veröffentlichten EPR-Paper, das nach ihm und seinen Koautoren Boris Podolsky und Nathan Rosen benannt ist. Die drei Theoretiker stellten sich die Frage, ob die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Realität als vollständig angesehen werden kann – und schlossen, dass dem nicht so ist. Grund dafür das Phänomen der Verschränkung.
Spukhafte Fernwirkung
Die Wellenfunktion eines einzelnen Teilchens weist jeder möglichen Position, die es einnehmen könnte, eine Zahl zu. Nach Borns Regel entspricht die Wahrscheinlichkeit, es an einer der Positionen zu beobachten, dem Quadrat der zugehörigen Zahl. Wenn man dagegen zwei verschränkte Teilchen betrachtet, gibt es nicht zwei unabhängige Wellenfunktionen. Stattdessen weist die Quantenmechanik jeder möglichen Konfiguration des Zwei-Teilchen-Systems eine einzige Zahl zu. Und auch größere Systeme werden durch eine einzelne Wellenfunktion beschrieben; theoretisch gibt es sogar eine Wellenfunktion des gesamten Universums.
Quantenverschränkung
In der Quantenmechanik können in einem zusammengesetzten System mehrere Zustände miteinander verknüpft sein – auf eine Weise, die sich klassisch nicht erklären lässt.
Hier befinden sich Teilchen 1 und Teilchen 2 jeweils in einer Überlagerung von zwei möglichen Drehungen und sind miteinander verschränkt. Das Besondere an der Verschränkung: Wenn man einen der beiden Partner durch Messung auf einen eindeutigen Zustand festlegt, dann erhält auch der andere sofort einen bestimmten Zustand.
Beispielsweise können die Drehrichtungen von Teilchen 1 und 2 so miteinander verknüpft sein, dass Teilchen 2 stets andersherum rotiert als Teilchen 1. Dann legt man den Drehsinn von Teilchen 1 durch eine Messung fest – und kennt in diesem Moment zugleich den Zustand von Teilchen 2. Das gilt selbst dann, wenn dieses sich so weit vom ersten Teilchen entfernt befindet und seinerseits so schnell gemessen wird, dass sich beide Experimente keinesfalls gegenseitig beeinflussen können.
Somit kann die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem bestimmten Ort zu beobachten, davon abhängen, wo ein anderes Teilchen gemessen wird – unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. In der EPR-Arbeit argumentierten die Autoren, dass die Beobachtung des einen Teilchens den gemessenen Zustand des anderen unmittelbar beeinflusst. Damit scheint die Verschränkung gegen die spezielle Relativitätstheorie zu verstoßen, die besagt, dass sich Information nicht schneller als Licht bewegen kann.
Allerdings lässt sich Verschränkung nicht nutzen, um über große Entfernungen hinweg zu kommunizieren. Wenn man ein Quantenteilchen misst, ist zwar klar, was ein ferner Beobachter über das damit verschränkte Teilchen herausfindet. Die entfernte Person hat jedoch keinen Zugang zu diesem Wissen – es hat also keine Kommunikation stattgefunden. Dennoch gibt es zumindest eine gewisse Spannung zwischen der Art, wie die Quantentheorie die Welt beschreibt, und der Vorstellung von Raumzeit in der Relativitätstheorie.
In der Vergangenheit gab es zahlreiche Versuche, diese Spannung aufzulösen. Doch nach wie vor herrscht Uneinigkeit über die zentrale Frage: Soll die quantenmechanische Wellenfunktion die Realität abbilden – oder ist sie nur ein Werkzeug, mit dem sich die Wahrscheinlichkeit von Versuchsergebnissen berechnen lässt?
Verschiedene Deutungen der Quantenmechanik
Diese Frage trennte schon Einstein und seinen Kollegen Niels Bohr. Beide debattierten jahrzehntelang über die Bedeutung der Quantenmechanik. Einstein war wie Schrödinger überzeugter Realist: Seiner Meinung nach müssen Theorien die physikalische Wirklichkeit beschreiben. Bohr war hingegen ebenso wie Heisenberg bereit, sich mit korrekten Vorhersagen zufriedenzugeben.
Die erkenntnistheoretischen Ansichten von Bohr und Heisenberg sind als Kopenhagener Deutung bekannt, die sich bis heute in den meisten Lehrbüchern findet. Moderne Versionen davon sind beispielsweise der QBismus (kurz für »Quanten-Bayesianismus«) und die relationale Quantenmechanik. Diese Ansätze betrachten Quantenzustände nicht für sich allein, sondern nur in Bezug zu einem Beobachter, einem Messprozess oder den sich ändernden Wissensständen.
Bei den erkenntnistheoretischen Ansätzen lösen sich die Sorgen um überlichtschnelle Übertragungen in Luft auf. Denn wenn ein Beobachter etwas misst, aktualisiert er sein Wissen; nichts reist physisch von einem verschränkten Teilchen zum anderen. Allerdings erklären die Ansätze nicht, was sich in Wirklichkeit abspielt. Das ist insbesondere problematisch, weil sich die Wellenfunktion manchmal wie eine physikalische Größe verhält. Zum Beispiel kann sie mit sich selbst wechselwirken, wie das Doppelspaltexperiment zeigt: Eine Wellenfunktion, die zwei schmale Schlitze durchquert und auf der anderen Seite wieder zusammenläuft, interferiert mal konstruktiv und mal destruktiv. Dieses Verhalten erinnert an reale physikalische Größen.
Die Alternative zur erkenntnistheoretischen Sichtweise ist der ontologische Ansatz. Dort stellt der Quantenzustand die Realität dar, zumindest teilweise. Das Problem ist hierbei, dass man die Wellenfunktion selbst nie messen wird. Man benutzt sie nur, um Ergebnisse vorherzusagen. Im ontologischen Bild ist die Wellenfunktion eine Überlagerung vieler möglicher Messergebnisse. Wenn man eine Messung durchführt und das Ergebnis aufzeichnet, erscheint aber dieses real – und nicht die abstrakte Überlagerung von Möglichkeiten, die ihm vorausging.
Es gibt eine Reihe von ontologischen Modellen der Quantenmechanik, welche die zentrale Bedeutung von Wellenfunktionen mit ihrer schwierigen Beziehung zu Beobachtungsgrößen in Einklang bringen. In der »bohmschen Mechanik« etwa, die David Bohm in den frühen 1950er Jahren entwickelte, sind die Wellenfunktionen real – Teilchen jedoch auch. Die Theorie nutzt zusätzliche Variablen, die den Positionen der Teilchen entsprechen. Und am Ende sind es diese, die sich beobachten lassen. In seiner Viele-Welten-Interpretation verschränkt Hugh Everett hingegen die Beobachter mit den Quantensystemen. Dadurch wird jedes mögliche Messergebnis in separaten Zweigen der Wellenfunktion realisiert, die sich als Parallelwelten interpretieren lassen. In objektiven Kollapsmodellen wiederum kollabiert die Wellenfunktion an zufälligen Zeitpunkten von ganz allein.
Obwohl all diese Ansätze oft als konkurrierende Interpretationen angesehen werden, handelt es sich um unterschiedliche physikalische Theorien. Objektive Kollapsmodelle haben beispielsweise handfeste Auswirkungen (zum Beispiel verletzen sie die Energieerhaltung), was man bei ultrakalten Atomen beobachten könnte. Versuche dazu werden noch durchgeführt, doch bislang gibt es keine Hinweise darauf.
Auch nach 100 Jahren viele Unbekannte
Die Fachwelt ist sich selbst nach 100 Jahren nicht einig darüber, was eine Messung ist, ob Wellenfunktionen die physikalische Realität abbilden und ob es neben der Wellenfunktion weitere physikalische Variablen gibt. Trotzdem hat die Quantenmechanik die bislang präzisesten Vorhersagen der gesamten Wissenschaft geliefert. Die Übereinstimmungen zwischen Theorie und Experiment erstrecken sich über viele Dezimalstellen.
Die heutige Grundlage der Teilchenphysik ist eine Weiterentwicklung der Quantenmechanik: die Theorie der relativistischen Quantenfelder. Um auch die Erzeugung und Vernichtung von Teilchen sowie die Symmetrien der speziellen Relativitätstheorie zu berücksichtigen, greifen Physikerinnen und Physiker auf Quantenfelder zurück, die sich durch den gesamten Raum erstrecken. Kleine Schwingungen in den Feldern entsprechen hierbei einzelnen Teilchen. Untersucht man die Folgen dieser Vibrationen, lässt sich eine Fülle von beobachtbaren Phänomenen vorhersagen, die durch Experimente bestätigt wurden: von der Art und Weise, wie sich Quarks zu Protonen und Neutronen zusammenfügen, bis hin zur Existenz des Higgs-Bosons. Und gemäß der Theorie der kosmologischen Inflation könnte sogar die Entstehung von Sternen und Galaxien auf winzige Quantenschwankungen in der Dichte des frühen Universums zurückzuführen sein.
Trotz all dieser Erfolge gibt auch die Quantenfeldtheorie Rätsel auf. Zum Beispiel tauchen bei den Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten Unendlichkeiten auf – keine Eigenschaft, die man einer Wahrscheinlichkeit zugestehen möchte. Physiker und Physikerinnen haben dieses Problem mit »effektiven Feldtheorien« in den Griff bekommen. Sie beschreiben die Prozesse nur bei niedrigen Energien und Impulsen, wodurch die lästigen Unendlichkeiten ausbleiben.
Dafür treten allerdings andere Probleme auf. Die effektiven Feldtheorien erlauben es, die Werte einiger Größen wie die Masse des Higgs-Bosons oder die Energiedichte des Vakuums zu berechnen. Allerdings fallen die beobachteten Werte deutlich kleiner aus als die theoretischen Vorhersagen.
Und dann ist da noch die größte Schwierigkeit von allen: die Suche nach einer Quantentheorie der Gravitation und der gekrümmten Raumzeit. Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass die Quantenmechanik selbst keiner Änderung bedarf. Demnach muss man herausfinden, wie sich die gekrümmte Raumzeit in den Quantenformalismus einfügen lässt. Doch von diesem Ziel scheint die wissenschaftliche Welt noch weit entfernt.
In der Zwischenzeit finden die zahllosen Erscheinungsformen der Quantenphysik immer mehr technologische Anwendungen: Die Quantenchemie eröffnet neue Wege bei der Entwicklung von Arzneimitteln, exotischen Materialien und der Energiespeicherung. Quantenmetrologie und -sensorik ermöglichen Messungen mit bisher unerreichter Präzision – bis hin zum Nachweis von Gravitationswellen, erzeugt von Schwarzen Löchern in einer Entfernung von einer Milliarde Lichtjahren. Quantencomputer versprechen künftig Berechnungen durchzuführen, die mit klassischen Computern unerreichbar sind. Und all das wurde möglich, obwohl bis heute keine Einigkeit darüber herrscht, wie die Quantenmechanik im Kern funktioniert.

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben