Experimente der Zukunft: Wie sich die Quantennatur von Raum und Zeit vermessen lässt
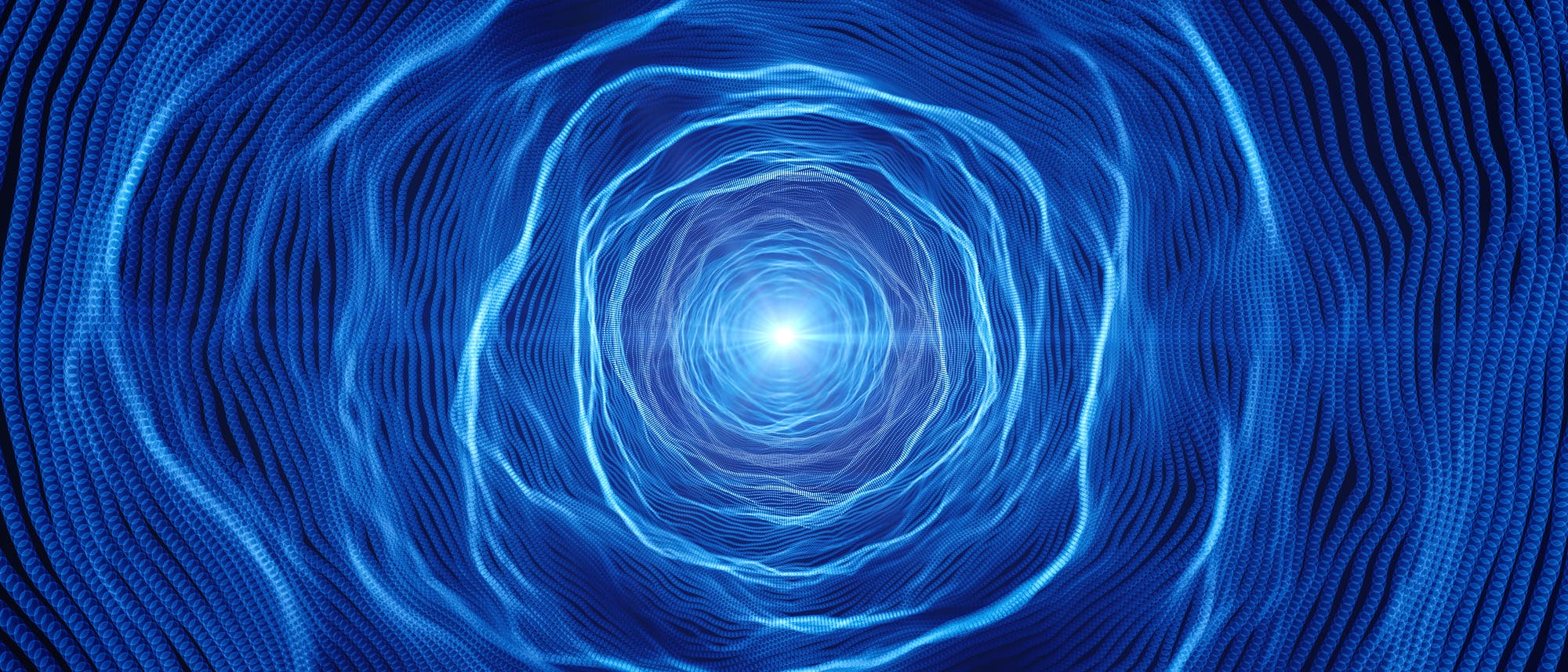
In den vergangenen Jahrhunderten hat sich unser Weltbild immer wieder gewandelt. Von einer flachen Erde zu einer runden; von einem Planeten, der im Zentrum des Universums steht, hin zu einem gigantischen Kosmos, in dem wir nur einen kleinen, unbedeutenden Platz einnehmen. Auch unsere Sicht auf das Kleinste hat sich im Lauf der Zeit verändert, etwa die Vorstellung, wie sich unsere Welt aus elementaren Grundbausteinen zusammensetzt – und wer hätte geahnt, dass sie sich völlig kontraintuitiv verhalten und seltsamen Quantengesetzen folgen?
In einem Brief an seinen Freund Maurice Solovine erklärt Albert Einstein die Entstehung von Weltbildern folgendermaßen: Alles beginnt mit Beobachtungen, aus denen man intuitiv Hypothesen über die Welt aufstellt. Indem man diese mathematisch ausformuliert, ergibt sich eine physikalische Theorie. Diese ermöglicht Vorhersagen für zukünftige Beobachtungen, die sich durch Experimente testen lassen. Laut Einstein ist es die »Prüfung an der Erfahrung«, die darüber entscheidet, welche Theorien die Welt erklären – und welche dafür untauglich sind. Widersprechen die Messergebnisse den Vorhersagen der Theorie, müssen die Hypothesen geändert werden, und alles beginnt aufs Neue. Es sind diese Hypothesen, die unser physikalisches Weltbild bestimmen.
Weil die Forschung immer weiter voranschreitet und immer präzisere Messungen ermöglicht, kann – und wird – sich unser Weltbild ändern. So hat sich die Menschheit mittlerweile von den Weltanschauungen des europäischen Mittelalters verabschiedet, etwa von der Vorstellung, dass Engel eine Sphärenkugel drehen, die für die Bewegung der Sterne verantwortlich ist. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Gerade deswegen ist es wichtig, unser Weltbild konstant zu hinterfragen: Sind unsere Annahmen über die Welt frei von Widersprüchen?
Momentan sieht es nicht danach aus. Das Hauptproblem liegt bei den zwei Hauptpfeilern der modernen Physik: der Quantentheorie und der Theorie der Gravitation. Sie beruhen auf völlig unterschiedlichen Hypothesen.
Eine gequantelte Welt
Mein Büro befindet sich im vierten Stock der Wiener Boltzmanngasse, direkt neben dem ehemaligen Büro von Erwin Schrödinger und der Bibliothek, die seine Briefe verwaltet. Dort bin ich neulich auf eine Nachricht gestoßen, die Einstein im August 1935 aus den USA verschickt hat:
»Lieber Schrödinger, Du bist faktisch der einzige Mensch, mit dem ich mich wirklich gerne auseinandersetze. Fast alle die Kerle sehen nämlich nicht von den Tatbeständen aus die Theorie, sondern nur von der Theorie aus die Tatbestände; sie können aus dem einmal angenommenen Begriffsnetz nicht heraus, sondern nur possierlich darin herumzappeln. Du aber schaust es nach Wunsch von aussen und von innen an. Dabei sind wir in der Auffassung des zu erwartenden Weges schärfste Gegensätze!«
Der Rest des Briefs behandelt Themen aus der Physik und Philosophie, die uns noch heute umtreiben: das Ringen um das Verständnis, was die Quantenphysik über die Welt aussagt. Die Diskussion zwischen den beiden Physikern kulminiert schließlich in »Schrödingers Katze«.
Schrödingers Katze
1935 schlug Erwin Schrödinger ein scheinbar paradoxes Gedankenexperiment vor: Man nehme eine Katze und sperre sie in eine Kiste. Außerdem stelle man noch ein Giftfläschchen (grün auf dem Bild) dazu sowie ein radioaktives Element (lila Kiste). Ein Geigerzähler (gelb) ermittelt, ob der Atomkern zerfällt, und löst in einem solchen Fall einen Mechanismus aus, der das tödliche Gift freisetzt. Das klingt grausam, verdeutlicht aber nur ein fundamentales Dilemma der Quantentheorie, mit dem der österreichische Theoretiker ihre Unvollständigkeit demonstrieren wollte. Das Problem: Der radioaktive Atomkern ist nach den Gesetzen der Quantentheorie zunächst in einem Überlagerungszustand aus »zerfallen und nicht zerfallen«. Würden jene Gesetze nun auch für makroskopische Objekte wie eine Katze gelten, müsste sich diese ebenfalls in einem Überlagerungszustand, nämlich »lebend und tot«, befinden. In einer derartigen Phase sind für Atom und Katze lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich.
Erst beim Öffnen der Kiste (dem Moment der Beobachtung oder Messung) ändert sich die Lage dramatisch. Dann enthüllt das Atom einen der beiden Zustände »zerfallen« oder »nicht zerfallen« – und die Katze erweist sich entsprechend als »tot« oder »lebendig«. So erklärt es jedenfalls die Kopenhagener Interpretation dieser bizarren Quantenphänomene, der die meisten Physiker anhängen. Die Wellenfunktion beschreibt nur unser Wissen über zukünftige Beobachtungen und reduziert sich daher nach einer Messung von einem überlagerten Mischzustand zu einem eindeutigen Zustand.
Das berühmte Gedankenexperiment beruht auf der wohl bemerkenswertesten Eigenschaft der Quantenphysik: Dort gibt es Experimente, deren Ergebnisse der Annahme widersprechen, dass ein System entweder in einem oder in einem anderen von zwei möglichen Zuständen ist. Dieses Phänomen ist als Quantensuperposition oder auch Überlagerung bekannt.
Ein Beispiel dafür ist das Doppelspaltexperiment. Das Auftreten von Interferenzstreifen kann nicht dadurch erklärt werden, dass jedes Teilchen nur durch einen der beiden Spalte gegangen ist. Es scheint so, als habe ein Teilchen beide Spalte gleichzeitig durchlaufen. Tatsächlich zeigen aber andere Messungen, dass sich immer nur ein Teilchen im Experiment befindet. Allerdings ist dieses vor der Messung in einem Zustand, der die Kategorisierung »an einem bestimmten Ort befindliches Teilchen« nicht zulässt.
Das ist der Ursprung des berühmten Welle-Teilchen-Dualismus. Wenn sich ein Teilchen in einer Quantensuperposition bezüglich des Orts befindet, ist jede Aussage über seine Position sinnlos. Stattdessen kann man sagen: Es lässt sich ein Experiment durchführen, dessen Ausgang der Annahme widerspricht, dass das Teilchen entweder Weg A oder Weg B gegangen ist. Aber weil das so ein fürchterlich langer Satz ist, nutzt man oft die Kurzform und sagt: Das Teilchen geht beide Wege gleichzeitig.
Verknüpft man die Quantensuperposition eines Teilchens mit einer – in Schrödingers Worten – »Höllenmaschine«, die eine Katze je nach Zustand des Teilchens vergiftet oder nicht, ließe sich eine Situation erreichen, in der eine Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Einstein hat sein Unbehagen darüber in obigem Brief sehr deutlich gemacht: »In Wahrheit gibt es eben zwischen [diesen beiden möglichen Zuständen] kein Zwischending.«
Unabhängig davon, wie skurril diese Situation erscheint: Zahllose moderne Versuche bestätigen die Vorhersagen der Quantenphysik. Zum Beispiel haben die Experimente meiner Kollegen Markus Arndt und Anton Zeilinger gezeigt, dass sich ein einzelnes Molekül so verhält, als würde es beide möglichen Wege durch einen Doppelspalt gehen. Der experimentelle Nachweis der Quantensuperposition und die daraus folgenden intellektuellen und philosophischen Herausforderungen sind ein zentraler Bestandteil des Weltbilds, das die Quantenphysik prägt.
Eine verformbare Raumzeit
Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist die bislang erfolgreichste Theorie, um Phänomene der Gravitation zu beschreiben. Sie löst Newtons Idee einer Schwerkraft ab – und zwar durch die Bewegung in einer gekrümmten Raumzeit. »Die Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll; und die Materie sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll«, brachte es der Physiker John Archibald Wheeler auf den Punkt. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie folgen selbst Lichtstrahlen der Geometrie des gekrümmten Raums. Das konnte Arthur Eddington im Jahr 1919 nachweisen.
Einsteins Theorie ist bislang auf allen Skalen des beobachtbaren Universums bestätigt: von Gravitationswellen (die Einstein 1916 vorhersagte und die 2015 erstmals beobachtet wurden) bis hin zum Einfluss der Gravitation auf die Zeit. Uhren laufen abhängig von der Stärke des Gravitationsfelds schneller oder langsamer, was etwa Satellitennavigationssysteme wie GPS berücksichtigen müssen. Ein höchst beeindruckendes Beispiel hierfür ist ein Experiment von Forschenden um den späteren Nobelpreisträger David Wineland, die im Jahr 2010 gezeigt haben, wie sich die Frequenz einer Atomuhr ändert, wenn man den experimentellen Aufbau um nur 30 Zentimeter im Gravitationsfeld der Erde anhebt. Mittlerweile sind Atomuhren so genau, dass bereits Veränderungen von weniger als einem Millimeter beobachtet werden – etwa im Jahr 2022 vom Physiker Jun Ye an der University of Boulder.
Wenn die Quantentheorie stimmt, müssen wir unsere Vorstellung von Raum und Zeit aufgeben. Wenn andernfalls die allgemeine Relativitätstheorie zutrifft, muss man die Rolle der Quantentheorie überdenken
Wie sich die Schwerkraft auf Quantensysteme auswirkt, konnte ein Team um den Physiker Samuel Werner bereits 1975 zeigen. Mit einem Interferometer beobachtete es den Einfluss des Gravitationsfelds der Erde auf das Wellenpaket eines Neutrons. Heute wird dieser Effekt in Atominterferometern genutzt, um die Erdbeschleunigung genau zu bestimmen. Besonders faszinierend sind in diesem Zusammenhang die Experimente in den Labors von Mark Kasevich an der Stanford University. Die Forschenden erzeugen dort Überlagerungen von Atomen auf der Skala eines halben Meters – und können damit sogar untersuchen, wie sich die Raumzeitkrümmung über diese Distanz auf ein einzelnes Quantensystem auswirkt.
Auch an der Schnittstelle zwischen Quantenphysik und Gravitation gilt: Alle bislang durchgeführten Experimente passen zu den Vorhersagen der bestehenden Theorien der Schwerkraft. In diesen Fällen werden die Quantensysteme weiterhin durch die Quantentheorie beschrieben und die Gravitationsphänomene durch die allgemeine Relativitätstheorie.
Zwei widersprüchliche Weltbilder
Das heißt, die allgemeine Relativitätstheorie funktioniert. Und die Quantentheorie auch. Es gibt bis heute kein Experiment, das den Vorhersagen dieser beiden Theorien widerspricht.
Doch die zwei Theorien beruhen auf unterschiedlichen Weltbildern, die sich gegenseitig ausschließen. Die Gravitationstheorie weiß mit dem Superpositionsprinzip der Quantenphysik nichts anzufangen (es gibt immer nur eine Raumzeit), und die Quantentheorie kann nicht mit einer Raumzeit leben, die unabhängig vom Beobachter fest vorgegeben ist. Mit anderen Worten: Wenn die Quantentheorie stimmt, müssen wir unsere Vorstellung von Raum und Zeit aufgeben. Und falls die allgemeine Relativitätstheorie zutrifft, muss man die Rolle der Quantentheorie überdenken.
Das Problem könnte eine Quantentheorie der Gravitation lösen, welche die allgemeine Relativitätstheorie ersetzt. Eine erste Version dafür stellte der sowjetische Physiker Matvei Bronstein bereits im Jahr 1936 auf. Inzwischen gibt es einen regelrechten Zoo von möglichen Theorien: von der Stringtheorie über die asymptotische Sicherheit bis hin zur Supergravitation und Schleifenquantengravitation. All diese Ansätze führen neue Hypothesen ein, deren experimentelle Konsequenzen sich bisher noch nicht prüfen ließen. Wir haben also Quantentheorien der Gravitation, wissen aber nicht, ob die Natur sie auch verwendet.
Zum Beispiel sagen manche Varianten der Stringtheorie voraus, dass sich die Anziehungskraft der Gravitation auf kurzen Distanzen ändern sollte. Den bestehenden Theorien der Schwerkraft zufolge nimmt die Anziehung zweier Objekte mit dem Abstandsquadrat ab. In Experimenten wird dieser Zusammenhang bei immer kleineren Abständen überprüft. So hat ein Team um Eric Adelberger und Blayne Heckel von der University of Washington in Seattle im Jahr 2020 die gravitative Anziehung von 50 Mikrometer entfernten Massen bestimmt, ohne Hinweise auf eine Abweichung zu finden.
Folgt die Gravitation den Quantengesetzen?
Aber könnte es nicht auch umgekehrt sein? Vielleicht lässt sich Gravitation gar nicht quantisieren. Ein prominenter Vertreter dieser Hypothese ist Sir Roger Penrose, der gar eine »Gravitisierung« der Quantentheorie fordert. Und auch Jonathan Oppenheim vom University College London stellte im Jahr 2023 eine Theorie vor, die eine klassische Gravitation beibehält und dafür zufällige Schwankungen – eine Art Rauschen – in die Struktur der Raumzeit einführt.
Aus theoretischer Sicht sind beide Varianten möglich: eine Welt, in der die Gravitation den Gesetzen der Quantenphysik folgt, und eine Welt, in der sie das nicht tut. Daher sind wir auf Experimente angewiesen, um herauszufinden, welche der Möglichkeiten in der Natur umgesetzt ist.
Hierbei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen: Zum Beispiel könnte man aus den vielen vorgeschlagenen neuen Theorien eine konkrete aussuchen und eines der vorhergesagten Phänomene testen. Man spricht hier von der direkten Suche nach »neuer Physik« – etwa Abweichungen vom Abstandsgesetz oder dem Auftreten eines Hintergrundrauschens in der Schwerkraft. Liefern solche Experimente ein negatives Ergebnis (sogenannte »Nullresultate«), lassen sich die Parameter der neuen Theorien weiter einschränken. So war es bislang. Ein tatsächliches Signal wäre hingegen ein Gamechanger für die Physik.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen Schwerkraft und Quantenphysik zu untersuchen, ohne sich dabei auf einen bestimmten neuen Ansatz zu fokussieren. Die Idee hierfür lehnt sich an die Entdeckungsgeschichte des Photons an.
Im Jahr 1905 vermutete Einstein, dass Licht aus einzelnen Teilchen bestehen könnte, die heute als Photonen bezeichnet werden. Die Fachwelt lehnte das jedoch jahrzehntelang ab. Die Theorie der Elektrodynamik, die das Licht als Welle beschreibt, galt als ausreichend, um Lichtphänomene zu erklären – es genügte, die Quantentheorie auf die Materie anzuwenden. »Selbst wenn Einstein mir ein Telegramm schickt, dass nun ein unwiderlegbarer Beweis für die physikalische Existenz von Lichtquanten gefunden wurde, kann mich die Nachricht nicht erreichen, weil sie durch elektromagnetische Wellen übertragen werden muss«, schrieb Niels Bohr noch im Jahr 1925.
Erst Experimente des US-Physikers John Clauser in den 1970er Jahren konnten alle Zweifel ausräumen. Clauser wies Phänomene nach, die den Vorhersagen der Elektrodynamik widersprachen. Dafür erzeugte er nichtklassische Zustände von Licht und konnte deren Eigenschaften direkt messen.
Ein Ja-Nein-Experiment für die Schwerkraft
Bei Clausers Versuchen handelte es sich um Ja-Nein-Experimente: Ein positives Resultat widerlegt die klassische Elektrodynamik, ein negatives Resultat die Quantentheorie. Deshalb stellt sich die Frage, ob ein analoges Ja-Nein-Experiment für die Gravitation möglich ist. Lassen sich nichtklassische Zustände des Gravitationsfeldes erzeugen und beobachten?
1957 luden die Physikerin Cécile de Witt-Morette und ihr Mann, der Physiker Bryce de Witt, die führenden Köpfe auf dem Gebiet der Gravitationstheorie nach Chapel Hill ein, um über die Zukunft ihres Feldes zu diskutieren. Dort schlug der ebenfalls anwesende Richard Feynman erstmals ein solches Experiment vor. Er stellte dabei die Frage in den Raum, was passieren würde, wenn man ein Quantensystem so schwer macht, dass es selbst ein Gravitationsfeld erzeugt. Wenn das System in einer Quantensuperposition ist, wird dann auch die Raumzeit überlagert sein?
Das lässt sich überprüfen, wenn man das Gravitationsfeld des schweren Quantenobjekts auf eine zweite Masse wirken lässt, eine »Testmasse«. Falls die Quantentheorie korrekt ist, bewegt sich die Testmasse ebenfalls in einer Superposition durch beide möglichen Raumzeiten. Dann haben wir denselben Zustand, den die Katze und das Teilchen im Gedankenexperiment von Schrödinger eingenommen haben. Die zwei Massen sind verschränkt, das heißt, sie sind so untrennbar miteinander verbunden, dass sie sich nicht mehr separat voneinander beschreiben lassen. Das ließe sich nachweisen – und zwar durch ein Experiment, dessen Ausgang der Annahme widerspricht, dass entweder die eine oder die andere Raumzeit-Konfiguration vorgelegen hat. Falls hingegen die einsteinsche Gravitationstheorie wahr ist, erzeugt das Quantenobjekt eine eindeutige Raumzeit, in der sich die Testmasse entlang einer wohldefinierten Bahn bewegt. In diesem Fall kann es keine Verschränkung geben.
Feynmans Vorschlag ist daher ein Ja-Nein-Experiment. Sind die Massen verschränkt, widerlegt das die allgemeine Relativitätstheorie, andernfalls ist die Quantentheorie falsch.
Kann ein solches Experiment realisiert werden? Die Verschränkung von Quantensystemen wurde inzwischen in zahlreichen Versuchen nachgewiesen. Allerdings ist die Verschränkung durch gravitative Eigenschaften von Objekten deutlich komplizierter. Ein Grund dafür hängt mit der Dauer zusammen, die es braucht, bis sie verschränkt sind. Für zwei Atome, die jeweils rund zehn Nanometer räumliche Superposition aufweisen und einen Mikrometer voneinander entfernt sind, müsste man etwa 1024 Sekunden lang warten – das ist etwa eine Million Mal länger, als das Universum existiert. Für zwei 50 Mikrometer große Bleikugeln im Abstand von einem Millimeter würde es hingegen nur 0,01 Sekunden dauern. Daher ist es nötig, möglichst große Quantensuperpositionen von möglichst massereichen Festkörpern zu erzeugen und diese dann miteinander zu verschränken.
Vor knapp 70 Jahren schien so ein Versuch noch völlig außer Reichweite. »Eine ernsthafte Schwierigkeit ist der Mangel an Experimenten«, sagte Feynman damals. »Also müssen wir einen Standpunkt einnehmen, wie man mit Problemen umgeht, für die uns keine Experimente zur Verfügung stehen.«
Heute sieht das anders aus. Wir wissen mittlerweile, wie so ein Experiment aussehen könnte, und es gibt konkrete Pläne, es umzusetzen. Die Idee besteht darin, Quantensuperpositionen von Objekten zu realisieren, die so groß sind, dass sie ein messbares Gravitationsfeld erzeugen.
Dieser Herausforderung nähert sich die Fachwelt aus zwei verschiedenen Richtungen. Einerseits wird versucht, das Gravitationsfeld immer kleinerer Massen zu bestimmen. Andererseits erzeugen Forschende Quantensuperpositionen von immer größeren Systemen. Seit einigen Jahren widmen sich Gruppen auf der ganzen Welt diesen Aufgaben und verschieben dabei stets aufs Neue die Grenzen des Machbaren.
Kleine Massen vermessen
In unseren Labors in Wien haben wir beispielsweise das Gravitationsfeld der bislang kleinsten Masse bestimmt: einer 90 Milligramm leichten Goldkugel, was etwa dem Gewicht eines Marienkäfers entspricht. Dafür lenkten wir die Kugel periodisch aus und erzeugten damit ein sich zeitlich änderndes Gravitationsfeld, das eine in der Nähe befindliche zweite Masse beeinflusst. Die zweite Masse schwingt sich auf, und diese Auslenkung kann man messen.
Auch wenn die Idee des Experiments einfach klingt, gestaltet sich die Ausführung kompliziert: Gravitation ist die schwächste Kraft im Universum. Das macht sich vor allem bei kleinen Massen bemerkbar. Durch das Gravitationsfeld der Goldkugel erfährt die zweite Masse eine Beschleunigung, die rund 30 Milliarden Mal kleiner ist als die der Erdanziehung. Die erwartete Auslenkung der zweiten Kugel beträgt nur zwei Nanometer, also zwei millionstel Millimeter.
Die größte Schwierigkeit stellte dabei der Straßenverkehr rund um unser Laborgebäude dar. Ständig störten Erschütterungen durch Busse, Autos und Fußgänger unsere Experimente – und sogar das Gravitationsfeld der 90 Tonnen schweren Straßenbahnen, die 70 Meter von unserem Labor entfernt entlangfahren. Deshalb führten wir viele Messungen zwischen Mitternacht und fünf Uhr früh durch, wenn der Verkehr gering ist. Während der Ruhe der Weihnachtsferien konnten wir unsere Experimente abschließen und das Gravitationsfeld der winzigen Goldkugel vermessen.
Derzeit bereiten wir ein Experiment vor, um das Gravitationsfeld einer 10 000-fach leichteren Masse zu bestimmen – was in etwa dem Gewicht einer Planck-Masse entspricht. Um die Umwelteinflüsse zu minimieren, bauen wir die Versuche in einem Bergwerksstollen in der Nähe von Wien auf.
Große Quantensysteme
Wir sind also auf einem guten Weg dahin, das Gravitationsfeld für sehr kleine Massen zu vermessen. Aber wie sieht es mit den Quanteneigenschaften solcher Massen aus?
Wir wissen bereits, dass sich Quantenüberlagerungen herstellen lassen: von Atomen bis hin zu Makromolekülen. Zu den Goldmassen der Gravitationsexperimente fehlen allerdings noch 18 Größenordnungen. Um hinreichend große Massen zu erreichen, deren Gravitationsfelder auch bestimmt werden können, benötigt man viele Atome in einem möglichst kleinen Volumen, das heißt hohe Dichten, wie sie nur in Festkörpern vorkommen.
Daher stellt sich die Frage, wie sich Superpositionen von Festkörpern herstellen lassen. Auch in diesem Bereich hat sich viel getan. In den 2000er Jahren haben Forschungsgruppen in Experimenten untersucht, wie sich die Bewegungen von Festkörpern kontrollieren lassen, damit sie den Gesetzen der Quantenphysik folgen. Daraus ist das spannende Gebiet der Quanten-Optomechanik entstanden. Die Grundidee ist einfach: Mit dem Strahlungsdruck von Licht lassen sich selbst massereiche Objekte bis in den Quantengrundzustand ihrer Bewegung abbremsen. Sie sind dann durch ihre Wellenfunktion beschreibbar. Das ist das Prinzip der Laserkühlung – angewendet auf Festkörper mit Milliarden von Atomen!
Heute wird die Quantenkontrolle von mechanischer Bewegung in vielen Laboren weltweit umgesetzt. Der Massenbereich der Quantenobjekte umfasst knapp 17 Größenordnungen: von kleinsten nanomechanischen Wellenleitern bis hin zu den makroskopischen, 20 Kilogramm schweren Spiegeln von Gravitationswellendetektoren.
Für das von Feynman erdachte Experiment müssen wir aber zusätzlich eine Quantensuperposition von Zuständen herstellen können, deren Gravitationsfelder sich messbar unterscheiden lassen. Das ist für schwere Objekte derzeit wegen eines merkwürdigen Umstands allerdings noch nicht möglich: je größer die Massen, desto kleiner die »Delokalisierung«, das heißt der räumliche Abstand der Zustände. Während mit einzelnen Atomen Überlagerungen über einen halben Meter und darüber hinaus erreicht werden, liegt die Delokalisierung für Festkörpersysteme mit 1018 Atomen im Bereich von Attometern (10–18 Metern), wie die Forschungsgruppe um Yiwen Chu im Jahr 2023 an der ETH Zürich zeigte.
Mit Lasern zu größerer Delokalisierung
Eine Möglichkeit, größere Delokalisierungen zu erreichen, bieten Ideen aus der Atomphysik. Die Lichtkräfte ermöglichen es, nicht nur einzelne Atome, sondern auch massereiche Festkörper in optischen Fallen einzufangen und zu manipulieren. Bereits in den 1970ern hat Arthur Ashkin mikrometergroße Glaskugeln auf diese Weise eingefangen.
Mittlerweile ist es möglich, Glaskugeln mit bis zu 200 Nanometern Durchmesser (also etwa 10 000-mal kleiner und 1012-mal leichter als die Goldkugeln) so zu kontrollieren, dass man ihre Bewegung quantenmechanisch durch ein Wellenpaket beschreiben muss. In unseren Labors können wir die Teilchenbewegung mit einer Genauigkeit messen, die nur durch die heisenbergsche Unschärfe begrenzt ist – eine fundamentale Grenze, die sich nicht überwinden lässt. Damit können wir in Echtzeit den quantenmechanischen Weg einer Glaskugel bei Raumtemperatur verfolgen. Diese Information lässt sich verwenden, um die Bewegung des Teilchens in dessen Quantengrundzustand zu stabilisieren: Schaltet man die Falle ab, dehnt sich das Wellenpaket des Teilchens aus. Das heißt, die Delokalisierung wächst um ein Vielfaches an – bis in den Bereich, der für die Gravitationsexperimente relevant wird. Im geschilderten Beispiel ließe sich nach nur zwölf Millisekunden die Delokalisierung um ein 30 000-Faches vergrößern. Solche Experimente finden aktuell in Wien, Tokio und Zürich statt.
Eine andere Möglichkeit haben Forschende um Sougato Bose vom University College London und Gerard Milburn von der australischen University of Queensland im Jahr 2017 postuliert: Mithilfe von im Festkörper eingebetteten Spins sollte es möglich sein, die Superposition der Massen zu erzeugen und ihre Verschränkung auszulesen. Erste Versuche werden gerade von einer Forschungsgruppe um den Physiker Ron Folman an der Ben-Gurion-Universität durchgeführt.
Eine Herausforderung für all diese Experimente wird in den kommenden Jahren darin bestehen, Quanteneffekte möglichst lange zu erhalten, also die Dekohärenz möglichst klein zu halten. Dafür müssen die Experimente im Vakuum stattfinden; das schützt die Systeme vor unerwünschten Stößen mit Gasmolekülen. Darüber hinaus müssen die Objekte auf extrem niedrige Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt abgekühlt werden, um die Emission, Absorption und Streuung von Wärmestrahlung zu verhindern.
Das macht die geplanten Experimente à la Feynman so schwierig: Es sind nicht nur große Massen nötig, sondern auch eine starke räumliche Delokalisierung sowie lange Kohärenzzeiten. Gemessen am momentanen Stand der Technik sind noch etliche Größenordnungen zu überwinden, damit ein solches Experiment tatsächlich realisiert werden kann.
Doch auch wenn es noch viel zu tun gibt: Im Gegensatz zur Situation in den 1950er Jahren, als sich die Gravitationsphysiker in Chapel Hill versammelten, ist nun immerhin klar, was zu tun ist. Damals verließen die Fachleute das Treffen mit zwei grundlegenden Fragen, denen sie sich widmen wollten: Existieren Gravitationswellen? Benötigt die Gravitation eine Quantenbeschreibung? Die erste Frage wurde 2015 bejaht. Bei der zweiten Frage scheinen wir nun zumindest auf einem guten Weg zu sein.
Dank der beeindruckenden Entwicklungen in der Kontrolle von Quantensystemen haben wir die Ebene der Gedankenexperimente verlassen. Wir wissen mittlerweile, wie wir einer handfesten Antwort auf die Frage näher kommen, ob es für die Schwerkraft eine Quantenbeschreibung braucht. Und was auch immer dabei herauskommt: Es wird eine Revision unseres Weltbilds erfordern.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.