Maschinelles Lernen in der Physik: KI führt zu überraschenden Experimenten und neuen Entdeckungen
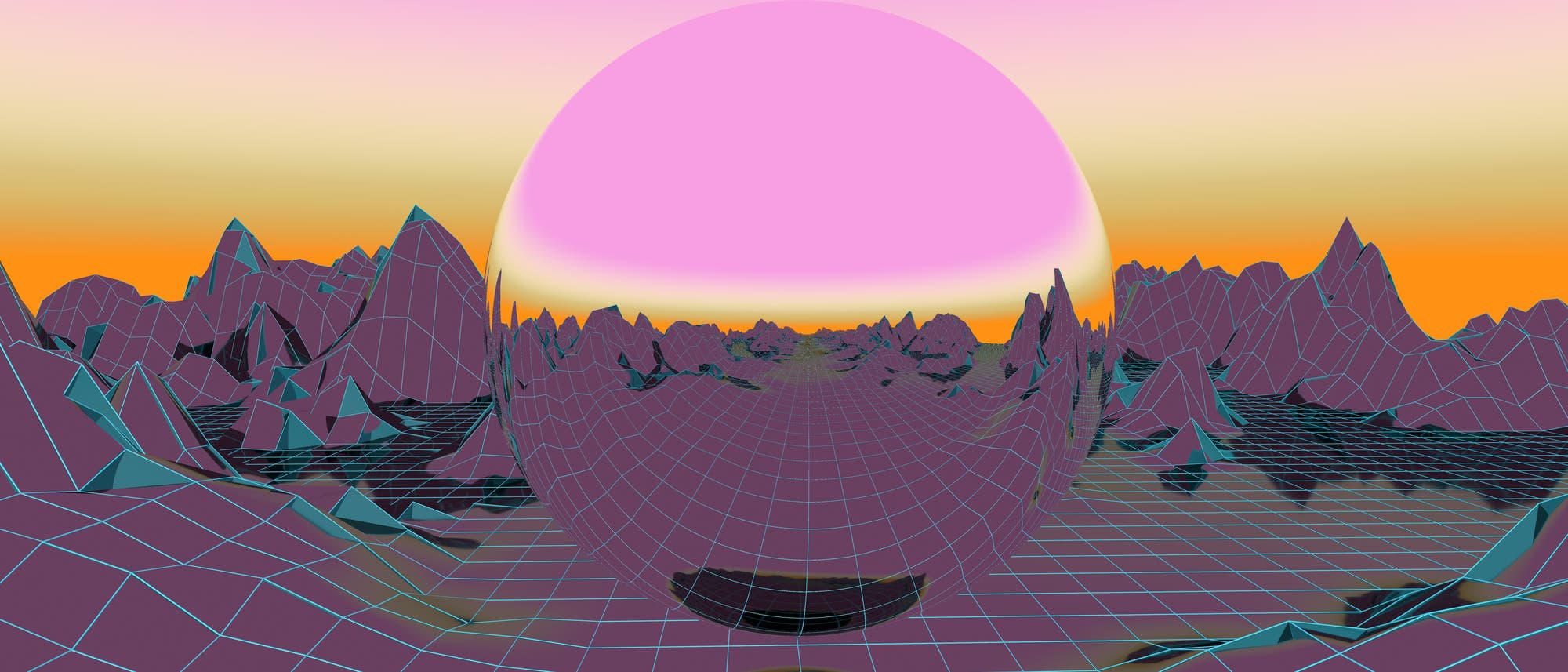
Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2023 ist KI in den Alltag vieler Menschen eingezogen. Sie nutzen die Programme immer häufiger als Suchmaschine, persönlichen Ratgeber oder gar Freund. Auch in der naturwissenschaftlichen Forschung spielen die Algorithmen eine zunehmend größere Rolle. Zwar haben sie noch keine grundlegend neue Erkenntnis hervorgebracht, aber sie entwickeln sie sich mehr und mehr zu einem leistungsstarken Werkzeug.
So werden Programme des maschinellen Lernens schon seit den 1990er Jahren am europäischen Kernforschungszentrum CERN eingesetzt. Denn die Experimente am weltweit größten Teilchenbeschleuniger erzeugen so viele Daten, dass sie jeden verfügbaren Computerspeicher sprengen würden. KI-Algorithmen helfen dabei, die enormen Mengen vorzusortieren und nur die potenziell interessanten Informationen zu speichern.
Inzwischen greifen Fachleute auch auf modernere KI-Modelle zurück, um die Umsetzung eines Experiments zu planen. Die Programme schlagen Versuchsaufbauten vor, die auf den ersten Blick total abwegig erscheinen, aber eine deutlich höhere Präzision versprechen. Darüber hinaus nutzen Forschende nun außerdem die größte Stärke dieser Algorithmen für ihre Forschung: die Erkennung verborgener Muster in großen Datenmengen. Fachleute wie der Physiker Rana Adhikari vom California Institute of Technology sind überzeugt, dass eine solche Zusammenarbeit von Mensch und Maschine neue Entdeckungen hervorbringen könnte: »Der Mensch kann von den Lösungen der KI lernen.«
KI für Gravitationswellendetektoren
Unter allen Laboren, die höchstpräzise Messungen erlauben, spielt das Gravitationswellenobservatorium LIGO noch einmal in einer eigenen Liga. In den Gravitationswellendetektoren werden Laserstrahlen auf vier Kilometer langen Armen eines riesigen Aufbaus in L-Form hin- und hergeschickt, ein sogenanntes Interferometer. Wenn eine Gravitationswelle die Erde passiert, ändert sich die Länge des einen Arms im Verhältnis zum anderen um weniger als die Breite eines einzelnen Protons. LIGO ermöglicht die Messung dieses winzigen Unterschieds – und damit ganz neue wissenschaftliche Entdeckungen.
Physikerinnen und Physiker haben jahrzehntelang an der Konstruktion solcher Maschinen gearbeitet; sie mussten dafür die technischen Grenzen voll und ganz ausschöpfen. 1994 begannen schließlich die Bauarbeiten für das ehrgeizige Projekt, und sie dauerten mehr als 20 Jahre lang an. Und dann, im Jahr 2015, war es endlich so weit: LIGO konnte die erste Gravitationswelle messen – eine Welle im Raum-Zeit-Gefüge, die von der weit entfernten Kollision zweier Schwarzer Löcher herrührte.
Rana Adhikari leitete Mitte der 2000er Jahre ein Team, das den Aufbau des Gravitationswellendetektors optimieren sollte. Er und eine Handvoll Mitarbeiter feilten akribisch an den Bauteilen des LIGO-Designs und überwanden alle Hindernisse, die dem empfindlichen Gerät im Weg standen. Nach dem bahnbrechenden Nachweis im Jahr 2015 wollte Adhikari herausfinden, ob sich das Design von LIGO weiter verbessern lässt, um beispielsweise Gravitationswellen in einem breiteren Frequenzband nachweisen zu können. Damit ließen sich verschmelzende Schwarze Löcher unterschiedlicher Größe erkennen – oder man könnte auch auf etwas völlig Unerwartetes stoßen. »Was wir wirklich gerne entdecken würden, ist eine wilde, neue, astrophysikalische Sache, die sich niemand vorstellen kann«, hofft Adhikari.
Um den Aufbau des Detektors zu optimieren, griffen er und sein Team auf KI zurück. Genauer: auf eine Software, die der Physiker Mario Krenn entwickelt hat, um Experimente in der Quantenoptik zu entwerfen. Zunächst übergaben die Forschenden dem Programm alle verfügbaren Komponenten und Geräte, mit denen sich ein beliebig kompliziertes Interferometer konstruieren lässt. Anfangs setzten sie der KI keine Grenzen. Das Programm konnte einen Detektor entwerfen, der sich über Hunderte von Kilometern erstreckt und aus tausenden Bauelementen wie Linsen, Spiegeln oder Lasern besteht. »Die Ergebnisse, die das Ding uns lieferte, waren völlig unverständlich«, sagt Adhikari. »Sie waren viel zu kompliziert und sahen aus wie von Außerirdischen designt. Nichts, was ein Mensch gestalten würde. Es hatte keinen Sinn für Symmetrie, Schönheit oder sonst etwas. Es war einfach nur Chaos.«
»Wenn meine Studierenden so etwas abgeliefert hätten, hätte ich das als lächerlich abgetan«Rana Adhikari, Physiker
Doch schnell fanden die Forscher heraus, wie sie die KI einstellen mussten, damit sie umsetzbare Ideen liefert. Die Ergebnisse waren dennoch weiterhin verwirrend. »Wenn meine Studierenden so etwas abgeliefert hätten, hätte ich das als lächerlich abgetan«, so Adhikari. Aber der Aufbau erwies sich als nützlich.
Es dauerte Monate, um die Ergebnisse der KI zu verstehen. Die Maschine hatte einen zusätzlichen, drei Kilometer langen Ring zwischen dem Hauptinterferometer und dem Detektor eingefügt. Er leitet das Licht um, bevor es die Arme des Interferometers verlässt. Adhikaris Team erkannte schließlich, dass die KI offenbar theoretische Prinzipien nutzte, die russische Fachleute vor Jahrzehnten entwickelt hatten und das quantenmechanische Rauschen verringern sollten. Bislang hatte niemand diese Ideen experimentell getestet.
»Hätten diese Erkenntnisse schon beim Bau von LIGO zur Verfügung gestanden, wäre die Empfindlichkeit des Geräts von Anfang an um etwa 10 bis 15 Prozent besser gewesen«, sagt Adhikari. In einer Welt der Subprotonen-Präzision macht das enorm viel aus. »Es gehört schon einiges dazu, so weit außerhalb der akzeptierten Lösungen zu denken. Wir brauchten dafür die KI.« Dem stimmt der Quantenoptiker Aephraim Steinberg von der University of Toronto zu: »Über LIGO haben Tausende von Menschen 40 Jahre lang intensiv nachgedacht. Sie haben alles in Erwägung gezogen, was sie hätten tun können. Aber die KI hat etwas gefunden, das sie übersehen haben.«
KI für die quantenmechanische Verschränkung
In der klassischen Physik, die unsere Alltagswelt beschreibt, haben Objekte eindeutig festgelegte Eigenschaften. Eine Billardkugel zum Beispiel hat zu jedem Zeitpunkt eine klar definierte Position und Impuls. In der Quantenwelt ist das nicht der Fall. Ein Quantenobjekt wird durch einen abstrakten mathematischen Quantenzustand beschrieben – möchte man wissen, wo es sich befindet, muss man eine Messung vornehmen. Und für deren Ausgang lassen sich nur Wahrscheinlichkeiten angeben.
Eine weitere Besonderheit der Quantenwelt ist die »Verschränkung«: Zwei (oder mehr) Quantenobjekte können einen einzigen Quantenzustand teilen. Zum Beispiel lassen sich Photonen paarweise erzeugen, die verschränkt sind und sich in verschiedene Richtungen bewegen. Sobald eines der beiden Lichtquanten gemessen wird, beeinflusst das Messergebnis augenblicklich die Eigenschaften des anderen – entfernten – Photons.
Jahrzehntelang gingen Fachleute davon aus, dass Verschränkung nur entstehen kann, wenn sich die Quantenobjekte anfangs am selben Ort befinden. Doch in den frühen 1990er Jahren zeigte Anton Zeilinger, der 2022 den Nobelpreis für Physik für seine Studien zur Verschränkung erhielt, dass dies nicht notwendig ist. Er und seine Kollegen schlugen ein Experiment mit zwei getrennten Paaren verschränkter Photonen vor: Die Lichtquanten A und B sind miteinander verschränkt, ebenso wie die Photonen C und D. Dann führt man je ein Photon der verschränkten Paare, also B und C, durch einen ausgeklügelten Versuchsaufbau aus Kristallen, Strahlteilern und Detektoren. In diesem Aufbau werden die Photonen B und C gemessen und zerstört – aber als Folge davon sind ihre Partnerteilchen A und D, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, verschränkt. Dies wird als Verschränkungsaustausch bezeichnet, ein inzwischen wichtiger Baustein der Quantentechnologie.
Es mag wie Zauberei klingen: Teilchen, die sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden oder über weite Entfernungen miteinander verbunden sind. Bei quantenmechanischen Teilchen ist das jedoch Realität und wird als Nichtlokalität und Verschränkung bezeichnet. Letzteres wurde von Einstein spöttisch als »spukhafte Fernwirkung« bezeichnet, da zu seiner Zeit die genannten Phänomene nicht vereinbar mit der bis dahin gültigen Physik waren. Bei der Verschränkung sind zwei Teilchen, die ehemals als Paar auftraten, auch nach ihrer räumlichen Trennung miteinander verbunden. Messungen an dem eine wirken sich unmittelbar, ohne Zeitverzögerung, auf den Zustand des anderen aus.
Für quantenmechanische Teilchen lassen sich überdies keine exakten Positionen angeben. Stattdessen liefert eine mathematische Formel lediglich die Wahrscheinlichkeit, mit der sich ein Partikel an den verschiedenen Orten im Raum befindet. Die quantenmechanische Wirklichkeit ist also eine Überlagerung vieler Zustände. Solche Phänomene wurden vielfach in Experimenten nachgewiesen, und die Quantenmechanik hat auch die passenden theoretischen Modelle geliefert. Dennoch weiß niemand, inwiefern quantenmechanische Phänomene tatsächlich Teil unserer Realität sind und welche Konsequenzen das hätte: Ist vielleicht alles miteinander verbunden? Gibt es gar parallele Universen, in denen all die quantenmechanisch möglichen Zustände realisiert werden? Unter Physikern führten derartige Spekulationen schon zu viel Streit. Fest steht jedoch: Die Quantenmechanik zeigt uns die Grenzen unseres Verstands auf. Vermutlich hat die Welt eine völlig andere Struktur, als wir auf Grund unserer Alltagserfahrung glauben. Dies wäre eine mögliche Erklärung, wieso uns gewisse Dinge wie Zauberei erscheinen.
Das war der Stand der Dinge im Jahr 2021, als Krenns Team begann, neue Experimente mit der Software PyTheus zu entwerfen – Py steht für die Programmiersprache Python und Theus für Theseus, den griechischen Helden, der den Minotaurus tötete. Dafür stellten die Forschenden ein optisches Experiment durch einen mathematischen Graphen dar, eine Art Netzwerk aus Knoten und Kanten. Diese stehen für verschiedene Aspekte eines Experiments, etwa Strahlteiler, die Wege der Photonen oder, ob zwei Photonen miteinander wechselwirken oder nicht.
Zunächst erstellten die Fachleute einen allgemeinen Graphen, der alle möglichen Experimente einer gewissen Größe enthält. Die Ausgabe des Graphen entspricht einem gewünschten Quantenzustand – zum Beispiel zwei Teilchen, die den Versuchsaufbau verlassen und miteinander verschränkt wurden. Die Forschenden wollten herausfinden, wie sich der Graph verändern lässt, um den gleichen Endzustand zu erzeugen. Dafür entwickelten sie eine mathematische Funktion. Dieser übergibt man den Graphen, und sie berechnet die Differenz zwischen seiner Ausgabe und dem gewünschten Quantenzustand. Anschließend werden die Parameter des Graphen iterativ verändert – also der potenzielle Aufbau eines Experiments – , bis der Unterschied auf null sinkt.
Als der Doktorand Sören Arlt diesen Ansatz nutzte, um den besten experimentellen Aufbau für einen Verschränkungsaustausch zu finden, erhielt er ein überraschendes Ergebnis. Es hatte überhaupt nichts mit Zeilingers ursprünglichem Entwurf zu tun. »Als er mir das zeigte, waren wir verwirrt«, sagt Krenn. »Ich war überzeugt, dass es falsch sein musste.«
Wie sich herausstellte, hatte der Optimierungsalgorithmus Ideen aus einem anderen Forschungsgebiet übernommen, der Multiphotoneninterferenz. Das ermöglicht einen deutlich einfacheren Aufbau als den von Zeilinger. Krenns Team führte daraufhin eine mathematische Analyse des neuen Designs durch, die das unerwartete Ergebnis bestätigte: Die neue Versuchsanordnung könnte tatsächlich zwei Teilchen ohne gemeinsame Vergangenheit miteinander verschränken. Der endgültige Beweis kam dann im Dezember 2024, als ein Forschungsteam um den Physiker Xiao-Song Ma von der Universität Nanjing das Experiment tatsächlich im Labor umsetzte und die Vorhersagen bestätigte.
KI für eine kosmologische Formel
KI-Modelle können Physikerinnen und Physiker nicht nur bei der Planung von Experimenten unterstützen, sondern auch dabei helfen, komplizierte Versuchsergebnisse zu untersuchen. »Im Moment ist es noch so, als würde man einem Kind das Sprechen beibringen«, stellt der Physiker Kyle Cranmer von der University of Wisconsin-Madison fest. Die KI-Modelle stehen für solche Anwendungen noch ganz am Anfang. Dennoch decken die Programme immer wieder Muster in realen oder simulierten Daten auf, die sonst vielleicht untergegangen wären.
So haben Cranmer und sein Team im Jahr 2020 eine KI genutzt, um die Konzentration von Dunkler Materie auf Grundlage benachbarter kosmischer Strukturen vorherzusagen. Solche Berechnungen sind nötig, um das Wachstum von Galaxien und Galaxienhaufen zu verstehen. Das KI-System lieferte eine Formel, die besser zu den kosmologischen Daten passt als die zuvor – von Menschen – entwickelte Gleichung. »Die KI-Formel beschreibt die Daten sehr gut«, so Cranmer. »Aber es fehlt die Erklärung, wie man dorthin kommt.«
KI für verborgene Symmetrien
Eine andere Anwendung für ein KI-Modell hat das Team um die Informatikerin Rose Yu von der University of California in San Diego im Jahr 2023 genutzt: Sie haben den Algorithmus auf ihre Daten losgelassen, um Altbekanntes wiederzufinden.
Sie hatten ihr KI-Programm darauf trainiert, Symmetrien im mathematischen Sinn zu erkennen. Das bedeutet, dass sich die Daten unter einer Transformation nicht – oder vorhersehbar – verändern. Ein Kreis ist zum Beispiel rotationssymmetrisch, da er bei einer Drehung unverändert bleibt. Als Yu und ihr Team ihrer KI die in einem Teilchenbeschleuniger gesammelten Daten übergaben, identifizierte sie sogenannte Lorentzsymmetrien, die für Albert Einsteins Relativitätstheorien entscheidend sind. Dabei handelt es sich um Transformationen, welche die geltenden physikalischen Gesetze unverändert lassen. So sollte beispielsweise die Entstehungsrate von Teilchenpaaren an einem Teilchenbeschleuniger nicht von der Tageszeit abhängen. »Das KI-Modell kann die Lorentzsymmetrie ohne Kenntnis der Physik allein in den Daten entdecken«, erklärt Yu. Damit ließe sich die Technik künftig einsetzen, um bislang unentdeckte Symmetrien des Universums zu offenbaren – und damit vielleicht eine grundlegend neue Physik.
Doch die heutigen KI-Modelle haben ihre Grenzen, betonen Cranmer und Yu. Sie seien zwar sehr gut darin, Muster zu finden, können jedoch bislang keinen Sinn darin erkennen, Hypothesen aufstellen oder physikalische Erklärungen liefern. Cranmer ist jedoch überzeugt, dass große Sprachmodelle wie ChatGPT dies ändern könnten: »Sprachmodelle haben enormes Potenzial, die Entwicklung von Hypothesen zu automatisieren.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.