Exotische Umgebungen: Wie viele Dimensionen hat unser Universum?
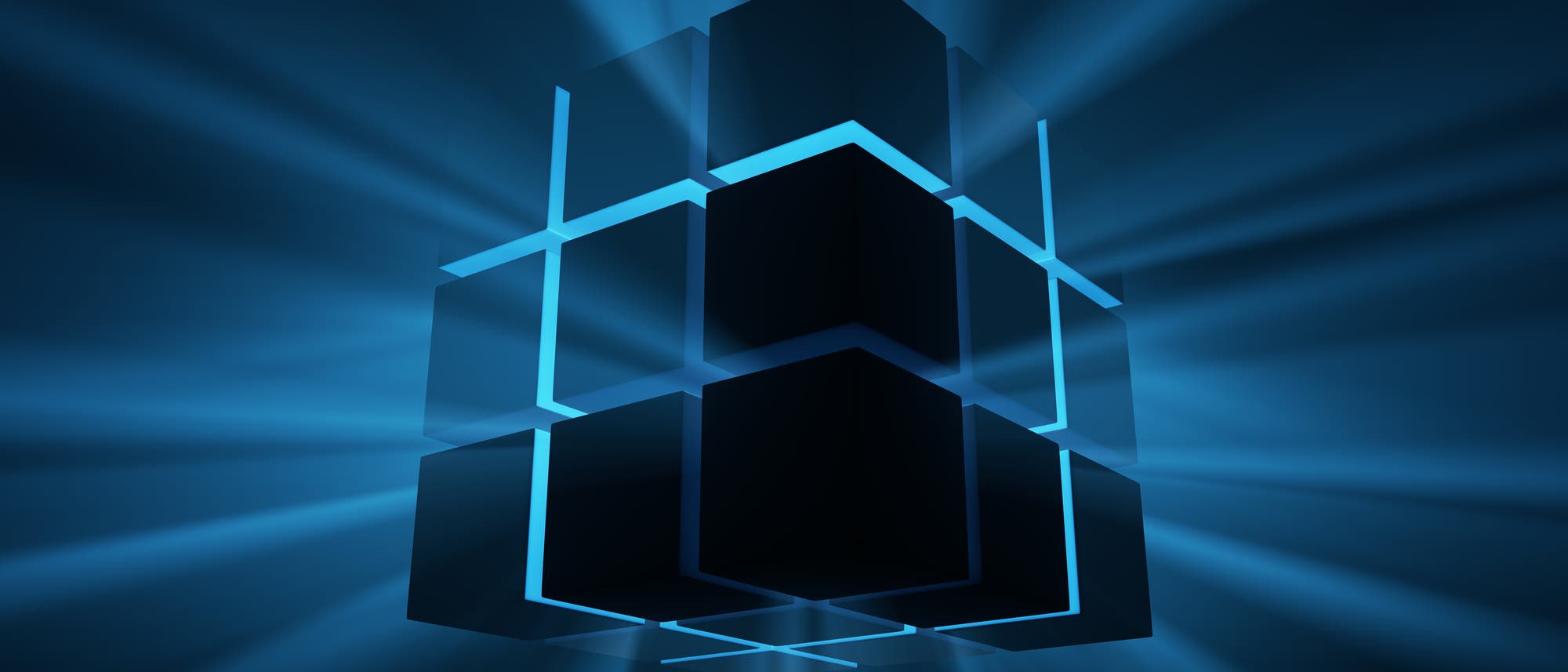
Sie möchten sich mit jemanden verabreden? Nichts einfacher als das: Man braucht bloß einen Termin sowie eine Adresse, die aus einer Straße, Hausnummer und eventuell noch der Etage besteht. Damit hat man eindeutig einen Punkt in der vierdimensionalen Raumzeit festgelegt. Aber können wir uns sicher sein, dass das Universum genau drei Raum- und eine Zeitdimension besitzt? Tatsächlich lässt die Wissenschaft auch andere Schlüsse zu.
Die ersten Fachleute, die sich ernsthaft mit hochdimensionalen Gebilden beschäftigten, waren Mathematikerinnen und Mathematiker – die abstrakte Natur solcher Studien schreckte sie nicht ab. Mitte des 18. Jahrhunderts tauchte erstmals die Idee einer vierten Dimension in den Schriften von Jean Le Rond d'Alembert und Joseph-Louis Lagrange auf, die diese als Zeit auffassten. Etwa 100 Jahre später trieb Bernhard Riemann die Überlegungen auf die Spitze, als er die mehrdimensionale Geometrie entwickelte, die sich Räumen mit einer beliebigen Anzahl an Dimensionen widmet.
Doch erst der englische Mathematiker und Philosoph Charles Howard Hinton machte solche Ideen einer breiten Öffentlichkeit durch seinen Aufsatz »What is the Fourth Dimension?« (1880) zugänglich. Darin erklärt er unter anderem, wie sich ein vierdimensionaler Hyperwürfel konstruieren lässt, den er »Tesserakt« nannte. Dazu verallgemeinerte er die Entstehung eines Quadrats durch zusammengeführte Linien und eines Würfels durch aneinandergestellte Quadrate. Hinton prägte zudem die Worte »kata« und »ana«, um die beiden entgegengesetzten Richtungen einer vierten räumlichen Dimension zu bezeichnen, analog zu oben-unten, rechts-links und vorne-hinten.
Von da an war der Damm gebrochen: Kurz darauf erschienen zahlreiche Werke von Sciencefiction- und Fantasy-Autoren, welche die verrücktesten Welten ersannen. Eines der bekanntesten Romane dieser Kategorie ist das 1884 veröffentlichte »Flatland« von Edwin Abbott, der die Lebensweise von Bewohnern eines zweidimensionalen Lands beschrieb. Er schilderte die Abenteuer einer Figur namens A. Square inmitten einer hierarchischen Gesellschaft: Linien, Dreiecke, Quadrate, Fünfecke, andere Vielecke – je mehr Ecken die Bürger haben, desto höher sind sie angesiedelt. Irgendwann begegnet der Protagonist einem Wesen, das er noch nie zuvor gesehen hat: ein perfekter Kreis, dessen Größe aber variiert! Tatsächlich entspringt der Unbekannte einem dreidimensionalen Raum und ist eine Kugel. Während diese das ebene Flatland durchquert, nimmt A. Square sie als Kreis wahr.
Ende des 19. Jahrhunderts griff der deutsche Astrophysiker Johann Karl Friedrich Zöllner, der für seine Arbeiten zur Fotometrie bekannt ist, diese Idee auf, um paranormale Phänomene zu erklären: Demnach handle es sich um kurzzeitige Überschneidungen unserer Welt mit geisterhaften Wesen, die in vier Raumdimensionen lebten. Daher wirke es, als würden sie aus dem Nichts entstehen und dann wieder verschwinden. Seine Kollegen konnte Zöllner mit seiner Theorie aber nicht überzeugen.
Dennoch erörterte der Mathematiker Rudy Rucker in »The Fourth Dimension: Toward a Geometry of Higher Reality« (1984) auf humorvolle Weise, welche Fähigkeiten vierdimensionale Wesen in unserer Welt besäßen. Sie könnten etwa aus einem Gefängnis ausbrechen oder einen Safe leeren, ohne die Türen zu öffnen. In vielen Fantasy-Geschichten sind die Extradimensionen von schrecklichen Monstern bevölkert, die solche Vorteile nutzen, um in unsere Welt einzudringen und sie heimzusuchen. Beispiele dafür finden sich in den Werken von Howard P. Lovecraft oder in der beliebten US-amerikanischen Serie »Stranger Things«.
Eine Frage, die Forscherinnen und Forscher allerdings nicht loslässt, ist, ob eine Welt mit mehr oder weniger als drei Raumdimensionen überhaupt möglich ist. Wie sähen die Naturgesetze in solchen Universen aus? Alexander Dewdney nahm sich dieser Herausforderung für einen Kosmos mit bloß zwei räumlichen Dimensionen an. In den späten 1970er Jahren veröffentlichte der kanadische Informatiker mehrere Artikel, in denen er die Grundlagen des so genannten Planiversums legte, die er in seinem gleichnamigen, 1984 erschienenen Buch ausführlich beschreibt.
Das Werk ist eine echte Meisterleistung. Dewdney stellt darin die physikalischen, chemischen (einschließlich eines Periodensystems mit 16 Elementen) und biologischen Gesetzmäßigkeiten der flachen Welt dar. Es enthält auch Pläne und Funktionsprinzipien zweidimensionaler Maschinen, von Schleusen bis hin zu Dampfmaschinen. Der Informatiker ging sogar auf ein Problem ein, das der britische Kosmologe Gerald Whitrow (1912–2000) erkannte: Weil sich aus geometrischen Gründen nur eine sehr kleine Anzahl von Neuronen verbinden lassen, wäre die Entwicklung von Intelligenz in einem solchen Universum ausgeschlossen.
»In drei oder mehr Dimensionen kann man beliebig viele Nervenzellen paarweise verbinden, ohne dass sich ihre Verbindungen kreuzen, während das in zwei Dimensionen nur für bis zu vier Zellen möglich ist«, so Whitrow. Dewdney fand einen Ausweg, indem er einen zweidimensionalen Apparat vorschlug, mit dem sich Nervenimpulse ohne Störungen kreuzen lassen. Damit wäre ein Gehirn im Planiversum ähnlich komplex aufgebaut wie unseres, wegen der vielen Unterbrechungen der Nervenimpulse würde es aber langsamer arbeiten.
Tatsächlich spielen zweidimensionale Systeme inzwischen in fast allen naturwissenschaftlichen Disziplinen eine wichtige Rolle. In der Biologie fertigt man zum Beispiel ebene Schnitte der Untersuchungsobjekte an, um sie unter dem Mikroskop zu durchleuchten. In der Chemie entwickelte Irving Langmuir 1918 hingegen die Theorie von Adsorption an einer Oberfläche, als er sich zweidimensionalen Phänomenen widmete.
Den größten Einfluss haben ebene Systeme momentan aber wohl in der Physik. Den Startschuss für die Forschungsrichtung gab Klaus von Klitzing bereits 1980, als er den Quanten-Hall-Effekt entdeckte: Bei niedriger Temperatur und unter Einwirkung eines starken äußeren Magnetfelds verändert sich die Leitfähigkeit bestimmter Stoffe nur noch sprungartig. Um dieses unerwartete Phänomen zu erklären, muss man das Verhalten von Elektronen in einer Ebene beschreiben. Damit offenbarte sich schon, dass zwei- und dreidimensionale Physik grundverschieden sind.
Die besonderen Eigenschaften von Graphen hängen alle mit dessen Zweidimensionalität zusammen
2004 gelang es Andre Geim und Konstantin Novoselov schließlich, erstmals ein stabiles zweidimensionales Material zu erzeugen, wofür sie 2010 den Nobelpreis für Physik erhielten. Das so genannte Graphen, das bereits 1947 vorhergesagt wurde, besteht aus einer einatomigen Lage Graphit. Die außergewöhnlichen mechanischen, thermischen und elektronischen Eigenschaften des Stoffs sind mit seiner Zweidimensionalität verbunden. Die Entdeckung löste einen regelrechten Hype in den Materialwissenschaften aus – inzwischen gibt es zahlreiche einlagige Materialien, die sich vielseitig einsetzen lassen.
Warum genau drei Dimensionen?
Es gab schon viele Versuche, die Dreidimensionalität unserer Welt zu erklären. Die erste Diskussion geht auf die Pythagoräer zurück, deren Überlegungen Aristoteles in seiner Abhandlung »Über den Himmel« aufgriff. Darin schrieb er: »Das ›All‹ und das ›Alles‹ werden durch Dreizahl definiert: Ende, Mitte und Anfang bilden die Zahl des Alls, nämlich die der Triade.« In seinem 1632 veröffentlichten »Dialog über die zwei Weltsysteme« erklärte Galileo Galilei, es könne nicht mehr als drei Dimensionen geben, weil höchstens drei senkrechte Linien durch einen Punkt verlaufen können.
Eine zehndimensionale Welt
Eine der größten Herausforderungen der Physik ist es, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik zu vereinen. Albert Einsteins Theorie beschreibt, wie Energie und Materie das vierdimensionale Gefüge der Raumzeit verzerren. Umgekehrt ergibt sich daraus, wie die entsprechende Krümmung die Bewegung der Materie bestimmt. Mit anderen Worten: Schwerkraft entsteht durch die Geometrie der Raumzeit. Etwa zur gleichen Zeit entdeckte man die eigentümlichen Gesetze, welche die mikroskopische Welt bestimmen. Die Quantenphysik beschreibt erfolgreich die Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen untereinander.
Einige Situationen, wie die Momente kurz nach dem Urknall oder das Innere eines Schwarzen Lochs, erfordern jedoch eine quantenphysikalische Formulierung der Gravitation. Erste Versuche scheiterten: Die entstehenden Gleichungen führen zu unendlichen Größen, die sich nicht beseitigen lassen.
In den späten 1960er Jahren stießen Forscher auf eine viel versprechende Methode, um die beiden Theorien miteinander zu vereinbaren. Indem man Punktteilchen durch winzige schwingende Schnüre ersetzt, lassen sich die zuvor aufgetretenen Unendlichkeiten vermeiden. Der zu Grunde liegende mathematische Formalismus ist äußerst komplex. Man erkannte schnell, dass die Stringtheorie nur in einer 26-dimensionalen Raumzeit funktioniert!
Doch diese erste Version der Theorie hatte weitere Probleme, sie konnte beispielsweise Teilchen mit einem halbzahligen Spin, wie Elektronen oder Quarks, nicht beschreiben. 1971 erweiterten Pierre Ramond, André Neveu und John Schwarz den Ansatz daher um eine so genannte Supersymmetrie, die Partikel mit ganzzahligem (wie Photonen) und solche mit halbzahligem Spin verbindet. Diese Superstringtheorie erfordert nur noch eine zehndimensionale Raumzeit.
Um von einer solchen Theorie zu unserem vierdimensionalen Universum zu gelangen, muss man die überschüssigen Dimensionen kompaktifizieren: An jedem Punkt im Raum rollt man sie winzig klein auf. Da sie keine Ausdehnung haben, können wir sie nicht direkt wahrnehmen. Diese sechs aufgerollten Dimensionen bilden ein mathematisches Objekt, einen Calabi-Yau-Raum. Alle Varianten eines solchen Gebildes führt zu einem Modell einer Welt mit eigenen Eigenschaften. Allerdings gibt es schätzungsweise etwa 10500 mögliche Calabi-Yau-Räume – es könnten sogar viel mehr sein. Woher weiß man, welche Konfiguration dem realen Universum entspricht? Im Moment haben die Physiker keine Antwort darauf.
Auch Immanuel Kant beschäftigte sich mit dem Thema. Er versuchte vergeblich nachzuweisen, dass die Dreidimensionalität des Raums aus Isaac Newtons Gravitationsgesetz folgt, wonach sich Körper umgekehrt proportional zum Quadrat ihrer Entfernung anziehen. Er war der Erste, der – anstatt das Problem aus metaphysischer oder geometrischer Sicht zu betrachten – einen physikalischen Ansatz wählte. Tatsächlich lässt sich Kants Vermutung nicht nur beweisen, sondern verallgemeinern: In einem n-dimensionalen Raum nimmt die Schwerkraft mit 1/rn – 1 mit der Distanz r ab. Das newtonsche Gravitationsgesetz ist also eine direkte Folge der drei Raumdimensionen; in einer vierdimensionalen Welt würde die Anziehung mit eins über r3 abnehmen.
1917 berechnete der österreichische Physiker Paul Ehrenfest die Bewegung von Sternen in einem n-dimensionalen Raum. Wie er zeigte, gibt es nur in zwei oder drei Dimensionen stabile und begrenzte Lösungen. Wenn zudem die Anziehung zweier Körper bei großem Abstand gegen null gehen soll, bleiben nur drei Raumdimensionen als Möglichkeit übrig. Bloß so können Planeten mehrere hundert Millionen Jahre lang eine feste Umlaufbahn haben – eine notwendige Voraussetzung, damit Leben entsteht.
Die Dimensionalität wirkt sich aber auch auf den Mikrokosmos aus. Da wir von stabilen Teilchen umgeben sind, muss die Grundenergie eines Atoms endlich sein: Elektronen stürzen weder in den Kern noch können sie sich lösen. Wendet man das bohrsche Atommodell auf ein Wasserstoffatom an, das sich in einem Raum mit mehr als fünf Dimensionen befindet, nimmt der Radius der Elektronenbahn mit zunehmender Energie ab, das Teilchen stürzt in den Kern. Stabile Atome können nur existieren, wenn der Raum höchstens dreidimensional ist.
In fünf Dimensionen gibt es keine stabilen Atome
Und auch der Elektromagnetismus liefert ein Argument für die Dimensionalität unserer Welt. In weniger Dimensionen kann sich die Strahlung mit beliebiger Geschwindigkeit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Dadurch könnte man Signale, die zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt werden, gleichzeitig empfangen, was einen Nachhall verursacht. Dieser Effekt lässt sich auf alle Räume mit einer geraden Anzahl an Dimensionen verallgemeinern. Nur eine zusätzliche ungerade Dimension garantiert eine verzerrungsfreie Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung über große Entfernungen.
Willkommen im Hyperwürfel
Trotz der vorgebrachten Argumente könnte unser Raum aus mehr als drei Dimensionen bestehen. 1999 versuchten Lisa Randall und Raman Sundrum die Schwäche der Schwerkraft im Vergleich zu den anderen Grundkräften erklären: Auf mikroskopischer Skala ist die gravitative Anziehung zwischen dem Proton und dem Elektron eines Wasserstoffatoms etwa 1039-mal schwächer als die elektrische Kraft, die sie bindet. Wäre unser Universum in einen höherdimensionalen Raum eingebettet und alle Wechselwirkungen außer der Gravitation auf drei Dimensionen beschränkt, würde die Schwerkraft in die übrigen Dimensionen »durchsickern«. Das würde ihre scheinbare Schwäche erklären.
Um die Gravitation mit der Quantenphysik zu vereinen, müssen Physikerinnen und Physiker sogar auf ein Universum zurückgreifen, das nicht nur eine, sondern gleich sechs zusätzliche Raumdimensionen besitzt. Überschüssige Dimensionen spielen auch im 2014 erschienenen Film »Interstellar« eine wichtige Rolle. Gegen Ende der Geschichte taucht ein Astronaut in ein Schwarzes Loch ein. Er findet sich daraufhin in einer seltsamen Raumzeit mit fünf Dimensionen wieder, dem so genannten Tesserakt.
Wegen seiner faszinierenden Eigenschaften taucht der Tesserakt in vielen anderen Werken auf. Bereits 1941 beschrieb Robert Heinlein in seiner Kurzgeschichte »4-D-Haus« ein Gebäude, das die Form des dreidimensionalen Netzes eines Hyperwürfels besitzt. Ebenjenes Netz verwendete Salvador Dalí 1954 in seinem Gemälde »Crucifixion (Corpus Hypercubus)«, womit er andeutete, Gott könnte in einer für den menschlichen Verstand unzugänglichen vierten Dimension existieren. Gleichen wir tatsächlich den armen Kreaturen in Platons Höhle, die sich der zusätzlichen Dimensionen, die uns umgeben, gar nicht bewusst sind?
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.