Warkus' Welt: Das gefährliche Comeback des Biologismus
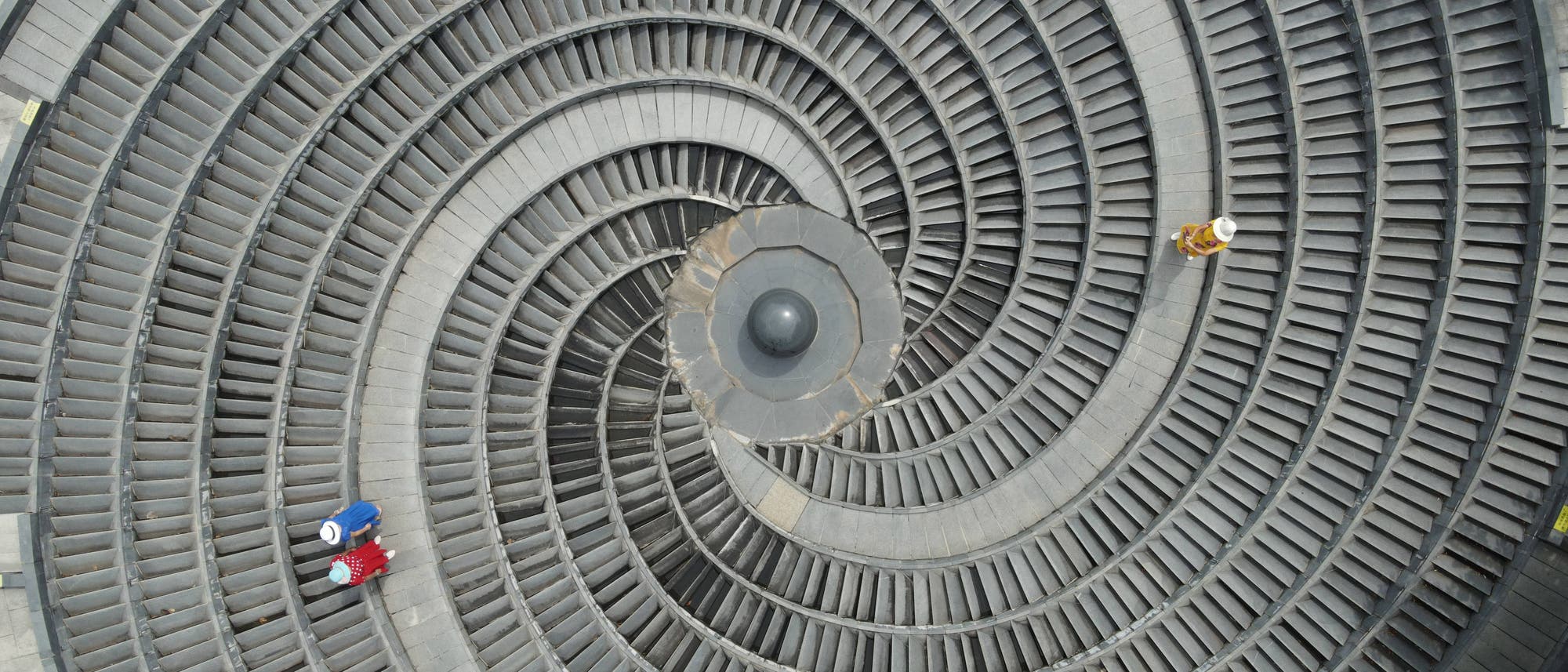
Die berühmte Seerose, die ihre Fläche jeden Tag verdoppelt, ist Ihnen wahrscheinlich schon begegnet. Sie braucht 30 Tage, um den ganzen Teich zu überwuchern, wird aber erst als Problem erkannt, wenn sie ihn bereits halb bedeckt – und nur noch ein Tag bleibt, um ihr Herr zu werden. Das Gedankenexperiment soll verdeutlichen, dass wir uns damit schwertun, exponentielles Wachstum zu verstehen, also ein Wachstum, dessen Rate pro Zeiteinheit in konstantem Verhältnis zur Bestandsgröße steht und damit selbst stets wächst. Die Schwierigkeit, sich exponentielle Entwicklungen vor Augen zu führen, war in den Krisenphasen der Covid-19-Pandemie immer wieder ein Thema in den Medien.
Sobald die Seerose ihren Teich komplett bedeckt, kann sie nicht mehr weiterwachsen. Ein beliebtes mikrobiologisches Analogon dazu ist die Bakterienkolonie, die sich exponentiell vermehrt, bis ihr Nährboden bedeckt ist – und dann mangels Nahrung abstirbt. Da mit zunehmender Zahl von Bakterien im Verhältnis zur noch vorhandenen Nahrung das Wachstum jedoch gebremst wird, ergibt sich hier eine S-Kurve oder logistische Funktion, kein rein exponentielles Wachstum. Aber irgendwann ist eben keine Nahrung mehr da, und dann gibt es sehr bald auch keine Bakterien mehr.
Bakterien betreiben keine Landwirtschaft
Wie ist das nun mit höheren Tieren – und ist der Mensch nicht eines davon? Wir Menschen sind nicht in eine Petrischale mit einer fixen Menge Nahrung eingesperrt, sondern bewohnen ein Ökosystem, dem ständig von außen enorme Energiemengen zugeführt werden und das wir zu einem nennenswerten Teil selbst gestalten, indem wir zum Beispiel Landwirtschaft betreiben. Dabei kommen uns technische Fortschritte zugute, so dass wir die Nahrungsmittelproduktion über die Zeit steigern können. Die Frage ist also nicht, wann wir ein konstantes Nahrungsangebot ausgeschöpft haben, sondern, wie sich das Bevölkerungswachstum zur Zunahme der Agrarproduktion verhält.
Der englische Geistliche und Nationalökonom Thomas Malthus (1766–1834) stellte hierzu 1798 eine enorm einflussreiche, obgleich düstere Prognose auf: Nach seiner Einschätzung neigen menschliche Bevölkerungen tatsächlich zur exponentiellen Vermehrung, die Nahrungsmittelproduktion sei jedoch nur linear zu steigern. Damit muss, wenn die Fortpflanzung nicht irgendwie reguliert wird, eine Form von »Korrektur« eintreten – durch Hunger, Seuche, Krieg, was auch immer.
Der demografische Übergang dominiert heute
Auch wenn die Furcht der 1960er Jahre vor der »Bevölkerungsexplosion« bis heute latent wirkt, hat die Realität Malthus’ Theorie längst widerlegt. Die Weltbevölkerung wächst schon seit zirka 60 Jahren nicht mehr exponentiell. Das Wachstum wird durch den so genannten demografischen Übergang von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten wesentlich stärker bestimmt, als irgendwelche Hungerkatastrophen es bremsen oder deckeln.
Malthus' Theorie ist ein hervorragendes und vielleicht das historisch früheste wichtige Beispiel für ein biologistisches Denken, das versucht, durch biologische Modelle zu begreifen, was Menschen tun – individuell, in Gruppen und als Gesellschaften. Biologismus ist in verschiedenen Formen allgegenwärtig. Letztlich ist es schon biologistisch, wenn etwa bei Teenagern launig von »Balzverhalten« gesprochen wird oder von »Fellpflege« wie in Judith Schalanskys Roman »Der Hals der Giraffe« von 2011, der bis in den Titel hinein davon lebt, das biologistische Denken einer Lehrerin zu zeichnen.
Charles Darwin (1809–1882) wurde maßgeblich durch Malthus beeinflusst. Damit schimmert auch die Bedrohung durch, die durch einen biologischen Blick auf Menschen entsteht. Geht man davon aus, dass biologische Gesetzmäßigkeiten sich am Ende immer gegen das (individuelle oder kollektive) menschliche Wollen durchsetzen, dann muss diesen unbarmherzigen Realitäten Priorität in der Politik eingeräumt werden. Malthus argumentierte für eine weitgehende Entvölkerung Irlands, das zu seiner Zeit noch vollständig britisch beherrscht und bei hohen Geburtenraten sehr arm war. Aus dem 20. Jahrhundert kennen wir die schrecklichsten Beispiele für das Unheil, das sozialdarwinistische, mehr oder minder rassistische Vorstellungen über die Konkurrenz verschiedener »Menschenpopulationen« ausgelöst haben.
Biologismus an allen Ecken und Enden
Leider ist das alles längst nicht vom Tisch. Aktuell finden wir an allen Ecken und Enden Biologismus: Der kanadische Psychologe Jordan Peterson, einflussreicher Vordenker der rechten Kultur in den sozialen Netzwerken unterstellt zum Beispiel, dass unvermeidliche »Dominanzhierarchien«, wie er sie schon bei Wirbellosen, beispielsweise bei Hummern, sieht, sich auch durch das menschliche Leben ziehen. Trump-Berater Elon Musk und US-Vizepräsident J. D. Vance sind Unterstützer einer »pronatalistischen« Bewegung, die in sinkenden Geburtenraten die Zivilisation bedroht sieht und die gesteigerte Fortpflanzung insbesondere hochqualifizierter und weißer Amerikaner propagiert.
Malthus' Theorie hat die Politik im britischen Weltreich stark beeinflusst. Einer – allerdings umstrittenen – Auffassung zufolge gehen Millionen Opfer vor allem in Indien zumindest indirekt auf Malthus zurück, weil die Kolonialverwaltung Hungersnöte Malthus folgend als unvermeidliche Korrekturen betrachtete. Das ist für mich die wichtigste Lehre: Das Leid, das Menschen mit fragwürdigen biologistischen Handlungsrechtfertigungen einander antun können, ist unermesslich greifbarer als das hypothetische biologisch zwangsläufige Leid, mit dem solche Theorien operieren.
Schreiben Sie uns!
2 Beiträge anzeigen