Astrobiologie: Leben auf anderen Welten
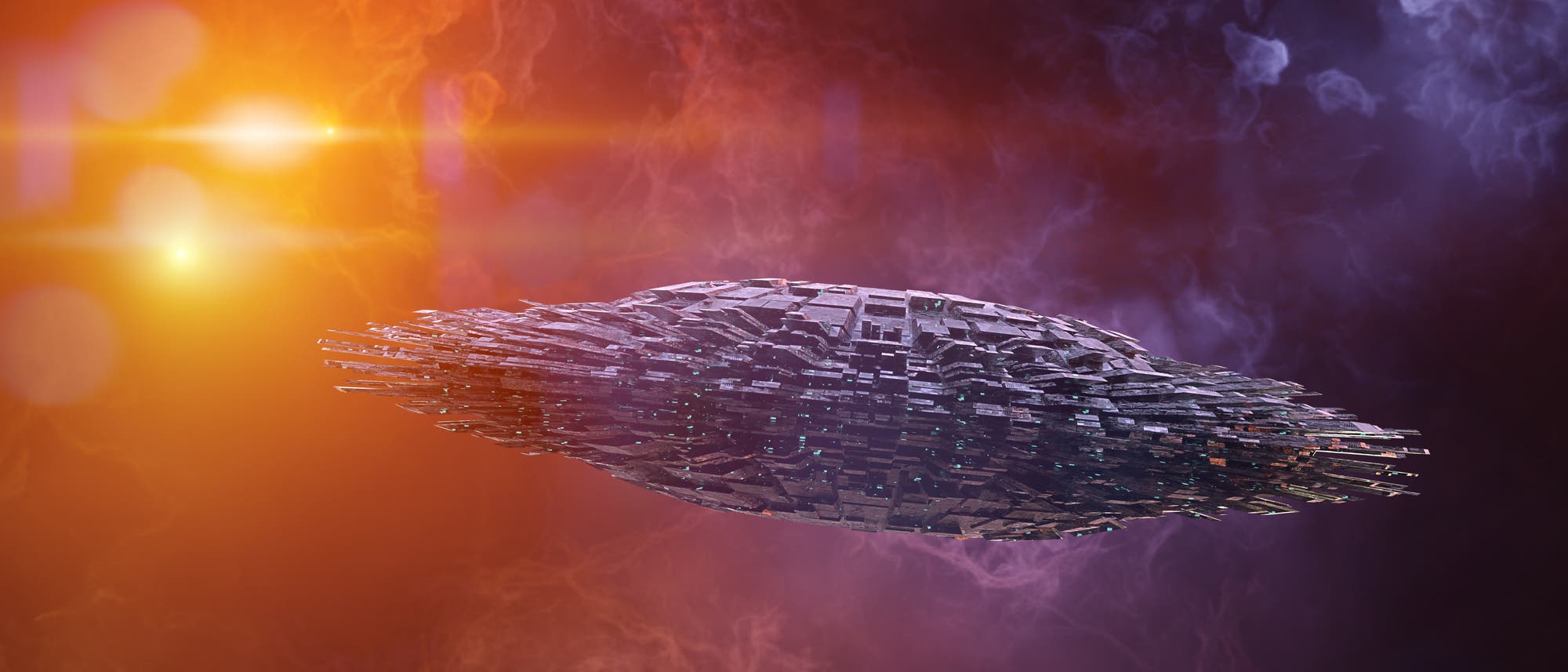
Sarah Stewart Johnson war im zweiten Jahr ihres Studiums, als sie zum ersten Mal den Vulkan Mauna Kea in Hawaii erklomm. Dessen Oberfläche aus erstarrter Lava unterschied sich frappierend von den baumbewachsenen Hügeln ihres Heimatstaats Kentucky. Johnson entfernte sich von der Gruppe junger Wissenschaftler, mit der sie unterwegs war, und ging auf einen Kamm unweit des 4205 Meter hohen Gipfels zu. Als sie nach unten blickte, drehte sie mit der Spitze ihres Stiefels einen Stein um. Zu ihrer Überraschung gedieh darunter ein winziger Farn, der aus der Asche und Schlacke spross.
Schlagartig wurde Johnson bewusst: Selbst eine Umgebung, die aus menschlicher Sicht äußerst fremd und widrig erscheint, kann Lebewesen eine Heimat bieten. Unweigerlich fragte sie sich, was das für die Vielfalt der extraterrestrischen Organismen bedeutet, die möglicherweise jenseits der Erdatmosphäre existieren. In jenem Moment begann der Wunsch in ihr zu keimen, nach außerirdischem Leben zu fahnden.
Johnson machte diese Leidenschaft später zu ihrem Beruf. Als Astronomie-Postdoc an der Harvard University untersuchte sie in den frühen 2010er Jahren, wie das Analysieren von Nukleinsäuren – beispielsweise DNA und RNA – dabei helfen könnte, Aliens aufzuspüren. Sie fand die Arbeit faszinierend, fragte sich zugleich aber: Was wäre, wenn Außerirdische weder DNA, RNA noch sonstige Nukleinsäuren besäßen? Was wäre, wenn extraterrestrische Organismen ihre Erbinformation über völlig andere Moleküle an die Nachkommen weitergeben?
Die Forscherin begann, ihre Gedanken dazu aufzuschreiben – zunächst in lyrischer und philosophischer Form, was in das populärwissenschaftliche Buch »The Sirens of Mars« (erschienen 2020) mündete. Darin geht Johnson der These nach, dass andere belebte Planeten sich fundamental von der Erde unterscheiden könnten und somit auch deren jeweilige Bewohner und ihre (Bio-)Chemie. Diesen Überlegungen zufolge könnten unsere derzeitigen Verfahren, nach Außerirdischen zu suchen, zum Scheitern verurteilt sein. »Wir ähneln dem Mann, der nachts seinen Schlüssel verliert und als Erstes unter der Straßenlaterne nachsieht, weil es da eben hell ist«, sagt Johnson, die heute als außerordentliche Professorin an der Georgetown University arbeitet. Soll heißen: Wenn wir nach extraterrestrischem Leben ausschauen, nehmen wir Orte unter die Lupe, von denen wir aus eigener Erfahrung wissen, dass es dort Leben geben kann. Nämlich solche, die der Erde ähneln.
Suche nach anderer Biochemie
Ein Großteil der heutigen astrobiologischen Forschungsarbeiten konzentriert sich auf chemische »Biosignaturen«, Moleküle oder Stoffkombinationen, die auf das Vorhandensein von Leben hindeuten. Da niemand weiß, ob außerirdische und irdische Organismen eine vergleichbare Chemie aufweisen, könnte die Suche nach Biosignaturen dazu führen, dass wir Lebewesen übersehen, die uns quasi direkt vor der Nase sitzen. Johnson und viele weitere Forscherinnen und Forscher plädieren deshalb dafür, flexiblere Methoden anzuwenden, mit denen sich auch Lebensformen mit anderer Biochemie aufspüren lassen.
Johnson bekommt jetzt die Chance dazu, und zwar als Leiterin einer neuen, von der NASA finanzierten Initiative namens Laboratory for Agnostic Biosignatures (Labor für agnostische Biosignaturen, LAB). Die daran beteiligten Fachleute setzen bei Außerirdischen keine bestimmte Chemie voraus und fahnden daher nicht nach spezifischen Signaturen. Stattdessen versuchen sie, allgemeinere und grundlegendere Marker für Leben heranzuziehen. Dazu gehören Hinweise auf Komplexität – etwa in Form von Stoffkombinationen, bei denen ein nicht biologischer Entstehungsmechanismus unwahrscheinlich ist. Ungleichgewichtszustände wie überraschend hohe Konzentrationen instabiler Substanzen können ebenfalls auf Leben hindeuten, selbst wenn es sich chemisch völlig anders zusammensetzt als das irdische.
Die Suche nach Außerirdischen fällt schon deshalb schwer, weil sich die Wissenschaftler nicht einig sind, was Leben überhaupt ist. Eine recht brauchbare Definition schlug 2011 der Genetiker Edward Trifonov vor, nachdem er mehr als 100 Begriffserklärungen zusammengetragen und daraus ein übergeordnetes Konzept abgeleitet hatte. Leben ist demnach »Selbstreproduktion mit Variationen«. Die NASA hatte schon Mitte der 1990er Jahre eine ähnliche Begriffsbestimmung erarbeitet, auf die sie noch heute zurückgreift. Ihr zufolge handelt es sich bei Leben um ein »sich selbst erhaltendes chemisches System, das zur darwinschen Evolution befähigt ist«. Keine dieser Definitionen erfordert eine bestimmte chemische Beschaffenheit.
Auf der Erde nutzen etliche Lebewesen als Träger der Erbinformation die DNA. Sie besteht aus zwei spiralförmig verdrillten Molekülsträngen, die abwechselnd Zucker- und Phosphatreste enthalten. An jeden Zucker ist eine Base geknüpft, bei der es sich entweder um Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) oder Thymin (T) handelt. Jeweils ein Basen-, Zucker- und Phosphatanteil zusammen bilden ein Nukleotid, einen DNA-Baustein. Die DNA gehört zu den so genannten Nukleinsäuren, zu denen auch die RNA zählt. Letztere ähnelt der DNA chemisch, unterscheidet sich von ihr aber unter anderem darin, dass sie die Base Uracil statt Thymin enthält. RNA kann ebenfalls Erbinformation tragen, dient in komplexeren Lebewesen aber dazu, die auf der DNA gespeicherten Informationen an die zelluläre Proteinproduktion zu übermitteln.
In der Abfolge der aneinandergereihten DNA-Nukleotide steckt die Bauanleitung, die erforderlich ist, um einen Organismus zu erzeugen. DNA kann sich vervielfältigen, und sie kann sich mit der aus einem anderen Organismus vermischen und so die Grundlage für eine neue Lebensform liefern, die sich dann ihrerseits repliziert. Würden Aliens auf anderen Planeten den gleichen biochemischen Apparat nutzen, wären sie uns molekular wohl recht ähnlich.
Man geht davon aus, dass jegliches Leben einen Mechanismus benötigt, um seinen eigenen Bauplan an die Nachkommen weiterzugeben. Veränderungen der Bauanleitung – ob zufällig oder gerichtet – können dann dazu beitragen, dass sich die entsprechenden Organismen im Lauf der Zeit weiterentwickeln. Möglicherweise transportieren Außerirdische diese Informationen auf anderen biochemischen Trägermolekülen als wir – etwa auf kugelförmigen Nukleinsäuren, wie sie ein Forschungsteam der Northwestern University (Illinois, USA) bereits in den 1990er Jahren hergestellt hat. Denkbar erscheint ebenso, dass extraterrestrisches Leben einen genetischen Code mit anderen Basen nutzt. Im Rahmen von NASA-geförderten Forschungsarbeiten haben Fachleute im Jahr 2019 eine synthetische DNA geschaffen, die neben den vier herkömmlichen Basen noch vier weitere enthält: P, Z, B und S.
Andere Forscher haben das molekulare Rückgrat der DNA verändert und dabei so genannte XNAs erzeugt, die statt der typischen Zuckerreste von DNAs Verbindungen wie Cyclohexen oder Glykol besitzen. Vielleicht gründen außerirdische Organismen aber ihre Chemie nicht einmal auf Kohlenstoff wie wir, sondern beispielsweise auf das funktionell ähnliche Silizium – was bedeuten würde, dass sie überhaupt keine Nukleinsäuren besäßen. Und das sind nur einige der Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Niemand weiß, was es da draußen alles gibt.
Leroy Cronin von der University of Glasgow, der in der LAB-Initiative mitarbeitet, ist sogar der Ansicht, wir sollten den Begriff Biologie ganz vermeiden, wenn wir von Außerirdischen sprechen. Er meint, Biologie beruhe auf RNA, DNA, Proteinen und spezifischen Aminosäuren, und das seien Merkmale der irdischen Biosphäre. Laut Cronin wäre es richtiger, zu sagen: »Wir suchen nach Astroleben.«
Stuart Bartlett vom California Institute of Technology stimmt dem zu. Die Suche nach extraterrestrischen Organismen sei nicht zwangsläufig eine nach »Leben« gemäß unserem Verständnis. Es sei vielmehr eine Suche nach »lyfe« – eine Wortschöpfung, die an »life« (Leben) angelehnt ist und sich zugleich davon abgrenzt. »Lyfe«, so heißt es in einem einschlägigen Fachartikel, sei definiert als jeder Zustand, der alle vier folgenden Kriterien erfüllt: Energieumsatz, etwa in Form von Nahrungsaufnahme und Verdauung; sich selbst erhaltende chemische Reaktionen mit dem Ergebnis einer exponentiellen Vervielfältigung; das Aufrechterhalten eines inneren Milieus, während sich die äußeren Bedingungen ändern; und das Aufnehmen von Informationen aus der Umwelt, gefolgt von spezifischen Reaktionen darauf. »Leben«, steht in dem Fachbeitrag weiterhin geschrieben, »ist definiert als jene Lyfe-Variante, die wir von der Erde her kennen.«
Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang, wie das Leben auf unserem Heimatplaneten einst entstand, wie also die biologischen Organismen aus einer unbelebten Umgebung hervorgegangen sind – ein Prozess namens Abiogenese. Es gibt zahlreiche Hypothesen dazu, die sich in zwei Hauptkonzepte untergliedern. Das eine besagt, am Anfang hätten katalytische RNA-Moleküle gestanden, die sowohl sich selbst (und die auf ihnen gespeicherte Information) vervielfältigten als auch andere chemische Reaktionen beschleunigten. Aus dieser RNA seien nach und nach Lebewesen hervorgegangen, deren Bauplan im genetischen Code verschlüsselt war. Das andere Konzept geht von einem Stoffwechsel-zuerst-Szenario aus, in dem selbsterhaltende chemische Reaktionen sich in zunehmend komplexen Netzwerken organisierten und schließlich den genetischen Code hervorbrachten.
Diese beiden Ansätze müssen sich nicht ausschließen. Information und Stoffwechsel als Bestandteile des Lebens können ebenso in wechselseitiger Abhängigkeit entstanden sein. John Sutherland, Chemiker am Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology (Cambridge, England), forscht über die Ursprünge des irdischen Lebens. Er gehört zu den Wissenschaftlern, die daran arbeiten, Information-zuerst- und Stoffwechsel-zuerst-Konzepte zusammenzuführen und somit die frühere Trennung zwischen den beiden zu überwinden.
Sutherland betont: Solange wir nicht mehr darüber wüssten, was auf der frühen Erde geschehen sei, hätten wir keine Möglichkeit abzuschätzen, wie oft außerirdisches Leben im Weltall vorkomme. Dass es Billionen von Sternen und Planeten in Abermilliarden von Galaxien gebe, sei nicht zwangsläufig von Belang: Wenn die Ereignisse, die zu Leben führen, äußerst unwahrscheinlich und selten sind, könnten die vielen Himmelskörper statistisch gesehen trotzdem zu wenige sein, um mehrmals Abiogenese zu ermöglichen.
Im Jahr 2001 erschien in der Erstausgabe der Fachzeitschrift »Astrobiology« ein Artikel des Geowissenschaftlers Kenneth Nealson und der Astrobiologin Pamela Conrad mit dem Titel »A Non-Earth-Centric Approach to Life Detection«. Der Beitrag behandelt die Frage, wie sich Leben definieren und erkennen lässt und wie wir dabei die beschränkte irdische Perspektive überwinden. Ein solcher nicht geozentrischer Ansatz (»Non-Earth-Centric Approach«) fällt unserem Gehirn, das sich in irdischer Umgebung entwickelt hat, allerdings schwer. Wir sind notorisch schlecht darin, uns das Unbekannte vorzustellen. »Versuchen Sie mal, eine Farbe zu imaginieren, die Sie noch nie gesehen haben«, verdeutlicht Johnson das Problem.
Daher nehmen Astrobiologen vor allem solche potenziellen Aliens in den Blick, die den Organismen auf unserem Heimatplaneten ähneln. Sie betrachten Sauerstoff in der Atmosphäre eines Exoplaneten als Indikator für Leben, weil wir dieses Gas benötigen. Sie werten Methanquellen auf dem Mars als Hinweis auf stoffwechselaktive Extraterrestrische, weil irdische Mikroben den Kohlenwasserstoff freisetzen. Sie kreieren Begriffe wie »habitable Zone« für jene Region um einen Stern, in der Planeten flüssiges Wasser beherbergen können – und setzen damit stillschweigend voraus, dass auf fernen Welten die gleichen Bedingungen als »lebensgünstig« anzusehen sind wie auf der Erde.
Selbst wenn Wissenschaftler eine ihnen unbekannte biologische Form entdecken, neigen sie dazu, sie mit etwas Vertrautem in Verbindung zu bringen. Als beispielsweise der niederländische Naturforscher Antonie van Leeuwenhoek im 17. Jahrhundert durch sein Mikroskop blickte und Einzeller sah, nannte er sie »animalcules«, kleine Tiere – was sie aber nicht sind.
Für Heather Graham, die am Goddard Space Flight Center der NASA arbeitet und in der LAB-Forschungsinitiative eine leitende Position bekleidet, steht van Leeuwenhoeks Entdeckung beispielhaft für eine erfolgreiche Suche nach »Leben, wie wir es nicht kennen«. Das Gleiche gelte für den Nachweis der Archaeen, einer Domäne ursprünglich anmutender Einzeller, die erstmals in den 1970er Jahren beschrieben wurden. »Fremde Spielarten des Lebens zu beobachten, ist in der Wissenschaft nicht neu; die Leute machen das schon eine ganze Weile«, sagt die Forscherin.
Bei einem NASA-Workshop über Biosignaturen kam Graham mit Sarah Stewart Johnson und anderen Fachleuten zusammen, um zu diskutieren, wie sich Komplexität als Marker für Leben nutzen lässt. Überspitzt formuliert lautet der Ansatz: Wenn man auf dem Mars einen Supercomputer findet, weiß man vielleicht nicht, woher er stammt, aber es ist klar, dass er dort nicht spontan und zufällig entstanden ist. Jemand oder etwas muss ihn erschaffen haben.
Bei dem Treffen erarbeiteten die Teilnehmer einen Vorschlag zur Entwicklung eines Messinstruments, den sie der NASA unterbreiteten. Das Gerät sollte Moleküle aufspüren, deren Formen zusammenpassen wie Schlüssel und Schloss. Solche Kombinationen treten in unbelebten chemischen Umgebungen selten auf, lassen sich in lebenden Zellen aber überall nachweisen. Der Vorschlag wurde nicht angenommen, doch die NASA rief bald darauf interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaften für astrobiologische Forschung ins Leben. Damit verknüpft waren mehrjährige Förderprogramme, um einschlägige wissenschaftliche Projekte zu unterstützen.
Johnson und ihre Mitstreiter nahmen das zum Anlass, Planetenforscher, Biologen, Chemiker, Informatiker, Mathematiker und Ingenieure ins Team zu holen. Gemeinsam erarbeiteten sie Konzepte für Messinstrumente, mit denen sich eventuell vorhandene lebende Strukturen auf den Jupiter- und Saturnmonden Europa, Enceladus und Titan nachweisen lassen. »Diese Himmelskörper erscheinen aus menschlicher Sicht äußerst fremdartig und seltsam«, sagt Johnson. Dort habe man folglich die Chance, auf »exotisches« Leben zu stoßen, das uns auf der Erde nicht begegnet.
All diese Bemühungen mündeten in die LAB-Forschungsinitiative. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen beispielsweise herausfinden, wie sich aus der Komplexität von Oberflächen, ungewöhnlichen Anhäufungen bestimmter Stoffe und spezifischen Mechanismen der Energieübertragung auf Leben schließen lässt, wie wir es noch nicht kennen.
Blick in die Vergangenheit
LAB kombiniert Feldforschung, Laborexperimente und theoretische Arbeiten. Geplant ist unter anderem ein Besuch in der kanadischen Kidd-Creek-Mine, die mehr als 3000 Meter in die Tiefe führt. Dort unten befinden sich die Überreste eines Ozeanbodens, der vor 2,7 Milliarden Jahren vulkanisch aktiv war und infolgedessen Sulfiderze enthält. Die Bedingungen, die hier vor Jahrmilliarden herrschten, könnten denen auf »Ozeanwelten« wie dem Jupitermond Europa ähneln. Die Wissenschaftler hoffen, in der Mine Unterschiede zu finden zwischen Mineralen, die sich durch Kristallisation bilden, und Gesteinsstrukturen, die auf biologische Vorgänge zurückgehen. Die zwei ähneln einander oft, da beide geordnet sind. Die Forscher und Forscherinnen möchten die Art der dort vorgefundenen abiotischen Kristalle vorhersagen können. Dabei sollen geochemische Modelle helfen, die computergestützt simulieren, wie Chemikalien aus gesättigten Lösungen ausfallen.
In der Kidd-Creek-Mine treten so genannte Kiddcreekite auf, kristalline Substanzen aus Kupfer, Zinn, Wolfram und Schwefel. Ihr Niederschlag aus gesättigten Lösungen lässt sich am Rechner simulieren. Die entsprechenden Computermodelle sollten jedoch daran scheitern, biologisch entstandene Strukturen vorherzusagen, da diese sich auf Grund anderer Wechselwirkungen und nach anderen Regeln bilden. Falls die Annahme zutrifft, könnten sich geochemische Modelle als nützlich erweisen, um auf anderen Himmelskörpern biotische von abiotischen Strukturen zu unterscheiden.
Ein weiterer Ansatz lautet, die Zahl der Bindungsorte auf Partikeln zu bestimmen, an denen sich Moleküle anlagern – etwa Stellen, an die Antikörper koppeln. »Unsere These besagt, dass es auf etwas Komplexem wie einer Zelle mehr Bindungsstellen gibt als beispielsweise auf einem unbelebten Staubkorn«, erläutert Johnson.
Um das zu testen, erzeugen die Fachleute eine zufällig zusammengestellte Mischung aus DNA-Schnipseln und beschicken eine biologische Zelle damit. Einige Schnipsel heften sich an deren Außenseite, andere nicht. Die gebundenen entfernt das Team und sammelt sie ein, die ungebundenen sendet es erneut zur Zielzelle. Das Ganze wird mehrfach wiederholt. Am Ende sehen die Wissenschaftler, wie viele Schnipsel angekoppelt haben und wie viele in der Lösung geblieben sind. Dieses Verhältnis lässt sich für verschiedene Partikelarten bestimmen, etwa Mikroben und mineralische Körner, und entsprechend vergleichen.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Nichtleben und Leben: Ersteres ist meist im Gleichgewicht mit seiner Umgebung, während Letzteres Energie aufwendet, um sich von der Umwelt zu separieren. »Lebewesen müssen Ressourcen investieren, um sich nach außen abzugrenzen«, sagt der Biologe Peter Girguis von der Harvard University. Der Zweig eines Baums etwa unterscheidet sich im Wassergehalt, in den Stoffwechselaktivitäten und so weiter von seiner Umgebung. Schneidet man ihn ab, beraubt man ihn seiner Energiezufuhr und er stirbt ab. »Anschließend löst er sich immer weiter auf, bis es keine Unterschiede mehr zwischen ihm und der Umwelt gibt«, sagt Girguis. »Mit anderen Worten: Es stellt sich ein Gleichgewicht ein.«
Das Ungleichgewicht, das lebende Strukturen kennzeichnet, sollte sich in aller Regel als chemisches Gefälle zwischen Organismen und ihrer Umwelt zeigen – unabhängig davon, woraus genau sie jeweils beschaffen sind. »Ich kann eine fremde Umgebung analysieren und darin etwa die Verteilung von Kalium ermitteln«, sagt Girguis. Komme dabei heraus, dass die Kaliumkonzentration an manchen Orten deutlich höher liegt als an anderen, handle es sich um einen möglichen Hinweis auf biologische Aktivität.
Die Forschungsarbeiten von Girguis sind mit einem weiteren thematischen Schwerpunkt der LAB-Initiative verknüpft: dem Konzept der chemischen Fraktionierung. Es besagt, dass lebende Organismen manche Elemente beziehungsweise Isotope gegenüber anderen bevorzugen. Ein Team um Christopher House von der Pennsylvania State University befasst sich mit diesem Phänomen und nutzt Messdaten von Raumsonden, um die chemische Zusammensetzung von Planeten und Monden zu untersuchen. »So wie irdische Lebewesen Isotope und Elemente selektiv aufnehmen oder abweisen, kann man sich das auch bei außerirdischen Organismen vorstellen«, erklärt House. »Freilich dürften bei diesen andere Stoffe und Isotope eine Rolle spielen.«
Eine Frage des Durchmessers
House und sein Team untersuchen Sedimente in Westaustralien, die Spuren früher irdischer Lebensformen bergen. Anhand dieser Gesteinsanalysen hoffen die Forscher zu erkennen, welche Isotope beziehungsweise Elemente die damaligen Organismen anreicherten. »Vielleicht lassen sich daraus allgemeine Schlüsse ziehen, welche chemischen Muster mit der Existenz von Leben einhergehen«, sagt House.
Eine LAB-Forschungsgruppe für theoretische Studien, geleitet von Chris Kempes vom Santa Fe Institute in New Mexico, beschäftigt sich mit solchen Verallgemeinerungen. Ihre Arbeiten drehen sich um so genannte Skalierungsphänomene. Konkret geht es darum, wie sich die Biochemie des Zellinnenraums mit wachsendem Zelldurchmesser verändert, ob dies in vorhersagbarer Weise geschieht und ob die relativen Häufigkeiten unterschiedlich großer Zellen einem Muster folgen. Kempes, House, Graham und ihre Mitarbeiter veröffentlichten 2021 im Fachblatt »Bulletin of Mathematical Biology« einen Artikel darüber, wie sich entsprechende Skalierungsgesetze auf Bakterien anwenden lassen. Sortiert man Mikroben zum Beispiel nach Größe, stellt man fest: Die chemischen Verhältnisse unterscheiden sich mit zunehmender Zellgröße immer stärker von denen der Umgebung.
Die relativen Häufigkeiten von Zellen unterschiedlicher Größe folgen üblicherweise einer Potenzfunktion: Die kleinsten sind am zahlreichsten; mit wachsendem Zelldurchmesser werden sie immer seltener. Zeigen sich in einer Probe außerirdischen Materials die gleichen mathematischen Beziehungen (viele kleine Einheiten, die ihrer Umgebung ähneln, und wenige große, die von der Umwelt stärker abweichen), könnte das auf lebende Organismen hindeuten. Und zwar unabhängig davon, welche chemischen Verhältnisse in der Probe und auf dem jeweiligen Himmelskörper konkret herrschen.
Leroy Cronin hat eigene Ideen zur Unterscheidung zwischen lebendig und nicht lebendig. Er verficht die so genannte Assembly-These, laut der man feststellen kann, ob eine Sache komplex ist, ohne etwas über ihren Ursprung zu wissen. Je komplexer ein Molekül, desto wahrscheinlicher ist es, dass es einem Lebewesen entstammt. Denn der sich selbst erhaltende, sich selbst reproduzierende Stoffwechselapparat biologischer Organismen basiert auf komplizierten makromolekularen Verbindungen und den Aggregaten, zu denen sie sich zusammenlagern. Laut Assembly-These lässt sich die Komplexität von Molekülen mit ihrer »Zusammenbauzahl« beziffern. Diese gibt an, wie viele Bausteine in jeweils welcher Menge zusammengefügt werden müssen, um das entsprechende Molekül hervorzubringen. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Wort »Abrakadabra«. Um es zu erzeugen, fügt man zunächst ein A und ein b zusammen. Es kommt »Ab« heraus, zu dem wir r addieren und anschließend a, um »Abra« zu erhalten. Weiterhin geben wir k, a und schließlich d hinzu, um »Abrakad« zu bekommen. Fügt man jetzt das »abra« an, das bereits in einem früheren Schritt gebildet wurde, ist man am Ziel. Das ergibt insgesamt sieben Schritte, womit »Abrakadabra« eine Zusammenbauzahl von sieben hat.
Cronin und sein Team vermuten: Moleküle mit hoher Zusammenbauzahl hinterlassen bei massenspektrometrischen Untersuchungen einen komplizierten »Fingerabdruck«. (Ein Massenspektrometer trennt die Bestandteile einer Probe nach ihrer Masse und elektrischen Ladung; anhand der Messdaten kann man erkennen, woraus die Probe besteht.) Je komplexer demnach ein Molekül, umso mehr Messwertausschläge liefert die massenspektrometrische Analyse – unter anderem deshalb, weil komplizierter aufgebaute Moleküle mehr Bindungen enthalten. Die Zahl dieser Ausschläge wiederum ist ein grobes Maß für die Zusammenbauzahl.
Cronin postulierte, dass sich mit Hilfe der Massenspektrometrie die Komplexität einer chemischen Verbindung ermitteln lässt, ohne überhaupt zu wissen, um welche es sich handelt. Falls das dabei ermittelte Ergebnis einen gewissen Schwellenwert überschreitet, so die Annahme, stammt das Molekül wahrscheinlich aus einem biologischen Prozess.
Um dies zu prüfen, stellte ihm die NASA im Rahmen der LAB-Initiative verschiedene Proben zur Verfügung, die entweder biologischen Ursprungs waren oder nicht. Das Material stammte unter anderem aus dem Weltraum, fossilen Lagerstätten, Gewässersedimenten und vom Murchison-Meteoriten, einem rund 100 Kilogramm schweren Brocken mit hohem Gehalt an organischen Verbindungen. Während der Messungen und ihrer Auswertung wusste keiner der Experimentierenden, um welche Probe es sich jeweils handelte; dies wurde erst hinterher aufgedeckt. »Alle dachten, unser Messverfahren würde versagen – vor allem, weil der Murchison-Klumpen zu den komplexesten interstellaren Materialien gehört, die wir kennen«, erzählt Cronin. Doch die Methode bewährte sich: »Salopp ausgedrückt, teilte sie uns mit, dass der Meteorit ein bisschen seltsam beschaffen ist, aber nicht zu den Lebewesen gehört.«
Eine andere Probe enthielt Material von 14 Millionen Jahre alten Fossilien. Die Fachleute nahmen an, wegen des hohen Alters würde das Messverfahren sie als »unbelebter Herkunft« einordnen. Aber das war nicht der Fall. »Die Technik kam rasch dahinter, dass diese Probe biologischen Ursprungs ist«, schildert Cronin. Im Jahr 2021 publizierte seine Forschungsgruppe ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift »Nature Communications«.
Die Überlegungen zu (extraterrestrischem) Leben, wie wir es nicht kennen, wirken sich schon heute darauf aus, wie Fachleute erdähnliche Verhältnisse auf Exoplaneten bewerten. Victoria Meadows von der University of Washington beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit Messdaten solch ferner Himmelskörper und hat miterlebt, wie sich ihre Disziplin verändert hat. Früher hätte man den Nachweis von Sauerstoff auf einem Exoplaneten als Volltreffer bei der Suche nach Leben angesehen. Heute sei das nicht mehr so. »Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass mutmaßliche Biosignaturen im Kontext ihrer Umgebung interpretiert werden müssen«, sagt Meadows. Man müsse die Verhältnisse auf einem fernen Planeten und seinem Mutterstern erst hinreichend gut kennen, um einschätzen zu können, was die Existenz von Sauerstoff dort bedeutet. Das Element müsse nicht zwangsläufig auf Leben hindeuten, sondern könnte beispielsweise einem siedenden Ozean entweichen.
Die Suche nach agnostischen Biosignaturen ist aus Meadows' Sicht das geeignete Vorgehen, um nach Leben im Kosmos zu fahnden. Doch sei auf diesem Feld noch ein weiter Weg zurückzulegen. »Die Forschung steckt in den Kinderschuhen; umso wichtiger sind die Pionierarbeiten, die die LAB-Initiative hier leistet.«
Zu den wichtigsten Zielen des LAB-Projekts gehört es, Instrumente zu entwickeln, mit denen Raumsonden fremdartiges Leben erkennen können. Einzelne Daten von einzelnen Geräten liefern dabei keinen zuverlässigen Nachweis. Die Fachleute arbeiten daher an Instrumentengruppen, deren Komponenten in unterschiedlichsten Umgebungen zusammenarbeiten. Solche Geräteensembles könnten zum Beispiel nach Molekülen mit großer Zusammenbauzahl suchen, die sich an einzelnen Orten ansammeln, welche sich deutlich von ihrer Umwelt unterscheiden.
Selbst wenn ein derartiges Verfahren eines Tages einen Treffer liefert, wird das wahrscheinlich die Frage noch nicht endgültig beantworten, ob es außer den irdischen noch andere Lebewesen im All gibt. Auf jeden Fall dürften umfangreiche Folgeuntersuchungen nötig sein – und die werden angesichts der riesigen Entfernungen im Kosmos dauern und kosten. Die Suche nach Aliens, so viel ist sicher, erfordert jede Menge Geduld.
Schreiben Sie uns!