Topologische Quantencomputer: Berechnungen im Flachland
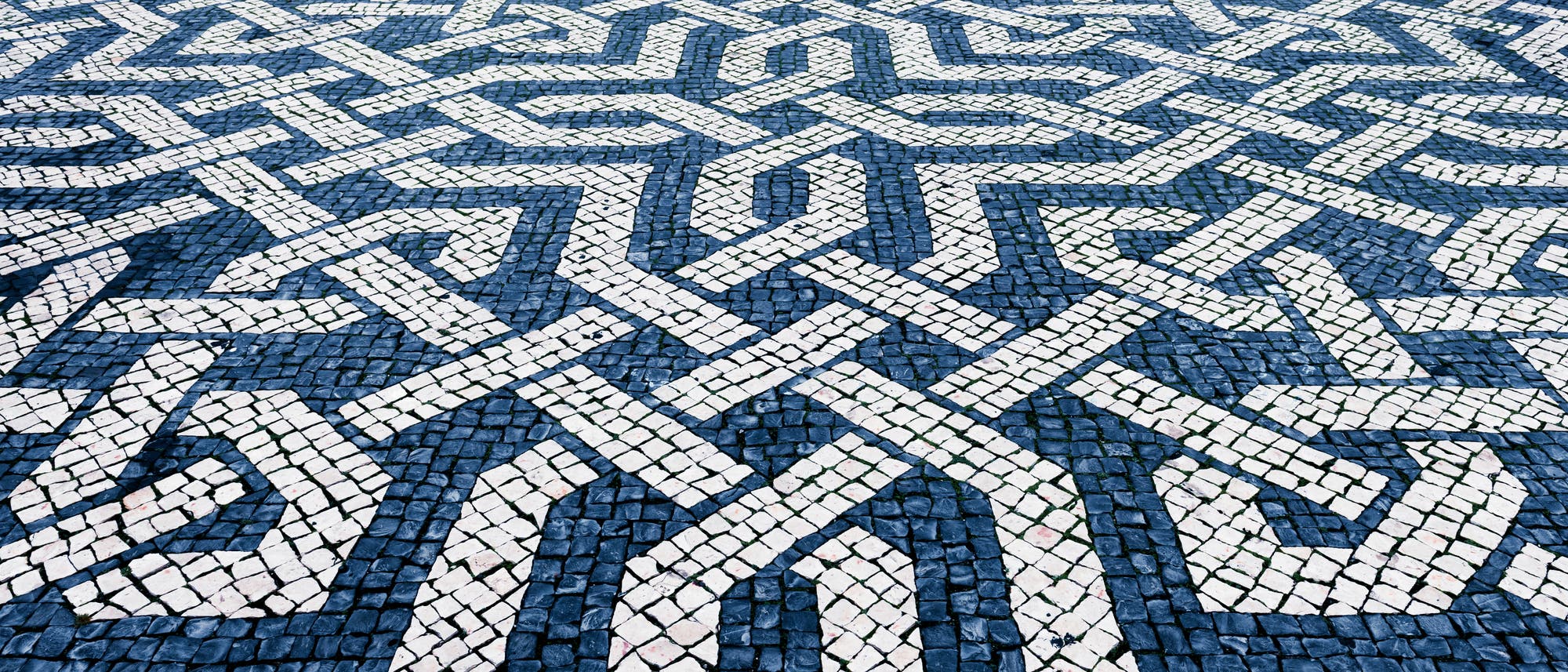
Drei Ringe, so miteinander verbunden, dass sie sich nicht trennen lassen, solange keiner von ihnen durchschnitten oder entfernt wird. In vielen Kulturen dieser Welt gilt das Muster als Symbol für Vernetzung und Stärke durch Einigkeit. Benannt nach der italienischen Familie der Borromäer, die sie in ihrem Familienwappen führten, stehen die Borromäischen Ringe heute zudem für eine neue Ära des Quantencomputings: Gelänge es, solche verwobenen Zustände in Materie zu erzeugen, würden die Rechner der Zukunft weniger empfindlich auf ihre Umgebung reagieren und dadurch stabiler laufen. Denn aktuell reagieren die Informationseinheiten von Quantencomputern, so genannte Qubits, äußerst sensibel auf äußere Einflüsse und lösen sich innerhalb kurzer Zeit in Wohlgefallen auf.
Bereits vor rund 40 Jahren dachten die beiden norwegischen Physiker Jon Leinaas und Jan Myrheim über bizarre Teilchen nach, die nur in einer flachen Welt überleben können und sehr robust sind gegen Störungen von außen. Eine bestimmte Sorte davon, so genannte nichtabelsche Anyonen, sind allerdings experimentell extrem schwer zu erzeugen und existieren bislang nur auf dem Papier von theoretischen Physikern.
Nun haben mehrere Forschungsgruppen unabhängig voneinander verkündet, nichtabelsche Anyonen auf Quantenprozessoren simuliert zu haben, darunter ein Team von IBM Quantum bereits im Jahr 2020 und erneut 2023, eins von Google Quantum AI im Jahr 2022 sowie Physikerinnen und Physiker des britisch-amerikanischen Unternehmens Quantinuum ganz aktuell im Mai 2023. Damit sind sie zwar den tatsächlichen Zuständen nicht näher gekommen, sie konnten aber zeigen, dass Quantenberechnungen mit ihnen wirklich funktionieren würden. Vorausgesetzt natürlich, es gelingt, die hypothetischen Materiezustände eines Tages tatsächlich zu erzeugen.
Die Theorie der Anyonen geht davon aus, dass in einer zweidimensionalen Welt neben den beiden bekannten Teilchenfamilien eine dritte Teilchenart möglich ist. Alle bekannten Elementarteilchen gehören entweder zu den Fermionen (Quarks, Elektronen, Neutrinos und so weiter), aus denen die Materie aufgebaut ist, oder den Bosonen (zum Beispiel Photonen oder Gluonen), die die Kräfte zwischen den Materieteilchen vermitteln. Fermionen und Bosonen unterscheiden sich durch ihren Spin, ein quantenmechanisches Merkmal, das einem Bahndrehimpuls gleicht: Fermionen haben immer einen halbzahligen Spin, während Bosonen einen ganzzahligen besitzen.
Eine völlig neue Art von Teilchen mit einem Gedächtnis
Die Unterschiede zwischen Fermionen und Bosonen gehen aber noch weiter – mit erheblichen Konsequenzen: Während bosonische Teilchen sich verdichten lassen und gemeinsam den gleichen Zustand annehmen können (wie es bei einem Bose-Einstein-Kondensat der Fall ist), greift bei Fermionen das Pauli-Prinzip, das sie auf Distanz hält. Es verbietet, dass sich zwei Fermionen im selben Zustand am gleichen Ort befinden. Diesem Prinzip verdanken wir die Elektronenhüllen, den Aufbau von Atomen und damit letztlich unsere Existenz.
Grund für dieses unterschiedliche Verhalten ist die Wellenfunktion, die quantenmechanische Objekte beschreibt: Vertauscht man zwei Fermionen miteinander, erhält die Wellenfunktion des Gesamtsystems ein negatives Vorzeichen. Bei Bosonen bewirkt eine Vertauschung hingegen nichts, die Wellenfunktion bleibt gleich.
Und hier kommen die Anyonen ins Spiel: Im Flachland könnten auch Teilchen existieren, deren Wellenfunktion nach einer Vertauschung in ihrer Phase verschoben wird. Sprich: Neben dem Faktor 1 und −1 ist bei Anyonen auch ein komplexer Wert eiφ möglich. Da diese Eigenschaft eng mit dem Spin der Teilchen verbunden ist und Anyonen damit jede (englisch: any) Art von Spin haben können, entschied sich der spätere Nobelpreisträger Frank Wilczek in den 1980er Jahren für den Namen »Anyonen«.
Nun scheint es so, als wären Anyonen eine abstrakte mathematische Spielerei. Schließlich leben wir in einer dreidimensionalen Welt, in der bloß Fermionen und Bosonen vorkommen. Auch wenn sie nicht als Elementarteilchen auftauchen können, so sind zumindest in Festkörpern anyonische Zustände möglich. Denn die Materialwissenschaften bilden gewissermaßen eine Spielwiese für allerlei exotische Teilchenarten: Da die Stoffe aus Abermilliarden Teilchen bestehen, die unentwegt miteinander wechselwirken, können seltsame Phänomene in ihnen auftreten. Zum Beispiel kann das Zusammenspiel aus mehreren Teilchen dazu führen, dass sich die gesamte Anregung wie ein anderes Partikel verhält, das gar nicht im Material auftaucht. Solche Quasiteilchen lassen sich mit einer La-Ola-Welle in einem Stadion vergleichen: Anstatt jede Person einzeln zu beschreiben, die ihre Arme hebt und senkt, kann man das Phänomen stattdessen durch eine Welle modellieren.
Die Suche nach nichtabelschen Anyonen ist geprägt von Misserfolgen
In flachen, zweidimensionalen Materialien könnten demnach auch Anyonen auftauchen. Und tatsächlich ist es Forscherinnen und Forschern im Jahr 2020 erstmals gelungen, Anyonen in einem zweidimensionalen Elektronengas nachzuweisen. Doch dabei handelte es sich um eine spezielle Art dieser Teilchenfamilie, um die so genannten abelschen Anyonen. Diese haben zwar auch spannende physikalische Eigenschaften, besitzen aber nicht die erstaunlichen Fähigkeiten der nichtabelschen Versionen, die robuste Quantencomputer ermöglichen könnten.
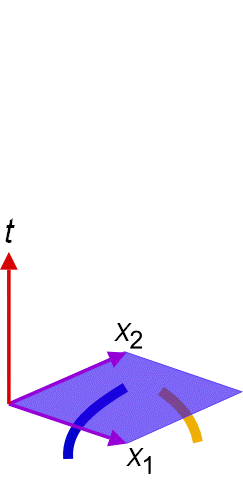
Die Begriffe »abelsch« und »nichtabelsch« sind an den Mathematiker Niels Henrik Abel (1802–1829) angelehnt, der als Mitbegründer der Gruppentheorie gilt. Mit »abelsch« bezeichnet man in der Algebra beispielsweise Operationen, die auch umgekehrt ablaufen können, wie die Addition oder Multiplikation: a plus oder mal b ist das Gleiche wie b plus oder mal a, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Das lernt man in der Grundschule als Kommutationsgesetz kennen. So ist es auch bei abelschen Anyonen: Vertauscht man mehrere dieser Teilchen erst auf die eine und dann auf die andere Weise, erhält die gesamte Wellenfunktion den gleichen Vorfaktor wie bei einer Vertauschung in umgekehrter Reihenfolge.
Bei nichtabelschen Anyonen ist das anders. So, wie a geteilt durch b einen anderen Wert liefert als b dividiert durch a, kommt es bei der Vertauschung von solchen Teilchen auch auf die Reihenfolge an. Sie besitzen damit gewissermaßen ein Gedächtnis: Wenn man nichtabelsche Anyonen nacheinander umordnet, kann man am Ende aus der Wellenfunktion ablesen, welche Vertauschungen in welcher Reihenfolge vorgenommen wurden. 2001 erkannte der theoretische Physiker Alexei Kitajew, dass sich diese Eigenschaft nutzen lässt, um Quantenberechnungen durchzuführen.
Der Vorteil: Solche Berechnungen sind extrem stabil. Denn das Ergebnis hängt bloß von den Vertauschungen und nicht von den Details des Pfades ab, die ein Qubit unternimmt. Auch wenn das Quasiteilchen auf seinem Weg von äußeren Einflüssen beeinflusst wird und daher beispielsweise leicht hin und her wackelt, ändert das nichts an dem Ergebnis der Berechnung. Aus diesem Grund werden solche Qubits als »topologisch« bezeichnet, weil es in der Topologie ebenfalls nur um wesentliche Merkmale von Objekten geht anstatt um Details. Auf eine solche Weise erzeugte Qubits sind deutlich weniger empfindlich als herkömmliche Varianten. Theoretische Berechnungen legen nahe, dass nichtabelsche Anyonen in Festkörpern sehr widerstandsfähig sind und leichte Temperaturschwankungen oder Erschütterungen unbeschadet überstehen.
Der heilige Gral für Quantencomputer
Daher gelten solche topologischen Qubits als der heilige Gral für Quantencomputer. Microsoft hat bereits hunderte Millionen US-Dollar in die Entwicklung der Quasiteilchen gesteckt. Doch die Forschung in dem Bereich ist bisher von Misserfolgen geprägt. Im Jahr 2017 eröffnete Microsoft ein Forschungszentrum in direkter Nachbarschaft zur Technischen Universität Delft, das Leo Kouwenhoven, ein Professor am dortigen QuTech-Institut, leiten sollte. Ein Jahr darauf, im April 2018, veröffentlichte das Team eine Arbeit in »Nature«, in der es verkündete, erstmals ein nichtabelsches Anyon nachgewiesen zu haben. Doch die ehemaligen Mitarbeiter von Kouwenhoven, Sergey Frolov und Vincent Mourik, machten die Öffentlichkeit im Frühling 2020 darauf aufmerksam, dass sich die Ergebnisse der Gruppe in Delft nicht reproduzieren lassen. Schließlich gestand auch Kouwenhoven ein, dass er und sein Team bei der Auswertung der Ergebnisse Fehler gemacht hätten, und zog im März 2021 seine Arbeit zurück.
Ähnliches ereignete sich auch bei einer Veröffentlichung des Teams um den Physiker Charlie Marcus vom Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen. Im März 2020 gaben die Forscherinnen und Forscher in einem bei »Science« erschienenen Aufsatz bekannt, eine bestimmte Art von nichtabelschen Anyonen detektiert zu haben. Auf Wunsch der Leser veröffentlichte das Forschungsteam weitere Messdaten, die schließlich die Redakteure der Fachzeitschrift veranlassten, die Forschungsergebnisse anzuzweifeln. Der Großteil der wissenschaftlichen Community ist sich einig, dass es bisher noch nicht gelungen ist, zweifelsfrei nichtabelsche Anyonen in einem realen Material nachzuweisen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass in Festkörpern andere Quasiteilchen entstehen können, die ähnliche Merkmale besitzen. Um wirklich zweifelsfrei zu zeigen, dass es sich um die gewünschten nichtabelschen Anyonen handelt, müsste man ihre topologischen Eigenschaften untersuchen – etwa indem man sie miteinander vertauscht und die Wellenfunktion überprüft. Demnach genügt es also nicht, ein solches Quasiteilchen zu erzeugen, sondern man braucht gleich mehrere und man muss sie extrem gut kontrollieren können. Eine echte Herausforderung.
Quantencomputer als Simulationsmaschine
Nun haben die eingangs erwähnten Forschungsgruppen einen anderen Ansatz gewählt, um das Potenzial von nichtabelschen Anyonen zu untersuchen: Sie nutzten einen Quantensimulator. Bei diesem Ansatz verwendet man Quantensysteme, um andere – teilweise unerreichbare – Quantensysteme zu modellieren. Denn wie sich herausstellt, lässt sich das Verhalten komplexer quantenmechanischer Objekte mit klassischen Rechnern oft nur schwer simulieren: Die starke Wechselwirkung der Teilchen selbst über weite Distanzen hinweg überfordert viele Rechner. Von Hand lassen sich die komplizierten Gleichungen schon gar nicht lösen. Daher macht man sich die Eigenheiten der Quantensysteme zu Nutze und lässt sie selbst rechnen. Indem man die Wellenfunktionen passend präpariert, können Qubits die gewünschten Teilchen und Wechselwirkungen nachahmen.
Die erforderliche Kontrolle ermöglichen Quantenprozessoren: Denn sie tun nichts anderes, als Qubits durch gezielte Manipulation von einem Zustand in einen anderen zu verfrachten. Das haben nun mehrere Forschungsgruppen unabhängig voneinander ausgenutzt, um unterschiedliche Arten von nichtabelschen Anyonen zu simulieren – und miteinander zu verflechten.
Das Team von Google Quantum AI hat in einer im Oktober 2022 veröffentlichten (und noch nicht begutachteten) Arbeit einen Quantenprozessor aus supraleitenden Schaltkreisen genutzt. Die Forscherinnen und Forscher ordneten sie in einem Gitter aus fünf mal fünf Qubits an und stellten die Wechselwirkungen zwischen ihnen so ein, dass topologische Eigenschaften in den Wellenfunktionen hervorgerufen werden. Dazu erzeugten die Fachleute bestimmte Arten von Fehlstellen im Gitter, indem sie die Verbindung mancher Qubits zueinander kappten. Wie sich herausstellt, entstehen dadurch »Ising Anyonen«, eine der einfachsten Formen eines nichtabelschen Quasiteilchens. Ohne die supraleitenden Qubits zu bewegen, konnten die Forscherinnen und Forscher die simulierten Anyonen umeinander herumführen und die dadurch entstehenden Veränderungen in der Wellenfunktion ablesen.
Das Team um den Physiker Nikhil Harle von IBM Quantum verwendete in einer im April 2023 bei »Nature Communications« veröffentlichten Arbeit ebenfalls supraleitende Qubits, um ein topologisches System zu simulieren. Es modellierte mit zehn Qubits einen eindimensionalen topologischen Supraleiter: Dafür koppelt man jeweils zwei Qubits miteinander, was supraleitenden Cooper-Paaren entspricht, lässt aber die zwei Qubits am Rand unverbunden. Diese entsprechen dann einer »Majorana Nullmode«, ebenfalls ein Quasiteilchen mit nichtabelschen Eigenschaften. Auch in diesem Fall konnten die Physiker die Majorana-Quasiteilchen miteinander verflechten, um anschließend die Signaturen in den Wellenfunktionen herauszulesen.
Auch wenn die simulierten Quasiteilchen in den beiden Experimenten nichtabelschen Anyonen entsprechen, so sind es vereinfachte Versionen davon: »Es handelt sich um eine Art Baby-nichtabelsche-Anregung«, sagte die Physikerin Fiona Burnell von der University of Minnesota dem »Quanta Magazine«. Denn in diesen Fällen tauchen die topologischen Quasiteilchen lediglich auf, weil die zu Grunde liegenden physikalischen Systeme Fehlstellen enthalten. Es ist nicht die Struktur der Systeme selbst, die sie erzeugen.
Oh yeah? Where is that old cranky quantum bullshit detector? pic.twitter.com/wl96zVTlt5
— Sergey Frolov🇺🇦 (@spinespresso) May 11, 2023
Das Team um den Physiker Henrik Dreyer vom Unternehmen Quantinuum, das aus der Fusion zwischen der Quantencomputer-Abteilung von Honeywell und einem britischen Start-up hervorgegangen ist, hat es sich hingegen zum Ziel gesetzt, ein perfektes Gitter ohne Fehlstellen zu simulieren, dessen Anregungen nichtabelschen Anyonen entsprechen. In ihrer im Mai 2023 erschienenen, noch nicht begutachteten Arbeit haben die Forscherinnen und Forscher von Quantinuum dafür ihren neu vorgestellten Quantenprozessor H2 genutzt, der 32 Qubits in Form gefangener Ionen enthält. Indem sie die Teilchen miteinander verschränkten, konnten sie eine bestimmte Art von Gitter (ein »Kagome-Gitter«) simulieren, das dafür bekannt ist, nichtabelsche Quasiteilchen aufzuweisen. Auf dem Computerchip konnten die Forscherinnen und Forscher simulieren, dass drei der Anyonen sich entlang eines Borromäischen Rings umeinander bewegen. Diese verknotete Struktur konnten sie anschließend aus der Wellenfunktion herauslesen.
»Die zu Grunde liegende Mathematik ist wirklich schön, und es lohnt sich auf jeden Fall, das Prinzip zu validieren«, sagte der Physiker Chetan Nayak von Microsoft dem »Quanta Magazine«. Er hoffe jedoch darauf, eines Tages ein reales System mit dieser Struktur zu sehen.
»Es ist eine deutliche Übertreibung zu behaupten, man habe nichtabelsche Anyonen erzeugt. Das verwässert die Arbeit all der Gruppen, die es wirklich in einem echten Festkörpersystem probieren«Vincent Mourik, Physiker
Der heute am Forschungszentrum Jülich zu so genannten Spin-Qubits forschende Physiker Vincent Mourik, der 2020 auf die Unstimmigkeiten in der Delfter Veröffentlichung aufmerksam machte, geht mit seiner Kritik an der Verkündigung von Quantinuum in einer Pressekonferenz, »ein nichtabelsches Anyon erzeugt zu haben«, noch einen Schritt weiter: »Es ist eine deutliche Übertreibung zu behaupten, man habe nichtabelsche Anyonen erzeugt. Das verwässert die Arbeit all der Gruppen, die es wirklich in einem echten Festkörpersystem probieren.« Es sei absolut legitim, Quantensimulationen auf Quantenprozessoren laufen zu lassen. Das sei sogar wichtig, um die Fähigkeiten der Systeme zu testen und auszureizen. »Soweit ich das anhand der spärlichen Daten, die bislang veröffentlicht wurden, beurteilen kann, ist das genau das, was die Forscher von Quantinuum gemacht haben. Das hat aber nichts mit fehlertoleranten topologischen Quantencomputern zu tun«, stellt Mourik klar. Wichtig sei jetzt vor allem, dass sich die Ergebnisse extern reproduzieren und von anderen Gruppen überprüfen lassen.
Denn: In allen drei Fällen wurden weder die Berechnungen noch die Qubits an sich robuster. Die topologischen Eigenschaften, die die gewünschten Vorteile mit sich bringen, sind in den Systemen nur simuliert. Aber die Bemühungen der Forschungsgruppen zeigen, dass Kitajews Idee sich realisieren lässt: ein robuster Quantencomputer, der mit nichtabelschen Anyonen läuft. Jetzt braucht man nur noch die topologischen Qubits dafür.
Mitarbeit von Katharina Menne
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben